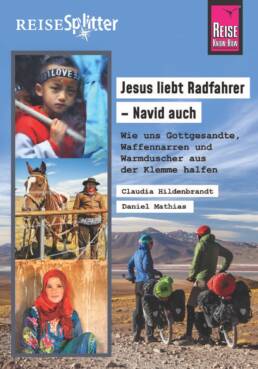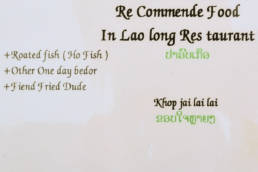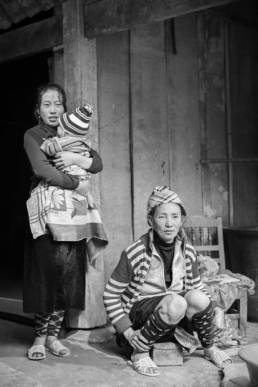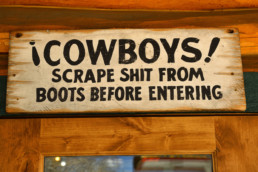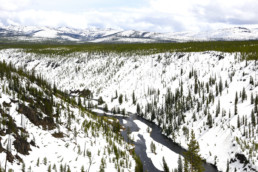Testbericht Yeti Fusion Dry 1300
Testbericht Yeti Fusion Dry 1300
06. Juni 2020
Für unsere zweijährige Radreise durch fünf Kontinente und vier Klimazonen suchten wir einen Schlafsack, der – wie sollte es anders sein – bei kleinem Packmaß und geringem Gewicht möglichst gut isoliert. Wir orientierten uns an den höchsten (45 °C) und niedrigsten (-15 °C) zu erwartenden Temperaturen und legten besonderen Wert auf erholsamen Schlaf, sprich: der Schlafsack sollte auch in den kältesten Nächten ganz sicher warm halten. Wir gingen davon aus, dass unser mobiles Federbett viele hundert Mal in einen Kompressionssack gestopft werden würde, was hohe Anforderungen an einen robusten Hüllstoff stellt. Außerdem waren tage- bis wochenlang hohe Luftfeuchtigkeit und regennasse Nächte bei der Wahl des Futters zu berücksichtigen. Wir wussten, dass wir den Schlafsack wohl zwei Jahre lang nicht würden waschen können.
Unter diesen Aspekten wäre eine Kunstfaserfüllung, die pflegeleicht ist und auch bei Feuchtigkeit noch gut wärmt, wohl eine gute Wahl gewesen. Da Daune in Relation zu Packmaß und Gewicht jedoch besser isoliert, gaben wir dieser Füllung letztlich den Vorzug. Obwohl ein Inlet das Gewebe vor Verschmutzung schützt, entschieden wir uns aus Gewichtsgründen gegen diese zweite Haut.
Facts & Features
Unser neues Daunenbett kam in einem geräumigen Aufbewahrungsnetz. Der beiliegende Transportsack aus wasserabweisendem Gewebe ist mit 20 x 46 cm relativ groß und bietet keine Kompressionsriemen – für uns kein Manko, wir wollten die Schlafsäcke ohnehin in wasserdichten Packsäcken mit Wickelverschluss transportieren.
Die Konstruktion der einzelnen Kammern ist auf erwartungsgemäß auf hohem Niveau: H- und S-Kammern verhindern zuverlässig ein Verrutschen der Daunenfüllung (1,3 Kilogramm hochwertige Daunen im Verhältnis 90/10, 700 Cuin nach EU-Norm). Eine dreilagige Fußkammer bietet besondere Isolation der unteren Extremitäten. Wie in diesem Preissegment zu erwarten, ist der Reißverschluss mit einer dicken Daunenwulst hinterlegt, um Kältebrücken zu vermeiden. Kopf und Hals werden von separat verstellbarer Kapuze und Kragen vor Auskühlung geschützt.
Daniel (Körpergröße 185 cm) nutzt ein Modell der Größe L, Claudia (175 cm) Größe M. Das mit 1950 g bzw. 1880 g relativ hohe Gewicht ist in Anbetracht der robusten Verarbeitung absolut akzeptabel – wer es leichter möchte, kann auf alternative Modelle mit anderen Schwerpunkten zurückgreifen.
Im Einsatz
Nach dem ersten Auspacken im Zelt waren wir ob des schieren Volumens beeindruckt: die Daunenbetten plusterten sich auf wie zwei Hefekuchen, sodass kaum noch Platz für uns blieb. Spätestens nach Sonnenuntergang kam jedoch Freude auf. Der Innenstoff ist angenehm weich, raschelarm und hinterlässt auch in feuchtem Zustand kein unangenehm klebriges Hautgefühl. Der Reißverschluss befindet sich auf der linken Seite und ist daher für Rechtshänder etwas besser zu erreichen. Die Zähne sind über die gesamte Länge mit einem derben Stoffband hinterlegt, das ein Einklemmen des Futters zuverlässig verhindert. Einhändig lässt sich der Reißverschluss dennoch nicht immer schließen, da das gefüllte Innere förmlich hervorquillt. Sollte es doch einmal passieren (was selten vorkam), ist das Futter robust genug. Das obere Ende der Zahnleiste ist noch einmal mittels Klettverschlussband vor versehentlichem Öffnen gesichert und durch eine breite Stoffkappe abgedeckt – kein Kratzen am Kinn! Der Zipper ist in seiner gesamten Länge mit einer daunengefüllten Stoffwulst unterfüttert und schließt etwa 50 cm oberhalb des Fußendes. Die Fußkammer selbst ist tatsächlich sehr dick gepolstert – man merkt, dass besonderer Wert auf den Einsatz unter sehr kalten Bedingungen gelegt wurde. Kapuze und Kragen lassen sich unabhängig voneinander mit zwei Kordeln regulieren, die beide auf der rechten Seite angebracht werden. Einziges Manko: Bei enger Einstellung drücken diese etwas auf der Haut. Wünschenswert wäre zudem eine bessere räumliche Trennung der Kordeln, die Justierung ist im Dunkeln manchmal etwas fummelig. Der Isolationsleistung tut das natürlich keinen Abbruch: Die angepasste Kapuze dreht sich bei Kopfbewegungen mühelos mit und der zusätzliche Wärmeeffekt ist tatsächlich beeindruckend.
Natürlich fehlt das obligatorische Innennetz für kälteempfindliche Geräte und Handy nicht, am Fußende befinden sich außerdem zwei kleine Hängeschlaufen zum morgendlichen Trocknen.
Die ersten Nächte verbrachten wir im frühsommerlich heißen Iran mit Nachttemperaturen bis minimal 20 °C. Entgegen unserer Erwartungen war das Daunenungetüm jedoch nicht zu warm oder hinderlich: Wir packten einfach nur einen der beiden Schlafsäcke aus und deckten uns im Verlauf der Nacht nach und nach bis zur Hüfte zu. Die erste richtige Bewährungsprobe erwartete uns nach etwa 200 Nächten im pakistanischen Karakorum. Auf ca. 4.000 m Höhe fiel das Thermometer auf -10 °C. Am Morgen waren die neben uns liegenden Trinkflaschen fast durchgefroren und das Innenzelt mit einer dicken Schicht Raureif überzogen. Mit zugezogener Kapuze und Halskragen erwachte Daniel, obwohl nur in Shirt und Boxershort schlafend, in den frühen Morgenstunden schweißgebadet. Zur gleichen Zeit war der gesamte untere Bereich des Schlafsacks mit einer dicken Schicht hart gefrorenen Kondenswassers überzogen, im Inneren jedoch mollig warm und trocken – unglaublich, was ein paar Zentimeter Daune leisten können!
Im Verlauf der Reise verbrachten wir viele ähnlich klirrende Nächte im Pamir, den Anden oder Rocky Mountains, in denen wir ausnahmslos warm und trocken schliefen. Selbst in der mit -16 °C kältesten Nacht und nach bis zu diesem Zeitpunkt immerhin 400 Tagen im Einsatz hatten wir nicht das Gefühl, die Schlafsäcke an ihre Grenzen zu bringen.
Außerhalb der sehr trockenen Wüstengebiete waren besonders die Fußkammern jeden Morgen von Kondenswasser durchfeuchtet. In den Tropen erreichte die Luftfeuchtigkeit solche Ausmaße, dass die Schlafsäcke beinahe nass an dem Körper klebten und tagelang nicht trockneten – warm hielten sie trotzdem. Von diesen Ausnahmesituationen abgesehen ging das Trocknen selbst meist recht flott: Wir hingen unsere Bettwäsche einfach dank der Schlaufen an den nächsten Ast oder über die Fahrräder, der schwarze Stoff erwärmte sich in der Sonne und war flugs bereit zum Verstauen.
Auch das langlebigste Produkt zeigt irgendwann erste Ausfallerscheinungen: Nach ca. 250 Nächten (und entsprechend häufigem In-den-Packsack-Stopfen) lösten sich die ersten Nähte im Fußbereich des Innenfutters, was zu einem allmählichen Verrutschen der langsam verklumpenden Daune führte. Federn ließ der Schlafsack jedoch nur sehr wenige. Gegen Ende der Reise, nach immerhin 700 Nächten im Gebrauch, waren die meisten Innennähte im Fußbereich schließlich locker und die Daunen an den Rand verrutscht. Besonders im Brust- und Kapuzenbereich isolierten die Schlafsäcke kaum noch, für Nächte rund um den Gefrierpunkt war es jedoch immer noch ausreichend. Nahtöffnungen, Risse oder Löcher waren zu keinem Zeitpunkt zu beobachten. Im Laufe der Jahre waren die Daunen durch Schweiß und Schmutz zu größeren Ballen verklebt und ließen sich auch durch eine Reinigung nicht mehr retten. Das ist den Schlafsäcken selbst nicht anzukreiden, sondern mangelnden Pflegemaßnahmen. Unter diesem Aspekt hat uns die Langlebigkeit und anhaltende Isolationsfähigkeit wirklich beeindruckt!
Fazit
Der Fusion Dry 1300 ist als relativ schwerer, robuster Daunenschlafsack für extreme Bedingungen konzipiert. Auch wenn wir eher selten in die subpolare bzw. Hochgebirgs-Klimazone vorstießen, war uns die Gewissheit, unter allen Umständen warm und trocken schlafen zu können, eine besondere Freude. Hier gaben sich unsere Daunenburgen keinerlei Blöße! Auch unter sommerlich warmen Bedingungen konnten wir die Schlafsäcke als luftige Decken problemlos einsetzen – zu warm geht gar nicht. Nach über 700 Nächten unter teils extrem kalten, mal staubigen, mal tropischen Bedingungen haben wir sie liebgewonnen – und können uns nur schwer trennen.
Reisebericht Heimkehr
Heimkehr
18. April – 05. Juni 2019 | 2.140 km, 11.920 hm
Noch in Marokko galten wir als reiche Deutsche, zurück in Spanien gehören wir wieder den Landstreichern, den Streunenden an. Denn inzwischen sind die Schuhe löchrig, die Hosen abgetragen, der Muff feuchter Zeltnächte klebt an uns und der Ausrüstung. Auf den ersten Blick sind wir schon längst nicht mehr Arzt und Politikwissenschaftlerin. Kein Spanier spricht uns an, dafür Algerier und Libanesen, ein Mauretanier lädt zu sich nach Hause ein. Wir schämen uns in Szenecafés, wirken deplatziert in jenem Milieu, in dem wir uns zuhause so selbstverständlich bewegten. Eine kostbare Erfahrung, die durchaus erdet, fühlten wir uns doch stets heimisch in „der Mitte der Gesellschaft“, hier und jetzt aber als gesellschaftliche Außenseiter. Trotz knappem Budget geben wir heute Obdachlosen mehr denn je, auch weil wir um das Privileg wissen, anders als sie zwischen den Lebenswelten wandeln, aus jeder Vorteile schlagen zu dürfen.
Anstrengender als gedacht erweist sich die Heimfahrt über Frankreich und die Schweiz. Es regnet, es gegenwindet. Kein Höhenflug, kein Rausch will sich einstellen, der uns nach Hause trägt. Landschaftlich reizvolle Bergrouten versinken in einer schwarzblauen Wolkenfront – oder im Schnee. Damit steht die Routenwahl fest und das Navi bekommt die klare Ansage: „Asphalt! Nebenstraßen! Flach!“ Knapp 32.000 km lang haben wir keinen Pass gescheut, die Räder über sandige Pisten in 5.000 m Höhe geschoben und durch Regenwälder gehievt. Das Flussradeln erlaubt nun stumpfes Kurbeln, damit der Kopf den Körper nicht mehr zu Höchstleistung anfeuern muss, sondern nur noch Gedanken und Gedankenlosigkeit atmet.
Ankunft in Frankreich, die erste Bäckerin sitzt gebannt vor der Flimmerkiste, Präsident Macron hält seine Rede an die Nation. Der sei aber nur für die Reichen da, sie wähle Marine Le Pen und ihre rechte Partei, denn es lebten zu viele Muslime im Land, wenn auch nicht in ihrem Dorf. „Würde sich denn Ihr Leben verbessern, wenn es weniger Muslime gäbe?“ „Ja doch, meine Kinder würden in einem Land ohne verschleierte Frauen aufwachsen.“ Sagt’s, und schenkt uns Ausländern eine ganze Tüte Gebäck.
„Großzügigkeit ist an keiner Ideologie festzumachen, an keinem sozialen Status, keiner Religion“, schreibt Andreas Altmann, der weltenbeste Reisereporter. Muslime haben uns wie Könige empfangen, Muslime haben uns geschröpft, Trump-Wähler mästeten uns, Trump-Wähler hupten uns von der Straße. Ob Junge, Alte, Hipster, Spießer, Dicke, Dünne, Schwarze, Weiße – „Generosität ist eine geheimnisvolle Eigenschaft, sie folgt keiner Regel, kein äußeres Anzeichen eines Menschen lässt auf sie schließen, kein Vorurteil hat mir je recht gegeben. Auch unter Hippies und Punks tummeln sich Geizkrägen, auch unter feinen Pinkeln und Lackaffen verkehren Gemüter, die mit Leichtigkeit loslassen.“
Nie zuvor waren wir so hilfsbedürftig wie auf dieser Reise, so abhängig vom Goodwill fremder Menschen. Essen, Zeltplatz, Wasser – nicht einmal die Grundbedürfnisse hätten wir ohne freimütige Einheimische vielerorts stillen können. Die Angst, dass diese Erkenntnis verblasst, ist groß. Wir können uns nur die Fotos der Gebenden an die Wände hängen, ins Gedächtnis tackern, hämmern, meißeln, schweißen, um uns immer wieder vor Augen zu halten, wie Gastfreundschaft geht und vor allem: wie gut sie tut. Wir begannen die Reise mit wenigen Vorbildern – und kehren mit dutzenden zurück.
Dabei erleichterten uns nicht nur geschenkte Kaltgetränke, Obstkörbe, Dollarscheine und all die angebotenen Gästebetten das Radlerleben. Niemals hätten wir gedacht, wie viel beschwingter man reist, wie viel optimistischer man lebt, trifft man auch nur einmal am Tag auf eine nicht alltagszerknitterte Seele, die ein herzliches „Hallo!“ zuruft. Sich erkundigt, ob sie helfen könne. Wie sehr ein Daumen hoch, ein fröhliches Winken auch über schwerste Etappen tragen kann, unvorstellbar! Ich habe Angst, wieder im Meer der Sorgengesichter zu verschwinden und zwinge in Europa auch die muffligste Verkäuferin in einen Plausch, bis ich ihr ein „Gute Weiterreise“ entlocke.
Auffallend viele E-Bikes düsen uns auf brettebener Strecke entgegen. Darauf jedoch keine Schwangeren, Gebrechlichen und Langstreckenpendler, sondern junges Gemüse im Aktivurlaub. Zwanzigjährige führen ihre Hunde auf dem Segway Gassi. Als würde das Lithium der Batterien auf Bäumen wachsen und nicht in knochentrockenen Wüsten abgebaut, wo es die Wasserknappheit der Bewohner noch weiter verschärft (für die Herstellung von einer Tonne Lithiumsalz werden zwei Millionen Liter Wasser benötigt). Nach den vielen Unterhaltungen mit betroffenen Bauern in Bolivien und Argentinien würde uns ein E-Motor unterm Hintern fürchterlich ins Gewissen beißen. Wir radeln nun durch die reichsten Länder der Welt und merken, wie uns der hiesige Kaufzwang inzwischen abstößt. In einer Hyperkonsumwelt, in der uns Tech-Firmen zu grenzenloser Bequemlichkeit verführen, uns selbst im „Aktiv“urlaub, im „Smart“-Home zu infantilen, pflegebedürftigen Konsumschafen degradieren wollen, müssen wir uns entweder immer wieder die Frage stellen: Brauche ich das wirklich? Oder bräsig, bequem, fremdgesteuert – und immer auf Kosten anderer – Quatsch im Überfluss anhäufen.
Mehr denn je empfinden wir Besitz als Last, als Verpflichtung und Zeitverschwendung, denn er will verdient, gewartet, geputzt und gezeigt werden. „Eine schöne Entreicherung habt ihr da durchgemacht!“, bemerkt eine Passantin. Zwei Jahre und einen Monat lebten wir aus fünf Radtaschen, kochten auf einem Benzinkocher, teilten uns ein Handy und das einzige Messer. „Ihr habt ja nicht nur euer ganzes Erspartes ausgegeben, ihr habt in dieser Zeit auch nichts verdient“, sorgt man sich. Wir haben das Geld also gleich doppelt verprasst – und fühlen uns doch reicher denn je.
Keine Inflation, kein Börsencrash, kein Jobverlust, Hausbrand, Diebstahl, kein Einbruch kann uns die Erinnerungen und Erkenntnisse rauben, die wir täglich horteten. Den überquellenden Fundus an Storys, die wir uns noch in sechzig Jahren erzählen werden. Nie zuvor haben wir intensiver gelebt, mehr gelernt, mehr gelitten, mehr genossen! Nie lagen wir zweifelnd in den Schlafsäcken und fragten uns: „Was haben wir heute eigentlich gemacht?“ Nur Wetter und Natur bestimmten unseren Alltag, kein Chef, keine Behörde, kein Auto, das abbezahlt werden will. Jeder Pedaltritt frei und selbstgewählt. Die Zeit zum Lesen, für Muße und Gedanken schien grenzenlos. Wenn wir Luxus und Reichtum definieren sollten: für uns wäre es diese Reise!
Steinreich fühlen wir uns auch wegen der herzlichen Schweizer und deutschen Freunde, die uns auf dem Weg nach Thüringen empfangen. Uns verwöhnen mit selbstgebackenem Brot und Kuchen, Grillabenden, minutiös geplanten Drei-Gänge-Menüs – und allen voran wundervollen, vertrauten Gesprächen.
Unsere Schweizer Reisefreunde Marcel und Fiona.
Die Luzerner Weltradler Roger und Julia (Mitte) inspirierten uns zu dieser Reise.
Pia, Angelika und Norbert luden uns schon in Kanada zu sich nach Biberach ein.
Wiedersehen mit den Langzeitradlern Ralph und Imke in Schwaben.
Mit Traudl und Lothar wanderten wir 2013 in Nepal.
Fotografiefreunde Axel und Heike aus Nürnberg: jeden Abend ein Fest!
Nach 750 Tagen erreichen wir die Grenze zu Deutschland. Nie hätte ich geglaubt, dass mich der Anblick einer Flagge zum Weinen bringen könnte. Tagelang stiere ich auf die Kennzeichen vorbeifahrender Autos, sauge alle Schrift der Straßenwerbung auf, um mich immer wieder zu versichern, dass wir wirklich zurück sind. So sehr wir das Reisen lieben, so sehr vermissen wir unsere Familien, unsere Freunde. So körperlich und seelisch leidvoll war manche Etappe. Auch platzt der Kopf von Eindrücken, wir spüren immer mehr, wie sehr wir uns nach Privatsphäre und einem eigenen Badezimmer sehnen. Öfter schlagen wir Übernachtungseinladungen von Fremden aus, die wir zu Beginn so selbstverständlich angenommen hatten. „Wenn die Neugier nachlässt, geht es zurück“ – wir halten an unserem Credo fest. Es ist der richtige Zeitpunkt, heimzukehren.
„Habt ihr unterwegs denn keine Angst?“, so die vielleicht meist gestellte Frage. Nein, eher Respekt vor dem Unbekannten. Viel mehr Sorge bereitet mir nun vor allem eines: dass das Intensive aus dem Leben schwindet, dass die Fahrwässer des Alltags zwar ein angenehmes, vielleicht auch beständigeres Leben ermöglichen, aber große Freuden, große Dankbarkeit, große Ungewissheit, großes Erstaunen, Überraschungen verunmöglichen. Die Tage dahinplätschern. Und wir wieder anfangen, uns über Nichtigkeiten aufzuregen. Dass sich der Horizont wieder auf das eigene Dasein, die eigenen Sorgen beschränkt, anstatt die Geschichten und Lebenswelten anderer aufzusaugen. Nichts ist für uns langweiliger, beschränkender, als sich immerfort nur um sich selbst zu drehen.
Wir danken all den Freunden und Verwandten, die sich die Zeit für längere Emails oder gar Telefonate nahmen. Jede Zeile ein enormer Energieschub und Gesprächsfutter für uns, die wir täglich 24 Stunden miteinander verbrachten. Wir danken unseren Eltern, die uns immer begleiteten und letztlich Verständnis dafür entwickelten, dass ihre Kinder nun einmal zwischen den „Realitäten“ wandeln. Unseren Schutzengeln, dass wir und all die Daheimgebliebenen gesund und munter blieben. Und schließlich all jenen, die uns unterwegs einen Einblick in ihre Lebenswelt geschenkt, zum Denken und Umdenken, Lachen, Weinen, Kopfschütteln und Staunen gebracht haben. Mit einem neuen Urvertrauen erreichen wir Thüringen: Egal wo auf dieser Welt – es gibt immer jemanden, der hilft.
Reisebericht Marokko
Marokko
23. Februar – 17. April 2019 | 2.340 km, 25.390 hm
Umgeben von einer Bakterienwolke betrete ich erstmals seit zwei Jahren Europa. Ich bin erkältet, meine Aura könnte besser sein – was hoffentlich den sozialen Klimawandel erklärt, der uns in Spanien entgegenschlägt. Kaum einer grüßt, kaum einer spricht uns an, hier und dar gar pampige Ungeduld, wenn mein bemühtes Spanisch auf Montagmorgengesichter trifft.
Von Madrid aus fahren wir gen Süden Richtung Andalusien. Winterkahle Agrarwüsten weichen bunten Blumenwiesen und hügeligen Olivenhainen, soweit das Auge reicht. Jedes Dörfchen eine Perle, in den Straßen fegen, scheuern Einheimische sogar mit Eimer und Lappen die Gehwege. Spanien scheint alle Eleganz und Schönheit für sich gepachtet zu haben.
Ich sitze auf einer Caféterrasse in Granada, vor mir das leckerste Glas Weißwein, die köstlichsten Oliven, stilvoll gekleidete Menschen rauchen, wiegen sich galant im Takt der Musik. „Den Spaniern geht es nicht gut“, hatte mir kurz zuvor ein Journalist erklärt. So sehr ich es versuche, ich kann ihn nicht verstehen.
Mit der Fähre setzen wir nach Marokko über – und fühlen uns, es klingt verrückt, sofort heimelig. Die Menschen winken, rufen „Bienvenue!“, „Salam alaikum!“, überall ein Daumen hoch, Autos hupen uns willkommen, Abgase vernebeln die Sinne. Es ist fast so, als kämen wir nach zwei Jahren wieder an. In Iran, in Zentralasien, zurückgebeamt an den Beginn der Reise. Ein junger Autowäscher spendiert Trinkwasser und fragt nach unserer Herkunft. „Allemagne.“ Seine erste Reaktion: „Angela Merkel! Sie ist stärker als vier Männer zusammen!“
Ab jetzt hilft das aufgefrischte Schulfranzösisch, neben Arabisch die zweite Amtssprache des Landes. Schnell wird das Hals- zum Kopftuch umfunktioniert, lange, luftige Kleidung gekauft, im sunnitisch-muslimischen Marokko zwar keine Pflicht, aber besonders auf dem Land angebracht. Mohammed VI. gilt als „König der Armen“, investierte in Ausbildung und neue Jobs, stellte Mann und Frau in der Verfassung gleich. Allerdings liegt Marokko nur auf Platz 123 im Human Development Index der UN, rangiert damit mit Blick auf Bildung, Lebenserwartung und Einkommen zwischen Bolivien und Indien. Welten entfernt vom fünften Platz – vom deutschen Wohlstand.
In der „Blauen Stadt“ Chefchouen kommen wir mit dem 17-jährigen Badis ins Gespräch. Er will Mathe und Physik studieren. Ob er täglich in die Moschee gehe? „Nein, ich lese viel Philosophie und bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt an Gott glaube.“ Badis’ Eltern besuchten nie eine Schule, erwirtschaften in einem zugigen Imbiss das bisschen Geld für das tägliche Leben. Ein Auto haben sie nicht, kein Motorrad, kein Fahrrad, stattdessen schauen sie, dass alle vier Kinder studieren. Aber das sei in Marokko nicht viel wert, meint Badis desillusioniert: „Hier studiert man nicht für einen Job”, sondern „nur aus Interesse am Fach.“ Ein Studium bedeute noch lange keine Anstellung, und schon gar nicht im Fachgebiet. Der Bruder, eigentlich Physiker, arbeitet als Hotelpage in Marrakesch. Die Schwester studiert Soziologie, „wird aber wahrscheinlich einfach heiraten und zuhause sein.“ Seinen Eltern verschweigt er den Wunsch, mittels Schleppern und Schlauchboot nach Europa zu gelangen. „Sie würden niemals wollen, dass ich mein Leben riskiere.“ Laut UNHCR starben 2018 mindestens 2.275 Menschen im Mittelmeer, durchschnittlich sechs Menschen am Tag.
Wie er seine Zukunft sehe, fragen wir den Siebzehnjährigen, und Badis Antwort spricht Bände: „Maybe nothing.“
Ein Drittel der jungen Marokkaner ist arbeitslos – und das in einem Land, in dem das Durchschnittsalter 28 Jahre beträgt. Alle, mit denen wir sprechen, würden lieber in Marokko leben als in der EU, aber es fehlt schlicht an soliden Jobs, 40 Prozent der Einwohner buckeln noch immer in der Landwirtschaft.
Nach den Gastarbeitern im Ausland sind Touristen die zweitwichtigsten Devisenbringer. „For security“ heftet sich die Polizei daher an unsere Fersen. Tagelang tuckern Hilfssherifs in ihren Blechkisten hinter uns her, warten geduldig, bis wir zu Mittag gegessen und ausgedehnte Kaffeepausen beendet haben. Hastig schlagen wir uns abends ins Gebüsch, um die Verfolger abzuwimmeln und in Ruhe zu zelten. Häufig erfolglos. Dennoch weigern wir uns, die Cops in ein Hotel zu begleiten. Mehrfach bleibt der Staatsgewalt nichts anderes übrig, als Nachtwache am Zelt zu schieben …
Wir sind im Rif-Gebirge unterwegs, der größten Cannabis-Plantage der Welt: 3.000 Tonnen Gras bringen jährlich 20 Milliarden Euro Umsatz und sichern einer Million Menschen im sonst armen Norden des Landes ein beschauliches Einkommen. „Da könnte man schon mal auf euch schießen, wenn ihr auf dem falschen Feld landet“, warnt ein Einheimischer. Und tatsächlich: Während eines morgendlichen Fotospaziergangs muss ich falsch abgebogen sein, anders ist der machetenfuchtelnde Bauer nicht zu erklären. Denn der Anbau wird von der (korrupten) Polizei zwar toleriert, ist aber nach wie vor illegal.
Eine Schäferfamilie winkt uns heran, ob wir bei ihnen übernachten wollten? Klar, schließlich verfolgt uns die Polizei. Schwiegertochter Hasma ruft mich in das kleine Gehöft mit Ziegenstall nebst Schlafzimmer, zeigt mir eifrig den Brotofen, Hochzeitsfotos, dann Küche und Kühlschrank. Daniel darf ihr weder die Hand reichen noch sie fotografieren. „Islam“, begründet die 22-jährige forsch. Und fordert mich nach dem Duschen auf, mein Kopftuch aufzusetzen.
Ihr Schwager Chafer hält es hingegen nicht ganz so streng mit dem Koran, fragt verschmitzt, ob wir auch kifften und Alkohol trinken würden? „Aber du bist doch gläubiger Muslim?“ Er zwinkert: „Allah ist gut, aber Whiskey ist auch gut!“ Alkohol ist in Marokko offiziell verboten, doch gäbe es Bars und Supermärkte für Touristen, in der sich auch die Einheimischen versorgten. Chafer schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, studiert nicht, weil er das Geld auch für die verwitwete Mutter erarbeiten muss. Witwenrente gibt es keine.
Wir erreichen die Altstadt von Fés, ein Weltkulturerbe und unübersichtliches Gewirr aus hunderten Sackgassen und Treppen. Händler transportieren Waren auf Eseln, bieten Gewürze und Teppiche feil, frittiertes Süßkram, Kamelfleisch und Hammelköpfe. Der Duft von Haschisch und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. „Wow, it’s like a fairytale!“, „Wie im Märchen!“, staunt ein amerikanischer Tourist.
Doch nur wenige Meter abseits der aufgehübschten Vorzeigegassen kriecht bleierner Verwesungsgeruch in jede Pore. Junge Männer stehen bis zur Hüfte in Gerbereibottichen, walken Ziegenfelle in Taubenkot und Rinderurin wie vor 800 Jahren. Leprakranke betteln um Almosen, Alte bieten stumm im Staub sitzend ein paar Kräuter und Erbsen an, Obdachlose wühlen im Müll. Regen verwandelt die Gassen in Schlammlöcher, spült allen Unrat in den nächsten Fluss. Die Altstädte Marokkos sind keine Träume aus 1001 Nacht, sondern Viertel der Armen. Die Mittelschicht ist längst in die Außenbezirke gezogen.
Mittendrin im Gewimmel Cafébesitzer Driss, dreißig, frisch verheiratet. Seine Schwester schaut vorbei, wild geschminkt, mit goldenem Blingblingkettchen, die Haare eine braune Mähne mit blonden Strähnen. Sie lacht laut, feixt und ich muss an Hasma denken, die nur eine Tagesetappe – und doch Welten – entfernt auf dem Land lebt. Driss’ Frau ist 24, Laborantin im Krankenhaus. Kinder wollten sie höchstens zwei und liegen damit im landesweiten Trend. „Für mich war es wichtig, dass meine Verlobte noch Jungfrau war.“ Warum? Er tut sich schwer, es zu beschreiben. „Ich wollte immer eine ehrliche, ruhige Frau“, fügt jedoch hinzu, dass 50, 60 Prozent der heutigen Verlobten Erfahrung im Bett hätten. Seine Frau trage kein Kopftuch, denn „wir sind Muslime im Herzen und nicht dadurch, dass wir Kopftuch oder lange Bärte tragen.“
Wir verlassen Fés gen Süden auf asphaltierten, fast einsamen Nebenstraßen. Nach dem regenreichen Winter leuchtet die Landschaft in sattem Grün, Kirschen, Mohn und Ginster blühen um die Wette. Allmählich gewinnen wir an Höhe, vor uns türmt sich das über 4.000 m hohe Atlasmassiv. Die Gebirgskette reicht von Tunesien über Algerien bis an die marokkanische Atlantikküste und teilt des Land in zwei klimatische Extreme: mediterran und feucht im Norden, kontinental und trocken im Süden.
Die Frauen versammeln sich derweil im Haus: gestampfte Lehmböden, winzige Fenster, gekocht wird über offenem Feuer, es gibt Couscous eingeweicht in Milch mit geschmolzener Butter. Einer der Männer spricht Französisch: im Schnitt habe jede Frau im Dorf sechs, sieben Kinder, denn Rente gäbe es keine. Ich frage ihn nach all den Sozialprogrammen, die der König angeblich angestoßen habe. „Die existieren nur auf dem Papier. En réalité: rien!“ In Wahrheit: nichts. Die Krankenhäuser seien zwar gebaut, aber nur „décor“, es fehle an Geräten, an Medizin, an Ärzten. Wer eine teure OP bräuchte, würde Familie, Nachbarn und Moscheegemeinde um Hilfe bitten. „Aber wo ist denn das ganze Geld aus den Sozialtöpfen?“ „Wir haben viele korrupte Diebe im Land. Wer überleben will, muss arbeiten. Wer besser leben will, muss stehlen.“ Marokko liegt auf Platz 73 von 180 Ländern im Korruptionsindex von Transparency International, zwischen Senegal und Burkina Faso.
Tiefe Gewitterwolken und patagonische Gegenwinde künden von einer mehrwöchigen Schlechtwetterperiode. Die Temperaturen dümpeln im unteren einstelligen Bereich, nachts fällt Schnee und tagsüber eisiger Regen. Wir flüchten aus den Bergen und wollen in Sefrou überwintern. In der verwinkelten Medina klappert Karima mit uns ein geschlossenes Hotel nach dem anderen ab, bis wir endlich fündig werden. Rezeptionist und Besitzer säßen jedoch gerade vier beziehungsweise 24 Monate im Gefängnis, die beiden hätten wiederholt Pärchen ohne Eheurkunde in einem Zimmer schlafen lassen – in Marokko sei das rechtswidrig, nur bei Touristen gelten Ausnahmen.
Karima selbst ist 38 und hat islamisches Recht, die Scharia, studiert. Homosexualität lehnt sie ab, deshalb achtet sie darauf, dass ihr Sohn separat von den Mädchen spielt, das „Frauliche“ soll nicht auf ihn abfärben. „Findest du es nicht ungerecht, dass Frauen vor der Ehe keinen Sex haben dürfen, Männer dagegen schon?“, frage ich weiter. „Nein, nein“, winkt sie ab. Männer nähmen sich von Natur aus, was sie wollten, seien egoistisch, Frauen dagegen sensibel. „Der Koran beschützt die Frau.“ Dennoch kritisiert sie harsch die chauvinistische Haltung und Respektlosigkeit gegenüber ihresgleichen. „Wenn eine Marokkanerin in der Ehe leidet, schweigt sie. Andernfalls verliert sie den Mann als Geldgeber und ihr gesellschaftliche Anerkennung. Lässt sich der Mann scheiden, wird häufig der Frau die Schuld zugeschoben.“ Die Frau lande dann meist auf der Straße oder in einem der sozial geächteten Frauenhäuser.
Karima sorgt sich um ihr 14-jähriges, körperlich behindertes Mädchen. „Kein Mann wird meine Tochter je heiraten wollen, und in Marokko finden noch nicht einmal gesunde Frauen Arbeit.“ Deshalb bäckt sie für Hochzeiten, erzählt ihrem Mann jedoch nichts von dem Verdienst. „Er würde mir sonst das Haushaltsgeld streichen.“ Klammheimlich legt sie das Geld zurück, „nur für meine Töchter, mein Sohn hat ganz andere Chancen in dieser Gesellschaft.“
Weiterhin bleibt das Wetter übellaunig, doch erneut erweist sich das Rad als Mitleidsgenerator und Menschenfänger. Kellner Lahsne sieht uns zittern und lädt uns ein, die Nacht bei seiner Familie zu verbringen. Seine Tochter Manal empfängt uns mit einem Festmahl, unter vier Augen spricht sie persönlichere Dinge an. Noch nie habe die 18-jährige geküsst. Der Vater erlaube ihr nicht einmal, mit einem Jungen allein zur Schule zu gehen. Am Ortsrand gäbe es ein Wäldchen, wo sich die Liebespaare heimlich träfen. Einmal sei ihre Freundin aufgeflogen und es habe zuhause Prügel gesetzt. Die Jungen dagegen könnten machen, was sie wollten. „I hate the society a little“, flüstert Manal. Sie hasse diese Gesellschaft „ein bisschen“.
Marokko fordert, fesselt, packt und ergreift. Wir bleiben länger, als geplant. Halten öfter unterwegs inne, kapseln uns häufiger in Hotels ab, auch um die Wucht zu verdauen, mit der Chauvismus, Armut und Perspektivlosigkeit unterwegs immer wieder auf uns prallen. Gleichzeitig erinnern uns die vielen herzlichen Einladungen und überschwänglichen Willkommensgrüße noch einmal eindrücklich daran, sich in Deutschland nicht wieder hinter einem Montagmorgengesicht zu verschanzen – sondern offen zu bleiben, auf Unbekannte mit Neugier zuzugehen und sich täglich vor Augen zu halten, wie gut es uns geht!
Reisebericht Island
Island
12. Juli – 28. Juli 2014
Ich weiß nicht, ob mich damals ein Troll verzaubert hat – seit der letzten Islandreise 2012 verging kaum ein Tag, an dem ich nicht an diese naturgewaltige Insel gedacht habe. Eine Rückkehr stand außer Frage. Und so verbringen wir, armer Daniel, das Ende dieser Reise im kalten, eher regnerischen Norden anstelle eines karibischen Inselidylls. Entspannt wollen wir Island im Mietwagen umrunden, zelten dürfen wir hier überall. Und dass die Sonne erst um 23 Uhr unter und schon drei Stunden später wieder aufgeht, spielt uns prima in die Hände.
Eine „Nature Fee“ ist seit diesem Jahr an einigen Spots nahe des Mývatnim Norden zu entrichten – es braucht neue, trittsichere Pfade für derart viele Touristen. 300.000 Einwohner zählt das Land, mehr als doppelt so viele Besucher „überrollen“ die Insel während der Sommermonate. Nach der Finanzkrise liegen die Preise nach wie vor um rund 50 % tiefer als vor 2008. Heute kostet ein einfaches Doppelzimmer „nur noch“ zwischen 100 und 150 € pro Nacht, ein günstigeres Essen im Restaurant 20-30 €, die Flasche Brennspiritus für den Kocher 15 €.
Island zählt zu den geologisch aktivsten Zonen der Erde; die eurasische und amerikanische Kontinentalplatte driften hier am mittelatlantischen Rücken auseinander. Noch heute dampft das Lavafeld Leirhnjúkur bedrohlich nach einem Vulkanausbruch in den 1980er Jahren. Nach wie vor ziehen sich Wanderer heikle Verbrennungen zu, heben sie den falschen Stein auf oder verlassen sie die vorgegeben Wege.
Die Nähe zur Arktis und damit verbunden der niedrige Sonnenstand ermöglichten die Bildung riesiger Gletscher, der Vatnajökull etwa ist Drittgrößter weltweit. Gewaltige Wasserfälle, durch unzählige Gletscherflüsse gespeist, entstehen – so auch der Dettifoss, Europas wasserreichster Wasserfall.
Drei Stunden harrt Daniel auf einem Felsen des Borgarfjördur aus, um „das perfekte“ Foto (…) eines Papageitauchers zu schießen. Die Vögel erinnern mit ihrem plumpen, aufrechten Gang an Pinguine, nur können sie fliegen und mithilfe von Dornen im Schnabel mehrere Fische gleichzeitig transportieren.
Leider rafft die Meereserwärmung ihre Nahrung dahin, die „Clowns der Lüfte“ sind vom Aussterben bedroht. In isländischen Pfannen landen sie trotzdem. Wir treffen gar auf Touristen, die es als „Urlaubs-Muss“ ansehen, Papageitaucher zu kosten …
Wir lassen unsere Reise in Islands sozialem Austauschforum ausklingen – im Hot Pool. Nicht Café oder Pub werden hier zum Quatschen angesteuert, sondern das örtliche Schwimmbad. Leider wurde das Foto von mir im Eiswasserbad unwiederbringlich gelöscht. Was mit unseren Erinnerungen und Erlebnissen glücklicherweise nicht so einfach passieren kann. Besonders genossen wir die vier Monate unabhängigen Reisens mit Zelt und Wagen in Ozeanien, Chile und Island. Nepal hat uns die tatsächlichen Grenzen unserer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit gezeigt. Auch unsere Familien waren wohl ständigen nervlichen Anspannungen ausgesetzt – vielen vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung! Den Emailschreibern und Daumendrückern ebenso ein herzliches Dankeschön – mithilfe eurer lieben Worte und Grüße fühlten wir uns selbst im vermeintlich letzten Winkel der Welt wie zu Hause. Weiterhin freuen wir uns riesig über die tollen Bekanntschaften dieser Reise – und vor allem auf das Wiedersehen in Deutschland und der Schweiz!
Reisebericht Peru & New York
Peru & New York
26. Juni – 11. Juli 2014
Machu Picchu – ja oder nein? Abende lang diskutieren wir Für und Wider, sprechen doch Kosten, Besuchermassen und schlicht Zeitdruck gegen einen Besuch des neuen Weltwunders. Schließlich gehen wir die „Operation MP“ gemeinsam mit einem sympathischen Pärchen aus Stuttgart an.
Die Inkastätte zählt in der Hauptsaison etwa 3.000 Besucher täglich, angeblich senkte sich der Berg bereits um einige Zentimeter. Von den etwa 100.000 Dollar Tagesumsatz scheint aber nur wenig in die umliegende Infrastruktur zu fließen. So fahren wir stundenlang am Rande schwindelerregender Abhänge auf staubigen Pisten, die kaum breiter als unser Bus sind, folgen zu Fuß einigen Kilometern rostiger Gleise und starten schließlich vom Bergdorf Aquas Calientes aus den „Gipfelsturm“ um 4:30 Uhr früh. Die Alternative wären Zugtickets für schlappe 140 Dollar pro Person … In Anbetracht der touristischen Vermarktung dieses Welterbes ist die verkehrstechnische Anbindung schlicht ein Witz.
Neben der Landwirtschaft trieben die Inka hier vor allem astrologische Studien voran. Während der Invasion der spanischen Conquistadores kappten sie alle Zugangswege. Die Stadt, wunderschön auf einem Hochplateau inmitten eines Nebelwaldes gelegen, geriet bis ins 20. Jahrhundert in Vergessenheit. Wir sind beeindruckt und bereuen den Besuch nicht.
Leider bleibt wenig Zeit für das abwechslungsreiche Peru, hetzen wollen wir jedoch auch nicht und so entscheiden wir uns für eine ausgiebige Wanderung durch die Cordillera Blanca. Diese bildet gemeinsam mit den benachbarten Cordilleras Huayhuash die zweithöchste Gebirgskette weltweit. Da unsere guten Rucksäcke nun chilenischen Dieben zu ausgedehnten Trekkingtouren verhelfen, brauchen wir starke Unterstützung. Drei Esel schleppen unser Gepäck – schon ein komisches, wenn auch erleichterndes Gefühl.
Nach fünf Tagen erreichen wir den Höhepunkt der Wanderung, die Laguna 69 auf circa 4.600 m Höhe. Doch regnet es für die Trockenzeit des Jahres ungewöhnlich oft. Unser schöner Plan, zur Lagune noch vor dem Morgengrauen aufzusteigen, wird von gefrierendem Regen jäh durchkreuzt, der Zelt und Pfade mit einer dünnen Eisschicht überzieht. Einen fantastischen Sonnenaufgang genießen wir trotzdem – mit Blick auf den Huascarán, höchster Berg Perus (6.768 m).
Zurück in der Zivilisation lädt uns Epi zum peruanischen Mittagessen mit seiner Familie ein. Entspannt spiele ich mit seiner fünfjährigen Tochter – bis aufgetischt wird. Auf Daniels Teller befindet sich ein frittiertes Meerschwein. Mitsamt Kopf, Nagezähnen und Skelett. In Peru eine kostspielige Delikatesse für besondere Anlässe …
Leider vergeht die Zeit in Peru viel zu schnell, wir ärgern uns, die Flugtickets Richtung New York schon ein halbes Jahr im Voraus gebucht zu haben. Mit dem Versprechen an Epi, in ein paar Jahren erneut auf ein Meerschweinchen vorbeizukommen, verlassen wir Huaraz. Die Ankunft auf dem New Yorker JFK-Flughafen gleicht einer Mondlandung, mehr Kontrastprogramm geht nicht. Auf dem Weg nach Island dient die Metropole als Stop over, den wir allerdings auf vier Tage ausdehnen. Sehnsüchtig warten wir am Gepäckband auf Daniels Packsack. Vergebens. Kleidung, Stativ, Ladegeräte, Zelt, Kocher und Schlafsack wurden irgendwie verschusselt und sind weg …!
Wir ahnen den später folgenden Gepäckstress und fahren erst einmal zu unserer Air-B’n’B-Familie nach Queens. Air B’n’B ist vergleichbar mit Couchsurfing, nur zahlt man hier für sein Zimmer, was aber in Anbetracht der New Yorker Hotelpreise Pfennigbeträgen gleicht. Ein echtes Zuhause für uns, in direkter Nachbarschaft zu Manhattan.
Am Broadway machen wir dem angestauten Gepäckfrust beim Powershopping Luft. Daniel plagt sich mehrere Stunden täglich am geborgten Telefon (sein Handy steckt ja im Packsack). Immer wieder versichert die Airline, das Gepäck käme am folgenden Tag in New York an, doch der Weg von der Abstellkammer zum Flieger scheint lang und mühsam. Island ohne Campingausrüstung – unvorstellbar …
Das WM-Finale schauen wir klassisch in einem Pub, bei 9 Dollar pro Bier verkneifen wir uns allerdings den Absturz. Schon nach dem Spiel gegen Brasilien gaben uns die Peruaner herzliche Glückwünsche mit auf den Weg. „You are the best!“ rufen uns nun die Amis zu, einer spendiert sogar die Pizza zum WM-Sieg. Auch die Airline regt sich endlich: eine Flughafenmitarbeiterin klappert alle Möglichkeiten ab und findet den Rucksack zerschlissen in der New Yorker Cargo-Abteilung. Kurz vor dem Check-In nach Island nehmen wir das gute Stück überglücklich in Empfang.
Reisebericht Bolivien
Bolivien
03. Juni – 26. Juni 2014
Von San Pedro aus überqueren wir via Jeeptour die bolivianische Grenze und sind froh, einmal nicht selbst fahren zu müssen, aber bekocht zu werden und in einem echten Salzhotel zu schlafen. Ich genieße die Gespräche mit anderen (Leipziger) Touristen, blieb uns doch in den vergangenen Monaten mit Zelt und Mietwagen zumeist „nur“ Zweisamkeit. Fast geraten da die farbenfrohen Lagunen des Altiplanos in den Hintergrund.
Über 10.000 Quadratkilometer misst der Salar, ein abflussloses Becken auf etwa 3.600 m Höhe. Wir bitten den Fahrer uns auszusetzen und ein großer Traum wird plötzlich Realität: ganz alleine zelten wir in diesem weißen Nirgendwo. Wir vereinbaren eine gedachte Linie zwischen zwei Bergrücken, die am Horizont kaum auszumachen sind – hier soll uns Alberto am nächsten Morgen wiederfinden. Dann wird es still … wir bleiben zurück, ganz allein auf dieser riesigen Fläche weißer Ödnis und es gibt nichts, an dem sich der Wind brechen könnte. Nur das Blut rauscht in unseren Ohren. Und als es dunkel wird, habe ich vollends das Gefühl, auf einem fremden Planeten zu stehen und in die Unendlichkeit des Universums zu blicken. Der stillste Ort der Reise?
Dennoch sind wir ziemlich erleichtert, als uns der Fahrer am nächsten Morgen auch ohne GPS wiederfindet … Gerade rechtzeitig verlassen wir die Stadt Uyuni, bevor Blockaden und Streiks – für Bolivien typisch – den gesamten Busverkehr lahm legen. Wir gönnen uns ein paar Tage Auszeit im schönen Sucre. Zelt, Kocher und Kleidung benötigen eine Generalreinigung. Wir auch. Und beim Kauf erster Souvenirs wird unsere Rückkehr Ende Juli plötzlich erschreckend greifbar.
Wir reisen weiter nach Cochabamba, in einem Bus, der scheinbar vom Staub der Jahre zusammengehalten wird. Viele Passagiere können weder lesen noch schreiben, es dauert eine Weile, bis ein jeder seinen Platz gefunden hat. Draußen ziehen namen- und schmucklose Siedlungen vorbei, Müllberge, Pommes-Buden. Nebenan wickelt und stillt eine Mutti ihr Kind, eine Oma transportiert ihren Hundwelpen im Plastikbeutel, irgendwann beginnt es (in den Bus) zu regnen – und uns beschleicht das unheimliche Gefühl, schon wieder in Asien zu sein …
Wir flüchten in das beschauliche Bergnest Toro Toro, gelegen im gleichnamigen Nationalpark, der vor urzeitlicher Schönheit strotzt. Die umliegende Landschaft bildete einst weites Grasland, das im Laufe der Jahrmillionen einsackte – die Abbruchkanten ragen nun ringsum in den Himmel, riesigen eingebrochenen Eisschollen gleich.
Nach dem Diebstahl in Chile und der Sperrung der VISA-Karten neigen sich unsere Bargeldvorräte dem Ende. In Santa Cruz empfangen wir zwar pünktlich Daniels Notfall-VISA, doch die Hetzerei durch sämtliche Banken bleibt erfolglos. Weder die Notfall- noch meine verbleibende EC-Karte funktionieren hier, völlig entnervt sitzen wir schließlich auf dem Trockenen. Es bleibt nur der kostspielige Transfer über Western Union. Der Dank gilt unseren Eltern, ohne deren unermüdliche Hilfe wir nicht nur in dieser Situation schlicht aufgeschmissen wären!
Mit einer knattrigen Propellermaschine fliegen wir nach Rurrenabaque, einem schwülen Urwaldstädtchen am Rande des Madidi-Nationalparks. Dieser zählt zu den weltweit artenreichsten und größten Regenwaldschutzgebieten.
Um fragwürdige Touranbieter zu meiden, quartieren wir uns für vier Tage in einer kostspieligen Ecolodge ein, tief im Amazonas-Dschungel gelegen. Die Angestellten entstammen einer kleinen Urwaldkommune, ein Teil des Geldes fließt in deren Entwicklung. Mit Machete und Gummistiefeln pirschen wir durchs Dickicht, bald tauschen Daniel und der Guide die Rollen und es bleibt kein Zuckerkäfer, Morpho-Schmetterling und Kolibri unentdeckt.
Stundenlang harren wir auf einer Plattform nahe einer Wildschwein-Suhle aus, Daniel erspäht bei einer der nächtlichen Wanderungen gar einen Ozelot. Guide William spricht die Sprache der Tiere und lockt mit wildem Grunzen, pfeifendem Zwitschern und affigem Gebrüll allerhand Dschungelbewohner an.
Kurz vor der Abfahrt nach Peru checken wir noch einmal unsere Mails. Und siehe da: meine VISA, per DHL-Kurierpost vor vier Wochen nach La Paz gesandt, ist doch tatsächlich noch in der Botschaft eingetroffen! Wieder zurück in der bolivianischen Regierungsstadt empfangen wir die Kreditkarte wirklich – jedoch mit erneuter Überraschung. Sie ist einmal quer in der Mitte geknickt, der Magnetstreifen unbrauchbar. Es ist zum Heulen… Doch zum Glück erweist sich der Chip als intakt und der bolivianische Geldautomat spuckt endlich frisches Geld aus!
Inzwischen verbindet uns mit Bolivien eine echte Hassliebe. Landschaftlich wahnsinnig kontrastreich, bewegten wir uns binnen weniger Tage zwischen Salzseen, Dschungel, zerklüfteten Felsen und schneebedeckten Andengipfeln. Doch wurden unsere Geduld und die reisemüden Nerven arg auf die Probe gestellt. Das Land wird beherrscht von Misswirtschaft, Korruption, Straßenblockaden, Fehlinformationen, Siesta, Stillstand. Im Verlauf eines einzigen Tages schwanken unsere Gefühle zwischen Begeisterung und absoluter Frustration. Nun geht’s weiter nach Peru, und so langsam rennt uns die Zeit bis zur Rückkehr nach Deutschland davon …
Reisebericht Nordchile
Nordchile
08. Mai – 02. Juni 2014
Wir verlassen Auckland am Abend des 08. Mai, überschreiten die Datumsgrenze … und erreichen Santiago de Chile am Nachmittag des selben Tages! Der Nachtbus bringt uns weiter gen Süden nach Los Angeles, wo uns Paulina und ihre Familie herzlich empfängt. Paulina lebte vor einigen Jahren als Austauschschülerin bei Daniel, getreu dem Motto „Mi casa es tu casa“ fühlen nun wir uns im fernen Chile wie zu Hause. Und als nach einigen Tagen endlich der üble Jetlag besiegt ist, setzen wir unser Nomadenleben fort.
Jahreszeitlich bedingt konzentrieren wir uns auf den trockenen Norden des 4300 km langen Landes. Um weitestgehend ungebunden zu reisen, setzen wir auch hier auf Mietwagen und Zelt – nur bedarf es für dieses Unterfangen einiger Recherche. Die Empfehlungen der Einheimischen reichen von „Kleinwagen“ bis „selbst fahren unmöglich“; von „wildcampen total safe“ bis „Überfallgefahr durch Drogenschmuggler“. Mit einem Pickup fahren wir schließlich entlang der Panamericana nach San Pedro, touristische Oase inmitten der Atacama-Wüste.
Die Atacama zieht sich über 1.200 km durch den Norden Chiles; die Anden im Osten bilden eine natürliche Barriere für die feuchte Luft des Amazonasbeckens, und der kalte Humboldtstrom an der Westküste lässt die Bildung von Regenwolken nicht zu. Es gibt Orte, an denen es seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie geregnet hat – dagegen ist selbst das Death Valley ein Feuchtgebiet. Doch über landschaftliche Langeweile können wir uns nicht beklagen!
Nahe San Pedros liegt das Valle de la Luna, benannt nach seinem mondähnlichen Erscheinungsbild. Wind und seltene Niederschläge haben das spröde Gestein im Laufe der Zeit sonderbar geformt und Canyons in das mitunter pure Salz gefräst. Wir ergattern die Genehmigung in diesem Naturreservat zu zelten, welch ein Glück! Ich jedenfalls fotografiere die halbe Nacht, denn die Atacama bietet die weltweit besten Bedingungen für Bilder des Nachthimmels.
Gleißende Sonne, salzige Winde, knochentrockene Luft und enorme Temperaturschwankungen zwischen heißen Tagen und klirrend kalten Nächten: wir kämpfen mit rissigen Händen, brennenden Augen, Nasenbluten und fühlen uns wie Dörrobst im Ofen. Dazu gesellen sich Symptome der Höhenkrankheit (Kopfschmerzen, Schlafapnoe), die wir jedoch rasch überwinden.
Nach ausreichender Akklimatisation machen wir uns auf zu den Tatio-Geysiren, dem höchsten geothermalen Feld weltweit, und zelten in der Nähe der Parkverwaltung auf 4.300 m. Nachts peitscht Schnee gegen das Zelt, die Temperaturen fallen auf eisige -15 °C, aber dank entsprechender Ausrüstung bleiben wir kuschelig warm.
Am nächsten Morgen weckt uns ein Polizist und mahnt, rasch ins Tal zurückzukehren, ein Sturmtief sei im Anmarsch. Doch ist der Dieselmotor eingefroren und auch die Starthilfe des Pförtners bleibt erfolglos. Schließlich rollen wir den Wagen in die Nähe des Geysirfeldes, wo der Motor schnell auftaut – und los geht’s! Nach etwa 10 km gewinnt der Sturm an Kraft und wird zum White out – Himmel und Erde verschmelzen zu reinem Weiß und wir verlieren völlig die Orientierung. Nun stecken wir fest, in einem Blizzard irgendwo im Nirgendwo, etwa 80 km von San Pedro entfernt, und wissen nicht, ob und wann Hilfe kommt. Ich versuche noch den Wagen mit den Händen freizugraben, aber der Wind peitscht mir Sand und Eis wie Nadelstiche ins Gesicht. Nach anfänglicher Panik und Verzweiflung beschließen wir, die Sache auszusitzen – Wasser, Nahrung und Spiritus für den Kocher sollten für ein paar Tage reichen. Einige Stunden später legt sich der Sturm etwas, die gleichen Parkangestellten passieren uns und schaufeln den Pickup schließlich frei!
Wir verabschieden uns in verschiedene Richtungen und entdecken wenig später im Straßengraben einen Bus voller Touristen, die verzweifelt versuchen, das Gefährt wieder auf die Straße zu schieben. Die Tagesausflügler haben keine Verpflegung oder Thermokleidung dabei, eine brenzlige Situation in Anbetracht der nächtlichen Temperaturen. Wir sacken die Reiseleiterin ein und erreichen die nächste Siedlung, in der sie Hilfe organisieren kann. Zurück in San Pedro tobt ein Sandsturm – wir gönnen uns ein Hotel, Restaurant und gehen feiern!
Wir wollen weiter gen Norden, kaufen noch fix Notwendiges ein – und finden den Wagen schon für uns geöffnet vor. Trotz Parkplatz mit Sicherheitspersonal haben Diebe den Pickup geknackt, glücklicherweise aber nur die Rucksäcke mit allerhand Kleidung gestohlen. Tablet, Handy und Hilleberg-Zelt waren den Einbrechern wohl nichts wert… Kamera, Kreditkarten und Pässe hatten wir zwar vorsorglich am Mann, sind uns aber nicht sicher, ob sich Kopien aller Dokumente (inklusive der Kreditkarten) in den Rucksäcken befanden. Sicherheitshalber sperren wir deshalb sämtliche Reisekonten. Es folgen Polizeiprozedere, Wagentausch und die komplizierte Organisation neuer Kreditkarten. Die werden uns hoffentlich nach Bolivien geschickt …
Wir sammeln alle unsere (Nerven)kräfte und fahren weitere 1.000 km in den Lauca-Nationalpark. Der Parinacota, ein 6.300 m hoher Bilderbuch-Vulkan, liegt an einem der höchsten Seen weltweit. Hier auf etwa 4.600 m stoßen wir mit unserer Zeltausrüstung an Grenzen. Claudia zittert und macht Liegestütze im Schlafsack, um Wärme zu generieren. Ich fotografiere derweil in Eiseskälte – denn so eine Milchstraße gibt‘s in Leipzig nicht.
Mittlerweile wissen wir mit dem Pickup umzugehen und parken den Wagen abends immer gen Osten. Und während die Morgensonne den Motor auftaut, genießen wir unsere Haferflocken mit Blick auf eine Lamaherde.
Zurück in San Pedro organisieren wir unsere Überfahrt nach Bolivien. Chile raubte uns nicht nur aufgrund der Höhenlage den Atem. Die Farben- und Formvielfalt der Atacama, die Tiere des Altiplano sowie wunderschöne, teils aktive Vulkane ließen uns beständig staunen. An Herausforderungen mangelte es ebenso wenig. Klima, Blizzard und Diebstahl zehrten an unserer Substanz – und zeigten erneut, dass man mit Willenskraft und Zusammenhalt auch schwierige Herausforderungen meistert.
Reisebericht Neuseeland
Neuseeland
02. April – 08. Mai 2014
Ich will hinschmeißen! Traumziel Neuseeland – und wir sind völlig demotiviert. Das Krankenhaus von Christchurch wird erste Anlaufstelle nach dem Flughafen, denn Daniels Fuß erlaubt nicht mehr als schmerzhaftes Humpeln. Vermutlich eine Sehnenscheidenentzündung, das Röntgenbild zeigt jedenfalls keinen Knochenbruch. Die einzige Kur: Ibuprofen und SCHONUNG. Pausieren also ausgerechnet in einer der schönsten Regionen der Erde. Hinzu kommen: ein popeliger Mietwagen, deutsche Spritpreise und gesetzlich stark eingeschränktes Wildcampen. „Wir haben nun schon so viel zusammen geschafft“, tröstet mich Daniel. Und nach 13 Stunden Schlaf krabbeln wir schließlich optimistischer aus dem Zelt heraus und diesem nächsten Höhepunkt entgegen.
Drei Wochen werden wir uns auf der Südinsel von Nationalpark zu Nationalpark hangeln, zwei auf der Nordinsel. Bereits die Fahrt Richtung Lake Tekapo lässt uns eintauchen in endlose Hügel- und Weidelandschaft. Wir halten Ausschau nach Frodo und Sam, denn stets fühlen wir uns in die Welt des „Herrn der Ringe“ versetzt.
Wir gönnen uns gleich zu Beginn Neuseelands höchsten Gipfel. Der Mount Cook (3800m) und seine Nachbarn sind zudem Ursprung des New Zealand Glacier. Dieser schrumpft zwar mit rasanter Geschwindigkeit, behauptet sich aber als längster Gletscher des Landes. In seinem ehemaligen Bett hinterlässt das ächzende, knackende Ungetüm einen neuzeitlichen See – einige Eisberge schaffen es gar bis zur Flussmündung.
Trotz heilendem Fuß und spannender Natureindrücke fällt uns die Umstellung von Tasmanien zu Neuseeland weiterhin schwer. Das kürzlich eingeführte Wildcamping-Verbot schränkt ein, raubt die geliebte Schlaffreiheit. Ausgerechnet Nationalparks bieten die einzige Chance, trubelige Campingplätze legal zu umgehen. Nur hier dürfen wir das Zelt kostenfrei inmitten menschenleerer Natur aufstellen. So schlagen wir etwa im Fjordland an einem beliebten Aussichtspunkt unser Nachtlager auf und staunen über eine Milchstraße, die zum Greifen nahe scheint.
Hatten wir im sonst verregneten Fjordland noch Glück, zeigt uns der Wettergott in den kommenden zwölf (!) Tagen den Stinkefinger. Wir erleben Frost, Dauerregen und harren schließlich zwei ganze Tage bei Sturmböen, Starkregen und Schlammboden in unserem Lager aus. Draußen tobt ein ausgemachter Zyklon, die Bäume biegen sich waagerecht, nebenan zerlegt‘s ein Zelt. Doch mit Himbeermarmeladenbrot und Schoki lässt sich dieser Weltuntergang überstehen.
Auch ohne Zyklon ist die Niederschlagsmenge auf der Südinsel hoch. Feuchte Passatwinde stauen sich an den Bergen der Westküste und bringen Regen, viel Regen: am Milford-Sound an 200 Tagen im Jahr, 20 mal mehr als in Deutschland, mancherorts fallen 50m Neuschnee. So entstehen ausgedehnte, üppige Regenwälder mit immergrünen Südbuchen und Farnteppichen.
Wir vermissen nicht nur Sonnenschein, auch die allgegenwärtigen, raschelnden Tiere Australiens fehlen. Nur eine neugierige Vogelart traut sich zu uns: der Kea. Die geselligen Bergpapageien, verspielt und intelligent, zerpflücken mit Vorliebe Dichtungen und Wischerblätter von parkenden Autos, Mülltüten und Campingequipment. Und so weckt uns morgens um halb sechs ohrenbetäubender Lärm, als sich eine Schar der munteren Gesellen um das Zelt versammelt und alsbald mit der Demontage selbigen beginnt.
So übernachten wir auf Milchfarmen, Kiwiplantagen, Schlachthöfen und freuen uns nicht nur über komfortable Rasenflächen. Die Bauern spendieren meist Kaffee, Frühstück oder eine heiße Dusche. Auch Proviantpakete mit Früchten, Eiern und selbstgemachten Leckereien bekommen wir mit auf den Weg – Graham und Cath lassen uns nicht ohne einen Wochenvorrat Bananenkuchen ziehen.
Ein echter Medienstar wühlt sich im Vogelreservart der staatlichen Naturschutzbehörde durchs Unterholz: der weiße Kiwi. Possums und Hunde bedrohen Neuseelands Nationalvogel – Kiwis können nicht fliegen, legen kaum Eier und leben in Erdlöchern. Ihre Rufe sind durchdringend und wecken uns manchmal gar im Zelt. Die nachtaktiven Vögel kommen üblicherweise mit braunen Gefieder auf die Welt, nicht aber dieser.
Neuseeland, immer wieder von vulkanischen Erruptionen und Erdbeben heimgesucht, befindet sich in einer der geologisch aktivsten Regionen der Erde. Wo die australische und pazifische Kontinentalplatte aufeinanderprallen, verläuft ein Riss quer durch die Nordinsel, eine Kette von Vulkanen und heißen Quellen mit dem Tongariro-Nationalpark als buchstäblichem Höhepunkt.
Die Wettervorhersage gibt grünes Licht und wir machen uns auf, den aktiven Mt. Tongariro zu queren, heilig in der Maori-Mythologie und Namensgeber des Parks. Die anstrengende Tagestour führt über heiße Ascheberge und vorbei an verstreuten Kraterseen, die durch Mineralien beladen smaragdgrün schimmern.
Seit meiner ersten Neuseeland-Dokumentation assoziierte ich das Land mit der White Island. Tatsächlich ist die Insel der Gipfel eines aktiven Unterwasser-Vulkans. Tourguides verteilen Gasmasken und Plastehelme – beides ist unabdingbar! Überall zischt und brodelt es, Schwefelsäure liegt in der Luft. Der Kratersee hat gar einen negativen pH-Wert und ist 50 Mal saurer als Batteriesäure.
Während der knapp zweistündigen Überfahrt haben wir gleich doppelt Glück: unser Kapitän sichtet Tölpel, die einen Fischschwarm einkreisen, da können Delfine nicht weit sein. Und tatsächlich werden wir bald von einer Schule der agilen Meeressäuger begleitet. Etwa 50 Tiere nähern sich dem Boot, vollführen Kunststückchen und reiten die Bugwelle in voller Fahrt – ein Spektakel, das wir wohl nie vergessen werden!
Knapp 17.000 Fahrkilometer, 93 Nächte im Zelt und unzählige kleine und größere Wanderungen liegen nun hinter uns. Westaustralien, Tasmanien, Neuseeland – nie haben wir uns freier gefühlt als in diesem süßen, selbstbestimmten Leben. Das erst verregnete Neuseeland offenbarte schließlich bei Sonnenschein seine atemberaubende Natur. Gletscher, Regenwälder, Fjorde und Vulkane sind hier direkte Nachbarn. Nun beginnt ein neuer Reiseabschnitt in Südamerika: wir freuen uns auf Paulina und ihre Familie in Chile und die trockenste Wüste der Welt, die Atacama.
Reisebericht Tasmanien
Tasmanien
07. März – 01. April 2014
Echte, mitunter kaum erforschte Wildnis, alpine Bergplateaus, üppige Regenwälder – seit einem Reisebericht in Daniels „Naturfoto“ schwirrte uns Tasmanien hartnäckig im Kopf herum. Und wurde schließlich eines der Topziele unserer Reise. Zwar sind wir erneut mit Mietwagen und Zelt unterwegs, doch anders als auf Festland-Australien entdecken wir diesen „Minikontinent“ größtenteils zu Fuß. Wir besorgen uns noch schnell ordentliche Gamaschen, denn alle drei Schlangenarten der Insel sind giftig. Gleich in der ersten Nacht wecken uns die markanten bis fürchterlichen Schreie Tasmanischer Teufel. Vermutlich zanken sie sich um das in der Nähe verendete Wallaby und klingen dabei wie die kleinen Dinosaurier in „Jurassic Parc“.
Knapp 40% Tasmaniens stehen unter Naturschutz, für uns also endlose Trekkingmöglichkeiten. Wir beginnen unser Wanderabenteuer im Mount Field Nationalpark und erkennen schnell körperliche Grenzen. Mit schwerem Gepäck machen wir uns auf, den Mount Field West zu erklimmen und verschenken all unsere Kraft an einem weiten Feld massiver Felsblöcke, über die es zu balancieren bzw. springen gilt.
Tasmanien liegt etwa auf dem 40. Breitengrad, was auf der Nordhalbkugel der Lage Südfrankreichs entspricht. Kalte und feuchte antarktische Stürme des Südwestpassats heulen übers Land – die „Roaring Fourties“ (Brüllende Vierziger). Die Winde bringen viel Regen, der im Westen niedergeht und den Osten verschont. Dies erklärt das stets wechselhafte Wetter, das vor allem im Hochland unberechenbar ist.
Die Wolken fangen sich an der Westküste der Insel und sorgen hier für Niederschlag an 260 Tagen und bis zu 3.000 mm im Jahr (zum Vergleich Deutschland: 500 mm). Der Regen lässt immergrüne, urige Regenwälder entstehen, mit mannshohen Baumfarnen, bemoosten Urwaldriesen und zahlreichen, idyllischen Bachläufen.
Wir dringen vor in das Herz der Insel, in die alpine Region des Cradle Mountain Nationalparks. Wir planen eine zweitägige Wanderung im Weltnaturerbe, verbringen angesichts der aufregenden Vielfalt schließlich jedoch vier Tage in dem Gebiet. Kurz nach Aufbruch ziehen Gewitter übers Land und wir schlagen unser Nachtlager an einem nebelverhangenen See nahe des Cradle Mountain auf.
Aus lauter Frust über das schlechte (Foto)Wetter setzen wir am nächsten Morgen nochmal alles auf eine Karte und verlassen das Zelt im diesigen Morgengrauen. Als die Sonne schließlich den Nebel auflöst, erstrahlt das Gipfelpanorama in solch betörender und vollendeter Schönheit, das uns der Mund offen stehen bleibt.
Voller Vorfreude buchen wir eine abendliche Tour durchs Devil Interpretation Centre im Park: eine Aufzuchtsstation für Tasmanische Teufel, die zumeist ihr gesamtes, etwa vierjähriges Leben dort verbringen. Eine rätselhafte Tumorerkrankung rafft die einzigartigen Beuteltiere derzeit dahin. 2012 wurden einige gesunde Teufel auf die nahe gelegene Insel Maria Island geschippert, um die Art vor dem Austerben zu schützen. Wie auf dieser Reise schon so oft, geht ein Traum in Erfüllung und wir erleben die nachtaktiven Tiere in Aktion. Ich weiß nicht, wer aufgeregter umherflitzt: die Teufel, denen Aas ins Gehege geworfen wird – oder Daniel mit seiner Kamera …
Wie auch in Westaustralien leben wir inmitten einer sonderbaren und allgegenwärtigen Tierwelt. Nachts zirpen die Grillen, tummeln sich Dutzende Wallabies und Pademelons am Lagerplatz (und stolpern über das Kochgeschirr), turnen Possums durch die Bäume, und morgens weckt uns das Gezeter der Kakadus oder das keckernde Gelächter des Lachenden Hans. Was anfangs unheimlich erschien, ist nun wichtiger Bestandteil unseres Alltags geworden. Ein Leben ohne Tiergeräusche – für uns inzwischen kaum vorstellbar!
Schnabeltiere zählen eigentlich zu den Säugern, ihre Jungen schlüpfen allerdings aus Eiern und werden schließlich im Beutel gesäugt und ausgetragen. Ein einzigartiger Fortpflanzungszyklus, den das seltsame Wesen nur mit dem Ameisenigel teilt – beide Arten leben ausschließlich auf Tasmanien. Nach zweistündiger Wartezeit in regungsloser Position, stillschweigend an einem Flussufer, haben wir endlich Glück!
Wir wandern etwa vier, fünf Stunden täglich, stärken uns mit Brot, Cheddar, Schoki und atmen derweil soviel frische Luft, dass unsere Lungen hörbar jauchzen. Dennoch drücke ich mich vor schlauchenden Mehrtagestouren wie etwa dem berühmten Overland-Track. Nepal wirkt noch immer nach. Antrieb und Wille fehlen, die körperlichen und psychischen Kräfte erneut völlig zu erschöpfen. Ich frage mich, ob ich nun bequem werde? Doch wenn ich an all die Trekkinggebiete auf meiner Reisewunschliste denke, weiß ich schnell die Antwort.
Dagegen lohnt sich die fünfstündige Trekkingtour zum Cape Raoul vollends: der Himmel klart an diesem Tag endlich wieder auf, die Doleritfelsen des Kaps ragen Orgelpfeifen ähnelnd majestätisch aus dem Meer. Plötzlich hören wir dröhnende Stimmen von der Tiefe heulen – zahlreiche Seehunde gönnen sich ein Sonnenbad.
Port Arthur – vor knapp 200 Jahren ließ allein der Name europäische Banditen erschaudern. Nur durch eine schmale Landenge mit dem Festland verbunden, entledigten sich die Briten hier ihrer Schwerverbrecher. Zwangsarbeit in den umliegenden Wäldern und strenge Isolationshaft sollten tausende Sträflinge zu „besseren Menschen“ erziehen. 1996 erfuhr das Weltkulturerbe erneut erschreckende Gewalt: ein Jugendlicher lief Amok, erschoss 35 Besucher und Mitarbeiter. Noch heute wirkt der Ort bedrückend. Als wir nach einigen Stunden zurück gen Parkplatz laufen, fühle ich mich merklich erleichtert.
Nach knapp 15 Jahren platzen Daniels Wanderstiefel aus allen Nähten. Wir überlassen die antiken Stücke einem Schuster zur Reparatur, ich entschuldige mich mehrmals für den strengen Geruch und Daniel zieht in Sandalen weiter. Im nasskalten und blutegelverseuchten Regenwald des Lake St. Clair-Nationalpark vielleicht keine gute Idee?
Ein Holzhäuschen am See, inmitten eines Eukalyptuswaldes… Erstmals auf dieser Weltreise können wir uns vorstellen, in einer anderen Gegend als Deutschland zu leben. Tasmaniens landschaftliche Vielfalt ist einzigartig, die Entfernungen gering. Außergewöhnlich hilfsbereite und lockere Einwohner lieben ihr Land, ihr kleines Paradies. Nur ein Fleckchen Erde, sagen manche, könne damit konkurrieren: Neuseeland. Wir sind gespannt …
Reisebericht Westaustralien
Westaustralien
07. Februar – 06. März 2014
Wir wollten Abenteuer – doch bitte nicht schon am Mietwagenschalter… So schön war geplant, von West nach Südost zu tuckern, von Perth nach Melbourne. Doch leider haben wir in Asien lesen verlernt und stellen im Flughafen von Perth fest: 3000 Dollar „Einweg-Gebühr“ für den Rücktransport des Wagens sind zu entrichten. Um diese zu umgehen, müssen wir das Auto wieder hier in Perth abliefern. Und somit anstelle von Süd- und Südostaustralien den Westen des Kontinents bereisen – jetzt in der Nebensaison nur selten besucht; auch der Loose hält sich insachen Westaustralien eher bedeckt. Wir tragens mit Fassung und fahren im Linksverkehr das erste Mal in unserem Leben durch den australischen Busch.
Das „Outback“ ist gleich um die Ecke; es bedarf nicht mehr als 70, 80 Kilometer ins einsame, trockenheiße Hinterland. Wir bremsen oft abrupt angesichts bunter Kakadus, zutraulicher Kängurus, meterlanger Warane und blauzungiger Riesenechsen. Ein Kaninchenfriedhof (mit Grabsteinen) und verbrannte Autowracks sind bizarre Hinweise auf menschliche Zivilisation. Wir merken schnell: auf australischen Highways fährt man ziemlich einsam. Die untergehende Sonne taucht die Prärie mit ihren knorrigen Bäumen und brach liegenden Weizenfeldern in ein erdiges Rot.
Ich erinnere mich an die Abenteuer von Malcolm Douglas. Als Kind hätte ich allerdings nicht gedacht, einmal selbst diesen Kontinent zu erfahren. Nun stellen wir nahe des Waverocks erstmals unser Zelt unter dem australischen Sternenhimmel auf und lauschen dem Klagelied der Raben (das an eine rollige Katze erinnert). Ich denke weder zurück noch nach vorne; weder an zu Hause noch an mich selbst. Die Weite des Outbacks nimmt mich vollkommen ein.
Die Stadt der Hoffnung, Esperance, ist Ausgangspunkt des Cape le Grand-Nationalpark an der Südwestküste Australiens. Zwischen wuchtigen Klippen und hügeligem Hinterland erstrecken sich weite Sandstrände, so gleißend weiß und schön, dass uns die Augen schmerzen. Dagegen kontrastiert der tintenblaue Indische Ozean, der in den flachen Buchten hellblau und schließlich türkis schimmert.
Und als wäre ein Klischee nicht genug, balgen sich einige Kängurus am Strand. Wir staunen mit offenem Mund und sind uns sicher, eine solch beeindruckende Natur seit langem nicht mehr gesehen zu haben.
„Ich bin doch kein Misthaufen!“, jammert Daniel und fuchtelt vergebens, um die unzähligen Fliegen aus dem Gesicht zu vertreiben. Die Erkundung des Kalbarri-Nationalparks mit seinen rostroten Felsschluchten und Steilklippen macht uns nicht nur aufgrund der Gluthitze schwer zu schaffen. Tagsüber kleben ganze Fliegenschwärme auf der Suche nach Wasser an uns und kriechen in Augen, Nasen- und Ohrlöcher. Daniel verschluckt gar zwei. Ich helfe mir mit Ohrenstöpseln aus, letztlich wird eine Mütze mit angenähtem Fliegennetz zum treuen Begleiter.
Das Outback erweist sich zuweilen als ziemlich lebens- bzw. Wildcamper-feindlich. Fliegen und Backofenhitze als permanente Herausforderungen ausgenommen, erleben wir allabendlich eine andere tierische Überraschung. Einmal schlängelt ein riesiger Hundertfüßer flink auf mich zu, ein anderes Mal übergroße Kakerlaken (ich dachte, die gibts nur in asiatischen Hotelzimmern…). Weiterhin entdecke ich nach dem „Duschen“ fette Zecken an meinem Bein, die eigentlich nur im Sand gelauert haben können. Eine schwarze, haarige Tarantel beendet das romantische Sternschnuppenzählen. Einen noch größeren Schreck jagt uns der handtellergroße Skorpion ein, der sich beim Abendbrot dazu gesellt. Später entdeckt Daniel sieben weitere, ein Skorpion krabbelt nachts hörbar die Zeltwand entlang.
Mit auf der Sightseeing-Liste: ein australisches Krankenhaus. Daniel hatte sich bereits in Laos den Fuß verstaucht, ein Band knartze – glücklicherweise jedoch ohne zu reißen. Er erhält einen Stützstrumpf und kann sich um ein paar harte Bushwalks drücken. Beim Schnorcheln am Weltnaturerbe des Ningaloo Reefs werfen wir allerdings jegliche Schonungsmaßnahmen über Bord. Stundenlang schwimmen wir mit Stachelrochen, Schildkröten und Delfinen, beobachten die ungezählten bunten Fische des Korallenriffs, ärgern Mördermuscheln und Seegurken.
Zwei Wochen reisen wir mit Monika und Friedemann – rüstigen Frührentnern mit einer gefährlichen Mischung aus norddeutschem und Berliner Humor, die Australien bereits zum 25. Mal mit dem Jeep durchfahren. Wir kochen, genießen die weinschweren Abende im Busch, lachen Tränen. Beim gemeinsamen Angelausflug fange ausgerechnet ich Vegetarierin einen Fisch, während ich kurz auf Daniels Angel aufpasse.
Exmouth markiert den nördlichsten Punkt unserer Route, wir zweigen ab gen Osten. Die Temperaturen erreichen hier zur Mittagszeit 42°C im Schatten und die aufkommenden Winde sind heiß wie ein Fön. Wir folgen der Hamersley Range in die hügelige, ausgedehnte Landschaft der Pilbara, die im Licht der Dämmerung in allen erdenklichen Pastellfarben leuchtet.
Das Gestein ist so alt wie die Erde selbst, der hohe Eisengehalt verleiht dem Boden eine glutrote Farbe. Das Wasser der seltenen Regenfälle schliff tiefe Schluchten in die harten Felsen, kühle Pools entstanden. In diesen Billabongs ahlen wir unsere hitzegeschwächten Körper. Die schönsten Canyons wurden im Karijini-Nationalpark unter Schutz gestellt.
Hier weiter im Landesinneren wurden ganze Städte in der Nähe riesiger Tagebauten aus dem Boden gestampft, Oasen des Wohlstands in der öden Steppenlandschaft. Ein einfacher Minenarbeiter verdient hier um die 250.000 Dollar. Dazu sind Sprit und Lebensmittel subventioniert, ganze Häuser gestellt. Ein 2 km langer Zug bringt jährlich einige Millionen Tonnen des roten Goldes an die 600 km entfernte Küste; Australien ist der größte Eisenerzexporteur der Welt. Zudem flößen uns die „Road Trains“ genannten Sattelschlepper gehörigen Respekt ein: mit bis zu vier Anhängern und 100 Rädern, 50 m lang und 150 Tonnen schwer.
Diesen Monstertrucks möchte man nicht in die Quere kommen, vor allem Kängurus werden oft brutal aus dem Weg geräumt. Doch plötzlich knallt es auch an meiner Fahrertür, es scheppert und splittert. Ein großes, suizidales Känguru ist uns in die Seite gerannt! Der Spiegel abgerissen, die gesamte rechte Flanke demoliert, die Tür verkeilt, das Tier tot. Als wir uns dem polizeilichen und versicherungstechnischen Prozedere stellen, sitzt der Schreck noch in den Knochen.
Zurück in Perth habe ich das nagende Gefühl, nur einen Bruchteil Australiens kennengelernt zu haben. Erzählungen steigern meine Neugier: von zehrenden Outback-Durchquerungen und dem Norden des Landes mit seinen Krokodilen und Regenwäldern. Der Drang zurückzukehren ist groß! Nun geht es erst einmal auf‘s herbstliche Tasmanien, ein raues Trekkingparadies, gebeutelt von antarktischen Stürmen, und eines der letzten Wildnisgebiete der Erde …
Reisebericht Laos 2014
Laos
09. Januar – 06. Februar 2014
Mit einer kleinen Propellermaschine fliegen wir von Hanoi ins benachbarte Laos – und damit scheinbar auf einen anderen Kontinent. Die nördlich gelegene Stadt Luang Prabang beeindruckt uns mit ihren teakhölzernen Guesthouses, Überbleibsel aus der französischen Kolonialherrschaft. Diese reihen sich entlang wenig befahrener Straßen und weitläufiger Gärten, wir schlendern entlang des Mekong und genießen die angenehme Stille.
Allmorgendlich um 6 Uhr weckt uns ein dumpfer Dong. Zahlreich versammeln sich dann die Mönche zum Almosengang, queren die Innenstadt in einer endlosen Reihe, um von den Einwohnern gekochten, klebrigen Reis zu erhalten. Ein sehr eindrucksvolles Ritual, allerdings gestört durch zahlreiche aufdringlich und mit Blitz fotografierende Frühaufsteher.
Wir freuen uns über die neue laotische Gelassenheit. Auch treffen wir die Weltreisenden Marcel und Fiona wieder, ein heiteres Schweizer Pärchen, dem wir bereits in Myanmar begegneten. Bei einem der kleinen und größeren Umtrunke fällt der Entschluss: durch Laos reisen wir gemeinsam. Zusammen erkunden wir zunächst mystische Wasserfälle in der Umgebung, in deren türkisblauen Wasser wir uns erfrischen. Ob Mountainbiking, Bergsteigen oder Schwimmen – die üppige Natur Laos schreit geradezu nach Aktivität.
Die Schweizer bringen uns auf den Geschmack einer Kayaktour. Für zwei Tage paddeln wir uns auf einem Nebenfluss des Mekongs die Arme aus den Schultern. Im Zickzack manövrieren wir das Boot flussabwärts, Daniel beherrscht es kaum, ich gar nicht. Bis uns heimtückisches Treibholz kentern lässt. In weiser Voraussicht haben wir das Gepäck ans Boot gekettet und – das Wichtigste – die Kamera in einem wasserdichten Packsack verstaut.
Wir teilen unser Lager mit der Familie der Hütte auf dem Dachboden; Privatleben ist hier Luxusgut. Die Nachbarin nimmt routiniert Ratten für‘s Abendbrot ihrer Sippe aus. Derweil segnet uns der Dorfschamane mit reichlich „Lao Lao“, selbstgebranntem Reisschnaps. Später am Lagerfeuer gesellt sich ein Skorpion zwischen Daniels Beine. Die Wärme gefällt nicht nur uns ganz gut. Daniel bleibt genau so lange cool, bis das giftige Tier plötzlich verschwunden ist …
Wir erreichen Vang Vieng und werden mit einer anderen Seite des Landes konfrontiert: grenzenlosem Partytourismus. Die Stadt ist bekannt fürs Tubing, beseelte Hippies und anderes Partyvolk treibt dabei in Gummireifen den Nang Song hinunter, freilich nicht ohne die unzähligen Uferkneipen auszulassen. Ein bisschen wie Thailands Fullmoonpartys, Abifahrt und Komasaufen. In den letzten Jahren gab es allerdings zuviele Tote (die Strömung erfodert ein Minimum an geistiger Anwesenheit), mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt.
Laos‘ Hauptstadt Vientiane sprüht wohl kaum vor Charme. Einzig beeindruckt uns das Besucherzentrum der Cope-Organisation. Diese fertigt Prothesen für Amputierte – Kinder und Bauern, die Opfer fehlgezündeter Munition wurden. Außerdem bildet Cope laotisches Personal aus, um die „Bombies“ zu räumen. Obwohl neutral, fielen während des amerikanisch-vietnamesischen Krieges mehr Bomben auf Laos als während des gesamten zweiten Weltkrieges. Der Ho Chi Minh-Pfad verlief durch das Land, der Nachschubweg nordvietnamesischer Truppen in den Süden.
Der Nachtbus bringt uns nach Si Phan Don, an den südlichsten Zipfel des Landes, wo Laos an Thailand und Kambodscha grenzt. Hier formt der Mekong ein riesiges Flussdelta, unterhält unzählige Nebenarme und stürzt schließlich über felsige Kliffs ins benachbarte Kambodscha. Dazwischen liegen hunderte Inseln und Inselchen – das Gebiet der „4000 Islands“.
Unsere Wahl fällt auf das Eiland Don Khon, ein von Bungalows gesäumtes Hängemattenparadies, in dem der Puls fühlbar langsamer schlägt. Wir erkunden die Insel mit dem Rad, baden im Mekong, dümpeln auf Tubing-Reifen entlang des Ufers, schlürfen „Happy shakes“ und entspannen am Strand, um uns anschließend von der ganzen Anstrengung zu erholen…
Trotz Daniels Bitten und Betteln verlassen wir Don Khon nach 4 Tagen – aus Entspannung wurde für mich einfach Langeweile. Von nun an sind wir wieder auf uns allein gestellt, ohne unsere eidgenössische Begleitung. Wir nehmen für einige Tage ein Motorrad und streifen durch die Kaffeeplantagen des Bolavenplateaus. Ein Einheimischer empfiehlt einen abgelegen Markt in Salavan, hier gebe es viel „wildlife“. Und tatsächlich: Flughörnchen, Schleichkatzen, Eulen, Papageien – laotische Gaumenfreuden sind vielfältig und lassen Artenschutz nicht zu. Mehrfach bekommen wir Schnaps angeboten, in dem Schildkröten, Cobras und allerhand andere Gifttiere eingelegt wurden. Gesund und schön soll er machen, wir lehnen dankend ab (brauchen wir ja nicht?).
Die Zeit im paradiesisch schönen und unaufgeregten Laos bildet einen angenehmen Abschluss der fünfmonatigen Asienreise. Wir verbrachten unzählige Stunden in Bussen jedweden Komfortniveaus, haben Tausende Kilometer auf Mopeds, Fahrrädern, Booten, Pferdekutschen und Tierrücken zurückgelegt, in ca. 70 verschiedenen Hotels, Homestays und Drecklöchern genächtigt und schon seit einem halben Jahr nicht mehr selbst gekocht. Nun wird alles anders! Die kommenden drei Monate sind wir on the road, queren im Mietwagen und zu Fuß Australien, Tasmanien und Neuseeland. Wir werden im Zelt schlafen, selbst kochen, die unberührte Natur genießen – und endlich wieder wandern gehen!
Reisebericht Vietnam
Vietnam
16. Dezember 2013 – 09. Januar 2014
Zugegeben: ich fühle mich zunehmend Asien-müde. Menschenmassen kann ich kaum entfliehen, das dröhnende Hupen der Mopeds höre ich im Schlaf, knatternde LKWs wirbeln Unmengen von Staub auf und rauben jeder Radtour ihren Charme, Radio und Fernseher laufen jederzeit auf Maximallautstärke, die Verständigung auf Englisch hapert – zu oft gibt es böse Überraschungen in Restaurants. Natürlich sind das alles keine großen Probleme, im Gegenteil, das pure Abenteuer. Doch vier Monate ständig tief durchatmen und Kompromisse machen zu müssen, das zehrt an meinen Nerven. Ich fliege nach Vietnam mit einem mulmigen Gefühl.
Doch ausgerechnet das kühle Hanoi, welches uns mit Regen und herbstlichen Temperaturen empfängt, spendet mir neue Kraft! Die Metropole macht Spaß, ihr Flair ermuntert – ein Mix aus französischen Straßencafés, multikultureller Studentenszene, asiatischer Lebendigkeit und westlicher Großstadtmoderne. Wir checken in einem luxuriösen Hotel ein. Die Duschvorrichtung ist neuzeitlich, das Bett doch tatsächlich frisch bezogen! National Geographic läuft die halbe Nacht. Urlaub vom Urlaub! Und draußen flitzen die Mopeds vorbei. Angeblich acht Millionen zählt die Stadt, das Überqueren der Straße wird zur echten Mutprobe …
Wir planen, uns im landschaftlich wohl reizvolleren Norden des Landes aufzuhalten; ein Bus bringt uns zunächst nach Tam Coc, südlich Hanois. Das ruhige Örtchen liegt malerisch inmitten der sogenannten „Reisfeld-Halong-Bucht“. Wir staunen über unzählige erodierende Kalksteinfelsen, deren Täler sich im Lauf der Jahrtausende mit Sedimenten füllten. Die Berge ragen so wie Zuckerhüte aus einer endlosen Ebene, dazwischen liegen verstreute Weiler, Plantagen und Fischteiche.
Bis auf die Kälte und den Duft von Stollen, der von Deutschland herüber zieht, erinnert nichts an die bevorstehenden Weihnachtstage. Eine Fähre bringt uns auf eine entlegene Insel der Cai Tu Long-Bucht. Mit ihren verstreut aus dem Meer ragenden, schroffen Kalksteinformationen bezaubert sie ähnlich wie ihre berühmte Schwester Halong. Sie blieb jedoch von Massentourismus und Kommerz bislang verschont. Es gibt ein einzelnes, verschlafenes Betonkaff, eine Handvoll Unterkünfte und Strom zwischen 17 und 22 Uhr.
Am Ende des weitläufigen Strandes kann man das Ende der Welt sehen, ich schwör’s. Und so schweifen meine Gedanken sehnsüchtig ins ferne Thüringen, wo man sich gerade in der heimeligen Stube am reichlich gedeckten Tisch versammelt, die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, Glühweinduft und Kerzenschein. Ein ganzes Jahr reisen kommt mir in diesem Moment doch furchtbar lange vor …
Schon bald sind wir des süßen Nichtstuns überdrüssig, setzen wieder über auf das Festland und schlagen uns mühsame zwei Tage im „local bus“ bis an die nordöstliche Grenze zu China durch. Die pittoreske Landschaft setzt sich hier nahtlos fort, zwischen den steil aufragenden Felsen stürzen tosende Wildbäche durch die Schluchten. Der Ban Gioc-Wasserfall liegt am Grenzfluss zum roten Riesenreich und dient als Vorbild für all die kitschigen Wandgemälde in Chinarestaurants.
In einem zugigen Städtchen stürzen wir uns in das geschäftige Markttreiben. Argwöhnisch werden wir beobachtet, jeder Schritt genau registriert. Zunächst zeigen sich die Marktweiber distanziert und kamerascheu – bis die Erste ihr Konterfei auf dem Kameramonitor erblickt! Kreischendes Gelächter bricht aus, Freunde werden herbeigerufen, Fotomutige rennen auf Daniel zu, Ängstliche vor ihm weg. Das ganze Nest gerät in Aufruhr. Und einmal mehr fungiert Daniels Nikon als echter „Eisbrecher“.
Man nötigt uns zu allerlei harntreibenden Tees, klebrigen Süßigkeiten, gerösteten Bienenmaden, getrockneten Maiskolben – und schließlich beißt Daniel in ein Stück Hundewurst („Schmeckt ein bisschen streng, wie Leber!“). Soviel Gastfreundschaft hatten wir gar nicht erwartet. Die Vietnamesen geben sich zumeist ziemlich ruppig und barsch. Zwar emsig, clever und jederzeit für ein Geschäft zu haben. Aber ein warmes Lächeln (mit dem uns die Burmesen stets verwöhnten) gibt‘s hier oft nur, wenn man den Geldbeutel zückt.
Tagelang treffen wir auf keinen anderen westlichen Touristen, von Restaurants keine Spur, mit Englisch kommen wir hier genauso voran wie mit Latein – gar nicht. Ich erweitere mein vietnamesisches Hallo-Danke-Tschüss-Vokabular um so wichtige Worte wie Bus, Toilette, vegetarisch, Reis, Gemüse. Wir essen Reisnudelsuppe zum Frühstück, sitzen in schmalen Garküchen auf winzigen Plastikstühlen, Einheimische schmunzeln über unseren zunächst tölpelhaften Umgang mit Essstäbchen.
Für eine Strecke von 240 km benötigen wir zwei volle Tage. Der Lokalbus wird nämlich umfunktioniert zum Postauto. Wir ernten ärgerliche Blicke, da wir den Platz besetzen, der eigentlich für wuchtige Pakete voller Naturalien, Steppdecken, Strickware und gackernde Hühner reserviert war. Um die Post direkt zum Empfänger zu liefern, stoppen wir von Haus zu Haus. Passagiere und Fahrer erfreuen sich an schnulzigen Liedern. Ich, eigentlich atheistisch, fange an zu beten – wir überholen grundsätzlich in Kurven, an Anstiegen und jedem Gegenverkehr zum Trotz.
Nur eine Stadt im Nordwesten, umgeben von den höchsten Bergen des Landes, wird vom Tourismus erstürmt: Sapa. Hier sowie im Umland leben etwa ein Dutzend ethnische Minderheiten, die sich nach wie vor in traditionelle Gewänder kleiden. Leider müssen wir jedoch genau vor den bunt Kostümierten mit ihrem Trödel flüchten. „Shopping, Shopping!“, rufen sie jedem Westler zu und tätscheln dessen Arm, „Wer ar ju from? Wod ies jor näm?“ Daniel ist bei diesen Gelegenheiten schon lange nicht mehr der Arzt aus Germany, sondern Rüdiger (können sie nicht aussprechen), mittelloser Biologiestudent aus Rumänien (kennen sie nicht).
Die Gegend um Sapa wird als landschaftlich wunderschön gepriesen, im Sommer leuchtet das terrassierte Land in sattem Grün und Bauern bestellen ihre Felder. Ich dagegen bin schockiert: riesige Urwaldflächen mussten Reis- und Kohläckern weichen, die Bauern der Dörfer roden schleichend ganze Wälder für landwirtschaftliche Nutzflächen und Brennholzgewinnung. Die Erosion schwemmt anschließend die Bergflanken zu Tal. Der Kahlschlag der Hänge wird gerade jetzt besonders deutlich, wenn die Felder abgeerntet in tristem Braun liegen. Ich ärgere mich über die Kurzsichtigkeit der Menschen, bis mir klar wird, dass Europa es nicht besser gemacht hat …
Wir sind zurück in Hanoi, organisieren ein Ticket nach Laos, freuen uns über den seifigen Geruch unserer frisch (hand)gewaschenen Kleider, genießen Cocktails und Bier Hanoi. In meiner begrenzten Vorstellung assoziierte ich Vietnam eher mit Kriegsgräuel, trist und grau. Tatsächlich bringt die Jahreszeit diesige Luft und kaum Sonnenschein mit sich; die Vietnamesen sind meist distanziert. Doch genau diese Distanz und angenehme Kühle söhnen uns wieder aus mit dem sonst so einvernehmenden Südostasien.
Reisebericht Myanmar
Myanmar
19. November – 15. Dezember 2013
Schokocroissants, Laundryservice, der Besuch des örtlichen Friseurs: noch einige Tage tiefenentspannen wir in Kathmandu. Dann fliegen wir nach Kuala Lumpur. Die US-amerikanisch anmutende Hauptstadt Malaysias verpasst mir einen zermürbenden Kulturschock. Ich bin froh, die Metropole mitsamt ihren Fastfoodriesen, Mercedes-Filialien und futuristischen Petronas-Towers schnell hinter mir zu lassen.
Vor uns liegt Myanmar. Ein Land, dass vor allem aufgrund seiner verheerenden politischen Situation und der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in den westlichen Medien Erwähnung findet. Der Reiseführer warnt: hier gebe es keine Geldautomaten, nur makellose Dollarscheine würden akzeptiert, Touristen von der burmesischen „Stasi“ bespitzelt und niemals solle man selbst politische oder religiöse Themen ansprechen!
Doch mit dem scheinbaren Ende der Militärdiktatur 2011 und der stetigen Öffnung des Landes nach außen wächst der Tourismussektor mit Lichtgeschwindigkeit. Der staatlich forcierte Boom stützt sich auf ein funktionierendes Fernbusnetz, zahlreiche neue Hotels und Geldautomaten, die VISA akzeptieren. Einige der ATMs wurden pfiffigerweise direkt in der Shwedagon Paya in Yangon installiert, der bedeutsamsten buddhistischen Stupa des Landes.
Von dieseliger Großstadtluft gesättigt, nehmen wir den Nachtbus zum Chaungtha Beach. An die Strände im Südwesten des Landes lockt es weniger ausländische Touristen, viel mehr dienen sie der Mittelschicht Yangons als kurzweiliges Wochenendparadies. Wir entfliehen den Menschenmassen, Hunden, Mopedfahrern, Jetskibooten, Müllbergen, Fisch- und Schmuckverkäufern und fahren auf einer Vollcross (die uns besser im Griff hat als umgekehrt) entlang eines kilometerlangen menschenleeren Palmenstrandes.
„Warmly welcome and assist tourists“, heißt es auf einem Hinweisschild inmitten eines Ortes. Ich glaube, die Einheimischen haben es internalisiert. Sie begegnen uns Fremden mit einer derartigen Wärme und aufrichtigen Freundlichkeit, die ich als kühle Deutsche schlicht unfähig bin zurückzugeben. So sehr ich auch will. Wir werden stets angelächelt, neugierig beäugt. Vor allem junge Mädchen fragen mich schüchtern nach einem gemeinsamen Foto. Ein Restaurantbesitzer schenkt Daniel Zigarren, seine Frau mir derweil einen hölzernen Armreif. Wir, aus dem fernen Westen, haben plötzlich VIP-Status.
Einige ‘blaue Stunden’ später nutzen wir die günstige Anbindung zu einem weiteren Highlight, dem Inle Lake. In einem Boot erkunden wir die weite, sumpfige Marschlandschaft mit fließendem Übergang zum See. Lautlos gleiten wir entlang der Wasserstraßen kleiner Ortschaften, deren streichhölzerne Bambushütten sich auf wackeligen Stelzen halten. Lila Wasserhyazinthen bilden hübsche Vorgärten. Bauern ernten Tomaten, bauen Gurken und Bohnen auf ihren schwimmenden Feldern an. Kiosk, Schweinestall, Schule, Wochenmarkt und Post – alles Alltagsleben geschieht hier auf dem Wasser.
Doch das Bild des idyllischen Myanmars trügt. Viele Gebiete des Landes sind aufgrund politischer und religiöser Unruhen gesperrt, darunter leider auch der Norden mit den Ausläufern des Himalaya. Somit konzentrieren sich die Besucher auf wenige zentral-gelegene Routen. Um dem staatlich gelenkten Touristenstrom zumindest etwas zu umgehen, reisen wir in das Städtchen Hsipaw im nördlichen Shan-Staat. Eine mehrtägige Wanderung soll uns durch die Dörfer der Palaung führen, eines der ca. 70 Völkchen dieses multikulturellen Landes. Es gibt keine Karten der Gegend, auch Google maps zeigt nur weiße Flächen, und auf einen Guide wollen wir verzichten. Wir sprechen kein burmesisch und die Menschen hier kein englisch – doch das ist nicht weiter tragisch, denn die Palaung kennen eine gänzlich andere (Schrift)sprache. Ein Einheimischer notiert und übersetzt die Namen der Dörfchen in unleserliche Kringel und rät noch vom Zelten ab: zu viel Miliz, Wildschweine, handtellergroße Spinnen und Schlangen, nicht zuletzt sei es verboten.
Wir verbringen einen feuchtfröhlichen Abend mit einer Runde Briten, reichlich chinesischem Bier und übernachten in der Bambushütte eines Gasthauses. Ich erwache spät nachts, da sich mein Rucksack bewegt, struppig anfühlt und schließlich im Halbdunkel die Form eines verlausten Straßenhundes annimmt. Es dauert eine ganze Weile, das Tier nach draußen zu bugsieren. Claudia kämpft derweil gegen eine böse Magenverstimmung und verbringt die halbe Nacht auf dem Plumpsklo im Freien. „Das ist bestimmt eine Reisvergiftung!“, schimpft sie und vermutlich hat sie recht. Das burmesische Essen ist zwar prinzipiell lecker, aber meist ziemlich ölig und auf Dauer recht eintönig. Es gibt Reis mit Gemüse, frittiert, gebraten oder gedünstet, fettige Reiscracker oder Reisnudeln. Claudia versalzt manchmal absichtlich ihr Essen, um Abwechslung reinzubringen. Was würden wir geben für ein Stück Graubrot mit Käse? Noch schöner wäre Döner, Bratwürstchenpizza oder Freddy Freshs „Grüner Garten“… Ein Bauer bringt Claudia am nächsten Morgen auf dem Moped zurück nach Hsipaw, während ich zu Fuß folge.
Den strapazierten Magen stellen wir arg auf die Probe und nehmen den Zug in die ehemalige britische Kolonialstadt Pyin Oo Lwin. Wir buchen „Upper class“… und bekommen den dreckigsten Mäuse-Waggon, den wir je gesehen haben. Die Strecke führt über völlig versandete und wellige, mitunter auch unterhöhlte Gleise – ich wusste gar nicht, dass ein Zug so hoch hüpfen kann, ohne zu entgleisen. Gelohnt hat sich die abenteuerliche Fahrt kaum: Pyin Oo Lwin hat außer einem botanischen Garten und seltsamen Vögeln nichts zu bieten.
Wir suchen schnell das Weite, ein Pickup soll uns nach Mandalay bringen, in die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Fahrt ist – Überraschung! – holprig. Unterwegs bricht eine der Holzbänke, sodass eine untersetzte Omi fast rücklings von der offenen Ladefläche purzelt. Am Ziel angekommen, klopfen wir uns den Staub aus den Kleidern und genießen den letzten Abend in Myanmar an der längsten Teakholzbrücke der Welt.
Während Daniel die Abendstimmung fotografisch einfängt, spaziere ich entlang der Brücke – allerdings kaum ungestört. Ein Dutzend Jugendlicher und ganze Familien knipsen begeistert Gruppenfotos mit mir, eine Frau schenkt ihre selbstbestickte Perlentasche, eine andere eine Hand voll Obst. Diese außergewöhnliche Gastfreundschaft macht die Reise nach Myanmar für mich so wertvoll. Dennoch befinde ich mich stets im moralischen Zwiespalt. Das investierte Geld landet zumeist in den Taschen aktueller Regierungsangehöriger (ehemalige Generäle) oder deren reicher Unterstützer. Ob Fernbusse, Restaurants, Banken, Hotels oder Tankstellen – Vetternwirtschaft und Günstlingsunternehmen dominieren den Tourismussektor. Kleinere Herbergen erhalten keine Lizenz für ausländische Besucher, Bauern wird das Land geraubt um neue Hotelstandorte zu erschließen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen keine Rolle. So sehr ich die natürliche Herzlichkeit der Menschen schätze, so künstlich fühlt sich das Reisen an. Alles ist gelenkt, freies Entdecken nicht möglich; zu jeder Zeit können die Falschen darüber entscheiden, in welche Richtung sich der Tourismus entwickelt und letztlich das gesamte Land.
Reisebericht Nepal
Nepal
01. Oktober – 19. November 2013
Auch während unseres Fluges von Delhi nach Kathmandu verfolgt uns das Pech: der geplante Flieger wurde hoffnungslos mit gestrandeten Passagieren vom Vortag überbucht, ohne eine Ersatzmaschine bereitzustellen – über eine derartige Planlosigkeit wundern wir uns allerdings kaum noch. Ein bekleckerter Typ, der aussieht wie der Pförtner, sich aber als Manager vorstellt, erklärt kurz: „No possible!” Wir verbringen eine feuchte Nacht in einem Hotel, das auf den Namen ‚Wasserschaden’ hört, bevor wir am nächsten Tag in Kathmandu landen.
Nepals Hauptstadt wirkt, zumindest im Vergleich zu Indiens Megacities, recht sauber und aufgeräumt, die Menschen viel zurückhaltender und weniger nervtötend. Sogar richtige Stadtbummel sind möglich, ohne ununterbrochen angequatscht/-fasst/-hupt oder fotografiert zu werden. Wir sind begeistert! Und besorgen dennoch rasch sämtliche Trekkingpermits (irgendwie müssen ja die Devisen ins Land kommen) und die Bustickets nach Jiri (s. Karte). Unser Plan sieht vor, von Jiri aus in 7 Tagen nach Namche Bazar zu laufen, um für die anstehenden Aufstiege ausreichend trainiert zu sein. Für das richtige Feeling bringen wir Zelt und Kochgeschirr mit. Von Namche aus wollen wir die Gokyo-Seen erreichen und über den Cho la-Pass (Thagnag Kharka) schließlich nach Gorak Shep. Von dort ist es nicht mehr weit zum Basislager des Mount Everest sowie zum 5545m hohen Gipfel des Kala Pattar mit bester Sicht auf das Everest-Massiv. Insgesamt planen wir, etwa 25 Tage zu trekken und bringen 10 Puffer- und Akklimatisationstage mit. Doch es wird anders kommen …
Die ersten Tage sind, wie befürchtet, knüppelhart. Die unbefestigten Pfade folgen zumeist Bachläufen oder Viehwegen und verwandeln sich bei Regen in schlammige, rutschige Pisten. Die Route schneidet Täler und Pässe – an manchen Tagen können wir das Ziel des Abends schon morgens sehen, leider auf der anderen Seite der Schlucht. So steigen wir täglich 1000 m ab und anschließend wieder auf – bis Namche werden wir etwa so viele Höhenmeter zurücklegen, wie der Mount Everest hoch ist.
Wir beginnen zumeist im Morgengrauen, erreichen die Unterkunft am frühen Abend, stopfen Unmengen Kohlenhydrate in unsere Mägen und fallen wie die Steine ins Bett. Ich keuche und schwitze, verfluche jedes einzelne meiner 20 Kilo Gepäck und an den steilen Hängen des subtropischen Regenwaldes ist an Zelten nicht mal zu denken. Meine blasigen Füße schmerzen und ich habe das Gefühl, als brächen meine Schultern – ich glaube, noch nie in meinem Leben soviel gearbeitet zu haben. Auch der Monsun hält sich nicht an die Absprache, denn es regnet viel, manchmal sogar tagelang. Die schlechten Wege verwandeln sich in noch schlechtere, und wo wir mit Trekkingstöcken und Stiefeln bewaffnet ängstlich über die Felsen klettern, überhohlen uns Sherpa mit 40-80 Kilo. In Flip Flops. Nach vier Tagen sind wir ziemlich fertig, demotiviert, demoralisiert. Claudia verdrischt ihren Rucksack.
Die Unterkünfte reichen von zugigen, mit ein paar Pritschen und Spinnen versehenen Dachstuben bis hin zu einfachen Hotels. Gekocht wird meist über dem offenen, mit Holz oder Yakmist beheizten Feuer. Gesund ist das nicht: wir sehen viele Nepali mit chronisch geröteten Augen, Kinder mit Husten und Rotznasen.
Die Menschen hier sind wettergegerbt und zäh wie Yakleder. Schon die Kleinen laufen barfuß im Schnee und spielen mit Messern, die Älteren holen glühende Kohlen mit spitzen, aber bloßen Fingern aus dem Feuer. Sie sind uns gegenüber aufgeschlossen und gastfreundlich; ohne Zweifel arm, wirken aber glücklich und zufrieden mit dem, was sie ihr Hab und Gut nennen dürfen. Wir begegnen einem Stückchen des ‚echten‘ Nepals.
Das ändert sich schlagartig, als wir Namche erreichen: ausgebaute Wege, teure Lodges und viel Kommerz. Jährlich besuchen etwa 30.000 Menschen den Sagarmatha-Nationalpark, der überwiegende Teil wählt den bequemen Luftweg über Lukla. Uns begleiten Karawanen lärmender Amerikaner, vermummter Japaner (vielleicht ist die Luft zu gut?), Abenteuersuchende jeglicher Trainings-, Gewichts- und Altersklassen. „Bei manchen fragt man sich, ob sie nicht versehentlich in den falschen Flieger gesetzt wurden“, scherzt einer.
Die allermeisten heuern Träger an, die für wenig Geld das Gepäck schleppen. Die Porter sind zumeist arme Schlucker aus dem Kathmandutal, oft in Sandalen unterwegs und keineswegs an die Höhe gewöhnt. Manche schlafen in Viehställen, Höhlen oder im Freien und jährlich bleiben einige, von Hunger und Kälte geschwächt, auf der sprichwörtlichen Strecke. Wer nicht mehr arbeiten kann, wird heimgeschickt, sich selbst überlassen.
Wir merken wir schnell: die Plackerei von Jiri hat sich gelohnt! Wir sind topfit und nachdem wir ein paar Kilo überflüssigen Gepäcks zurück gelassen haben, fällt uns das Laufen nochmal leichter. In Namche Bazar decken wir uns mit Wochenvorräten an Yakkäse, Brot, Schokolade und Keksen ein (die soeben gewonnene Leichtigkeit ist natürlich gleich wieder dahin). Weiter oben wird alles teurer, mitunter unverschämt… heiß duschen: 3 €, 1 Rolle Klopapier: 4 €, Akku laden: 10 €.
Von nun an gewinnen wir rasch an Höhe. Da wir im Sinne einer entsprechenden Akklimatisation nicht mehr als 300m am Tag aufsteigen dürfen, ist das Tagesziel häufig schon gegen Mittag erreicht. Unsere Vorsicht zahlt sich aus: bis auf etwas Husten und leichte Schlafapnoe werden wir während des gesamten Treks keine ernsthaften Höhensymptome verspüren.
Doch bereits in Dole beginnt es wieder zu regnen. Weiter oben wird der Regen zu Schnee, viel Schnee, Unmengen davon, und immer häufiger tönt dumpfes Grollen von den Hängen. Als schließlich einige Sherpa und Yaks nicht weit von uns von einer Lawine in den nahen Fluss gespült werden, brechen wir in Machermo ab und verbringen die Nacht in bezeichnender Umgebung.
Schnell spricht sich herum: sämtliche Pässe werden für mindestens eine Woche unpassierbar sein, die Stimmung ist gedrückt. Wir treffen auch hier alte Bekannte wieder und tragens mit Fassung. Was solls, ein paar malerische, azurblaue Seen auf 5500 m sind sicher sowieso langweilig… Am nächsten Morgen bricht die Sonne allmählich hervor, wird der Schnee nass und schwer, überall gehen Lawinen und Erdrutsche nieder – Wahnsinn! Wir steigen rasch ab, schaffen drei Tagesetappen mit einmal und sind froh, in Phortse unterhalb der Schneegrenze zu sein.
Die östliche Route über Pheriche, Dughla und Lobuche bringt uns rasch nach Gorak Shep (5170 m). Spätestens hier sind die unzähligen Höhenkranken, die zu schnell zu hoch aufgestiegen sind, in völliger Unkenntnis und von geldgierigen Agenturen in zu enge Zeitpläne gepresst, nicht mehr zu übersehen. Manche Wegabschnitte sind förmlich rot markiert (Bluthusten). Wir stapfen durch tiefen Schnee in unglaublich gleißendem Licht und verbrennen uns die Nase von unten! Die Temperaturen pendeln zwischen Extremen: eigentlich müsste es schon aufgrund der Höhe stets knackig kalt sein, aber die äquatornahe Sonne brennt sich mühelos durch die dünne, knochentrockene Luft. So halten wir es zur Mittagszeit im T-Shirt aus, während das Thermometer nachts auf -15 °C fällt und die Fenster der unbeheizten Lodges innen dick mit Eis überzogen sind. Spätestens hier, in dieser unwirklichen und unwirtlichen Natur komme ich mir völlig deplatziert vor, als Gast willkommen, aber unfähig, auch nur eine einzige Nacht im Freien zu überleben.
Wir beschließen, den Kala Pattar noch am Nachmittag zu besteigen. In den nächsten Tagen sollen Basislager, Cho la-Pass und die (sowieso langweiligen) Gokyo-Seen folgen. Auf halber Strecke, in ca. 5400 m Höhe, genießen wir einen fantastischen Blick auf Everest, Nuptse und Lothse. Fantastisch, nicht von dieser Welt – ich denke, das triffts. Ich versuche, die Dimensionen zu begreifen: wir laufen in einer Höhe, höher als der höchste Punkt Europas und vor uns türmen sich noch einmal 3 Kilometer schierer Fels und Eis. Just hier beginnt auch die „deterioration zone“ (wörtlich Verfallzone), in der kein anhaltendes Leben ohne künstlichen Sauerstoff mehr möglich ist. Keine Siedlung der Welt liegt höher und auch das Base Camp, selbst Tibet, ist nur einen Steinwurf entfernt. Dann verhüllen Wolken die Sicht und wir müssen umkehren.
Trotz tiefer Müdigkeit winde ich mich hellwach; obgleich eisiger Kälte schwitze ich vor Angst. Der Abszess am linken Fußknöchel, mit dem ich mich bis hier hinauf nach Gorak Shep auf knapp gequält habe, pocht und pulsiert gnadenlos. Ich halte den Fuß aus meinen warmen Daunenschlafsack, doch bewirkt dies nur taube Zehen. Schon in zwei bis drei Stunden, gleich nach Sonnenaufgang, wollen wir endlich zu den Hauptzielen unseres Bergtrekkings aufbrechen – der erneute Aufstieg zum Kala Pattar und der Besuch des Everest-Basislager bedeuten einen insgesamt achtstündigen Marsch. Doch so nah am Ziel wissen mein Herz und meine Vernunft nur einen richtigen Weg: zurück nach unten – und zwar so schnell wie möglich! Blasenentzündung, Erkältung, rissige Hände und Füße, stark verbrannte Lippen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ein Abszess an der Ferse und nun ein walnussgroßer Abszess am Knöchel, den Daniel mehrfach mit einer Schere aufschneidet und zu reinigen versucht. Noch nie zuvor habe ich meine physischen Grenzen derart überschreiten müssen. Jetzt aber sagt mein Körper entgültig „Stopp“. Ich bin beruhigt, als Daniel verständnisvoll gemeinsam mit mir absteigt, gleichzeitig weiß ich aber um den schier endlos langen Halbtagesmarsch, den es bis in das Krankenhaus nach Pheriche (4240m) bedarf. Wie ich es bis dahin – Eis, Matsch und Flüsse überquerend – geschafft habe, keine Ahnung. Weiterreichende Details zum operativen Eingriff lasse ich an dieser Stelle aus. Ich weiß, dass meine Schreie in ganz Pheriche hörbar sind. Praktischerweise trägt Daniel seine wasserabweisende Regenjacke – meine Tränen prallen an ihr ab.
Einen Tag später gibt es auch für Daniel kein Entrinnen mehr, ein Leistenabszess hat für eine kurze Nacht gesorgt. Während ich mein bandagiertes Füßchen hochlege, stattet er der freundlichen Ärztecrew einen erneuten Besuch ab – er war schließlich schon länger nicht mehr im Krankenhaus! Dann kurieren wir beide uns und unsere Wunden erst einmal zwei Tage in Pheriche aus.
Am Abend gibt es dann für mich kein Halten mehr, die Nacht ist so klar und dunkel wie seit sechs Wochen nicht mehr. Ich steige nachts noch mal 200m auf, mogele mich durch Yaks und Hunde. Über mir schimmert der Sternenhimmel und als der Mond aufgeht, leuchten die schneebedeckten Bergspitzen in hellem Gold.
So allein im Dunkeln bin ich über die Entscheidung abzusteigen ziemlich glücklich. Die Strapazen der letzten Wochen, die eingeschränkten hygienischen (Un)möglichkeiten, das eintönige Essen und nicht zuletzt die dünne, eisige Luft haben uns mehr zugesetzt als erwartet. Wir waren fix und fertig, mit blank liegenden Nerven. Es ist seltsam: wir haben keines unserer Ziele erreicht, aber das Gefühl, es aus eigenem Antrieb bis hierher geschafft zu haben, ist ein ausreichend schönes.
Der mehrtägige Abstieg nach Lukla bringt wärmere Temperaturen, wir stärken uns mit Apfelkuchen, echtem Bohnenkaffee mit echter Milch ohne Milchpulver und frischem Obst. Der „gefährlichste Flughafen der Welt“, von dem auch wir nach Kathmandu zurück fliegen wollen, liegt zwischen German Bakery und Nepal Investment Bank. Die Landebahn ist etwa 200m kurz, abschüssig und endet vor einer Betonmauer, auf der „Welcome“ steht. Die Verhältnisse erinnern an jene auf einem Flugzeugträger, nur ohne Fangseil. Ein weiteres Problem: die kleinen Propellermaschinen fliegen nur auf Sicht, sodass bei wolkenverhangenem Himmel niemand mehr aus Lukla heraus- oder von Kathmandu hereinkommmt. Einige haben bereits bei der Ticketbuchung Schmiergeld gezahlt, um einen extra frühen Flug zu ergattern – wohlwissend, dass morgens zumeist die tagesbesten Wetterbedingungen herrschen. Wird der Flieger gecancelt, landet man auf einer Warteliste (die keiner erkennbaren Ordnung folgt) und fällt dabei sogar hinter all jene zurück, die an den Tagen zuvor keinen Flug bekommen haben. Daniel schimpft wutentbrannt mit einem Airport-Mitarbeiter, der einen Batzen Geld von einem nepalesischen Guide einsteckt. Tage später werden Prügeleien um die begehrten Plätze in einem der Helikopter ausbrechen, bis die Polizei einschreitet.
Solange bleiben wir nicht und steigen gleich für weitere drei Tage in das Bergdorf Salleri ab. Von hier aus sollen regelmäßig Jeeps in 16 Stunden nach Kathmandu fahren. Leider nicht als wir eintreffen. Aufgrund mehrtägiger nepalesischer Feiertage liegt auch in Salleri der Verkehr lahm – bis auf eine Handvoll massiv überteuerter Jeeps. Wir überlegen nach Jiri, zum Ausgangspunkt unseres Himalayatreks, zurückzulaufen. Doch mein lädierter Fuß, durch das Laufen in Sandalen nach der Operation arg gestaucht, nimmt uns die Entscheidung ab. Daniel dagegen hat seine letzten Reserven verloren und muss den sprichwörtlichen Gürtel so eng schnallen, dass ihm nach ein paar Kilometern die Beine einschlafen.
Wir zahlen den 9-Mann Jeep, in dem neben uns noch 17 Einheimische „Platz“ finden, und rumpeln insgesamt 36 Stunden über felsige Wege, Schlammgruben und durch reißende Flüsse. Drei Mädels übergeben sich in regelmäßigen Abständen bei voller Fahrt (10 km/h) aus dem Wagenfenster. Wir erleben zwei Reifenplatzer, die Suche nach dem Wagenheber und checken schließlich über Nacht in einem Minus-6-Sterne-Hotel ein. Am nächsten Morgen bricht die Vorderachse …
Endlich zurück in Kathmandu bedarf es zweimaligen Duschens (erst die grobe, dann die feine Reinigung), zwölf Stunden Schlafes und eines üppigen Abendbrotes mit Salat, Riesenpizza und Everest-Bier, bis wir uns wieder wie menschliche Wesen fühlen. Ich schreibe Postkarten und stelle fest, dass ich noch gar nicht erfassen kann, was wir in den vergangenen fünf Wochen alles erlebt und vor allem bewältigt haben. Der tägliche Marsch in der rauhen Natur, die Nähe zu den höchsten Bergen der Welt, das Schlafen und Essen in den Hütten nepalesischer Familien – intensiver kann Leben nicht sein.
Reisebericht Indien
Indien
08. September – 01. Oktober 2013
Unsere Reise beginnt auf Umwegen: der Flieger hat Verspätung, wir verpassen den Anschluss in Doha, der Hauptstadt Quatars, und müssen „notgedrungen“ in einem Luxushotel des Ölstaats übernachten. Wir sind fassungslos in Anbetracht der Energieverschwendung: heiße Wüstenwinde und Backofenluft kontrastieren mit Eislaufbahnen und gekühlten Flaniermeilen, in Hotels tragen wir rasch einen wärmenden Pulli. Die ganze Stadt, ihre futuristische Skyline, erscheint uns wie ein Fremdkörper, deplatziert und dekadent – nein, ganz sicher nicht unser Fall.
Wir landen in Mumbai, ich erwarte einen Highway vom Flughafen zur Innenstadt, oder wenigstens Schilder, vergeblich. Die nächtliche Fahrt gerät zur Odyssee über holprige Pisten, vorbei an Slums, nach endlosen Runden finden wir schließlich die richtige Adresse, wo uns Jochen und seine Frau herzlich empfangen.
Geführt von einem NGO-Mitarbeiter besuchen wir Dharavi, wohl einen der größten Slums Asiens. Hier leben ca. 1 Million Menschen auf knapp 2km2, nur Legehennen haben weniger Platz. Die Grenzen zum „normalen“ Stadtgebiet Mumbais verlaufen fließend, die Gassen werden enger, die Häuser niedriger, die Luft stickiger. Ich bin geschockt ob der Lebensbedingungen, auch Claudia wird ganz still. Der allgegenwärtige Müll lockt Hunde, Krähen und Ratten, dazwischen Kühe, Ziegen, Menschen. Überall der Geruch von Verwesung, je nach Windrichtung unterschiedlich gefärbt, wir kämpfen gegen unseren Brechreiz. Hier verdient das Trittoir noch seinen Namen, Abwasser mäandriert zwischen Wellblechhütten, vermischt sich mit Fäkalien jedweder Spezies, um schließlich müllbeladen ins Meer zu fließen. In einem Recyclinghof kochen Jugendliche Aluminiumschrott, der Rauch treibt uns Tränen in die Augen, unser Guide mahnt zur schnellen Passage. Einige Jungs schweißen ungeschützt selbstentworfene Häcksler für Plastikmüll, manche sind schon erblindet. Dazwischen spielen Kinder Cricket. Wir passieren eine Gerberei, Ziegen knabbern an den siffenden Fellen ihrer toten Artgenossen – ich versuche, durch die Ohren ein- und Nase auszuatmen und muss an “Das Parfüm” denken.
Überraschend wird klar: indische Slums sind kein Obdach bettelnder Almosenempfänger – wer hier lebt, fährt Tuk Tuk oder putzt, arbeitet im Straßenbau oder als Polizist, manch einer pendelt gar täglich aus den Vorstädten. Dharavi ist eine Stadt-in-der-Stadt, mit Frisör und Fitness-Studio, Bäcker und Barbier, sogar medizinischer Versorgung und rudimentärer Rechtsordnung. Nur Pizza Hut liefert nicht mehr, um das 30-Minuten-Versprechen halten zu können. Wer hier lebt, kann nicht ganz arm sein, sondern kämpft mit horrenden Mieten – ein Eigenheim in besserer Lage kostet bis zu Eintausend Euro pro Quadratmeter! In Anbetracht der explodierenden Bevölkerungszahlen ist Wohnplatz rar und heiß begehrt, der Slum ein riesiger Recyclinghof mit einem geschätzten Jahresumsatz von 650 Mio. Euro. So ist Dharavi nach wie vor ein Anziehungspunkt zahlloser Glücksuchender, ein Ergebnis der Landflucht – allein Mumbai schluckt täglich Tausend Neuankömmlinge.
“Das blöde Kamel will mich absichtlich ärgern!”, schreit Daniel wütend, als sein Dromedar den Weg direkt durch den Dornenbusch wählt. Auf unseren „Wüstenschiffen“ schaukeln wir zusammen mit indischem Guide über die Sanddünen und Graslandschaften der Thar. Für zwei Tage und Nächte dürfen wir uns in ihrer Ruhe, hitzigen Schönheit und Weite endlich wohlfühlen. Innere Rast finden von dem städtischen Chaos Indiens. Die „Große Wüste“ ist Lebensraum für unzählige Echsen, fliegende Skarabäen, Gazellen, Raubvögel, Kühe der Nomadenvölker. Die Regenzeit liegt nur etwas mehr als einen Monat zurück, sodass sich die sonst karge Savannenvegetation in üppigem Grün zeigt. Wir reiten nie mehr als eine Stunde, Dromedartouren stellen sich als schmerzhafter für die Beine heraus als gedacht. Unser Guide beantwortet uns im typischen Hindi-Englisch alle Fragen zur Wüstenlandschaft, weiht uns in das Geheimnis der Chai-Zubereitung ein, bekocht uns am Feuer. Wir schlafen inmitten bizarr wellenförmiger Dünen unter dem Sternenhimmel – für mich ein einzigartiges Funkeln, Daniel dagegen ist aus Fotogründen enttäuscht (irgendwie stimmt mit dem Mond etwas nicht…). Die Kühle der Nachtluft wirkt heilsam, bringt doch die Hitze des Tages unser Blut schier zum Kochen.
Bei flimmernder Hitze und knappem Wasservorrat ist an Körperpflege über das Zähneputzen hinaus nicht zu denken, der Dromedarführer verzichtet bis auf ein „Bad“ in einer schlammigen Viehwasserstelle völlig. Zurück in Jaisalmer befreien wir uns vom Wüstensand, waschen Schweiß- und Dromedargeruch von uns ab. Die neugewonnene Ruhe, der erste atemberaubende Natureindruck allerdings bleibt und verhilft uns, Indien in unser Herz zu schließen.
Bei Bikaner erwartet uns ein besonderer Leckerbissen der indischen Kultur, der Rattentempel von Deshnok. Mehr als 20.000 der Nager werden als heilig verehrt, gehegt und gepflegt. Wir waten durch Ratten- und Taubenmist, Müll und allerlei Ungeziefer – barfuß, sonst wird‘s unrein. Drinnen ertrinken die Ratten in Süßigkeiten und Kokosmilch, draußen betteln die Kinder. Claudia flucht.
Die Wüstenstädte Rajasthans, vorrangig ihre Stille und angenehme Wärme im Morgengrauen, verhelfen mir nach und nach zu mehr Sicherheit und Wohlgefühl. Ich überwinde allmählich den Kulturschock und freue mich, endlich gelassener Indien zu erkunden. Erstaunlich cool machen Daniel und ich uns auf nach Neu Delhi – wir benötigen noch das Visum für die Einreise in Myanmar im November. Delhi zeigt sich überraschend „reinlich“, das Gandhi-Museum, der Ort seiner Kremation sowie der Lodhi-Park stellen sich als zumindest menschen„ärmere“ Orte heraus, die wir zu genießen wissen. Selbst der unüberschaubare Tumult des Basars, der unser Hotel umgibt, bringt uns nicht mehr allzu sehr aus dem gefundenen Gleichgewicht.
Mein schöner Plan, das Taj Mahal im weichen Licht des Sonnenaufgangs zu fotografieren, wird vom späten Monsun durchkreuzt: es schüttet die ganze Nacht wie aus Eimern; Wiesen und Wege rund um das wohl „schönste Gebäude“ sind überflutet. Ein indischer Maharatscha erbaute es für seine verstorbene Frau. Ein schöner Liebesbeweis – mal sehen, wie sich Claudia weiterhin führt …
Für einen gläubigen Hindu ist es das größte Glück, hier beigesetzt zu werden, am Abend lodern die Flammen zahlreicher Scheiterhaufen. Kinder, Schwangere und Leprakranke werden direkt im Fluss bestattet; so schluckt die „Heilige Mutter Ganges“ täglich viele Tonnen Abwasser, Müll, Leichen und Kadaver, der Anblick mancher Szenen erscheint grotesk.
Wir haben uns an vieles in Indien gewöhnt, uns mit dem Land angefreundet, könnten Stunden hier sitzen und das bunte Treiben beobachten. Doch bald geht es nach Nepal, in die Einsamkeit der Berge. Viele sagen, Indien würde man entweder hassen oder lieben, dazwischen gäbe es nichts. Bestätigen können wir dies nicht – wir verlassen das Land mit Hassliebe …
Reisebericht Südpatagonien & Feuerland
Südpatagonien & Feuerland
29. Dezember 2018 – 22. Februar 2019 | 1.440 km, 11.900 hm
Fleischbrühe mit Hackklößen wird aufgetischt, ein Albtraum von Essen. Eigentlich. Und eigentlich sitzt die Inkarnation des Bösen mir gegenüber: Schäfer Carlos, mit blutverschmiertem Hemd, von der Brust bis über beide Ohren rot bespritzt. „Wir haben heute über Tausend Schafe markiert. ‘Nen Schlitz ins Ohr geschnitten. Und die wehren sich immer so!“ Ich bin Vegetarierin, betrachte Menschen und Tiere als gleichwertig – doch Carlos und seine Kollegen sind heute meine Helden. Die argentinischen Schäfer teilen nicht nur ihr Abendbrot, sondern weisen uns einen eigenen Raum zum Schlafen und schmeißen den Gasboiler für die heiße Dusche an. Noch vor einer Stunde habe ich die Winde verflucht, die letzten 500 Kilometer nimmermüden Sturms, der alle Ruhe raubt, nur noch zur Flucht nach vorne drängt. Radfahren in der Pampa fühlt sich an wie eine Treibjagd, nur sind wir die vom Wind Verfolgten. Hier auf der Estancia hat uns der Chef der Schäfer, Santiago, Zuflucht gegeben. Nun sitze ich inmitten blutverschmierter Männer in einer warmen Küche, der Wind ist ausgesperrt, löffle Brühe und werde ganz demütig. Denn Santiago erzählt achselzuckend: „Hier kommen fast täglich Leute auf dem Fahrrad oder Motorrad vorbei, ich nehme jeden auf. Ich möchte einfach, dass es den Menschen um mich herum gut geht.“
Doch spulen wir zurück: In Villa O’Higgins endet Chiles südlichste Sackgasse, die Carretera Austral. Nur über einen Trampelpfad durch triefenden Regenwald gelangen Fußgänger und Reiter nach Argentinien. Das Rad durch Morast hievend erreichen wir den südlichen Teil jener Landschaft, die der portugiesische Entdecker Fernando Magellan 1520 „Patagonien“ taufte. „Patagones“, große Füße, sollen ihre Ureinwohner gehabt haben, dabei hinterließen die eher kleingewachsenen Menschen bloß rätselhaft große Spuren im Sand mit ihren guanakofellgewärmten Füßen.
Lange Zeit blieb Patagonien ein unerforschter weißer Fleck auf der Landkarte. Erst Ende des 19. Jahrhunderts einigten sich Chile und Argentinien auf eine gemeinsame Grenze entlang der kontinentalen Wasserscheide: Gebiete, die in den Pazifik entwässerten, sollten zum chilenischen Territorium gehören; was zum Atlantik floss, Argentinien. Dass die Wasserscheide im damals unerschlossenen, extrem zerklüfteten Patagonien in unregelmäßigen Schleifen mäandert und in Zeiten des Klimawandels gar ihren Verlauf ändern sollte, war damals nicht vorauszusehen. Immer wieder streiten die Nachbarn daher über Zugehörigkeiten, zumal der eigentliche Reichtum der Region offensichtlicher wird: Wasser. Über 20.000 Quadratkilometer erstrecken sich die patagonischen Eisfelder – ganz Sachsen passte hinein – und bilden den drittgrößten gefrorenen Süßwasserspeicher des Planeten.
Sowohl Chile als auch Argentinien errichteten daher grenznahe Vorposten, um sprichwörtlich Flagge zu zeigen. Wie El Chaltén: 1985 noch ein Kaff, heute einer der am schnellsten wachsenden Orte Argentiniens – dank Facebook und Instagram. Denn der Hausberg Fitz Roy gilt als „Place to see before you die“, Selfiesüchtlinge aus aller Welt kommen in Reisebusladungen. Wer gerne Schlange steht beim Wandern, übervolle, Smartphone-Musik-beschallte Zeltplätze bevorzugt und nichts über die argentinische Kultur lernen will, der verbringe seinen kostbaren Jahresurlaub hier.
Gerade lässt der Schneeregen nach, wir tauen auf in einer Herberge und drücken uns vor der bevorstehenden Etappe. Draußen pustet der Wind einen Rollkoffer die Straße hinauf, wo bleibt nur der Besitzer? „Heute ist ein guter Tag zum Wandern!“, meint die Herbergsmutter völlig ernst. Wir wollen nach Feuerland und ich ahne es: vor uns liegen 1.400 Kilometer Wetterprügelei.
An den meisten Tagen fühlen wir uns wie in einem Windtunnel für Formel-1-Boliden. Obwohl wir die Fahrtrichtung nicht dem Zufall überlassen und überwiegend mit den vorherrschenden Winden fahren, bleiben immer noch genügend Abschnitte, uns die tollwütigen Sturmböen um die Ohren klatschen zu lassen. Einmal pusten sie mich vom Rad, ich lande auf der Gegenfahrbahn. Daniel wirft es beim Wandern mitsamt Rucksack ins Gebüsch. Jeder Gegenstand muss stets und ständig an den Rädern festgebunden werden, um nicht in Afrika zu landen. Der Wind ist so stark, dass der Kaffee aus den Bechern spritzt, seine Lautstärke so unerträglich, wir müssen uns anbrüllen, um einander überhaupt verstehen zu können. Wir hangeln uns von einer verfallenen Hütte zur nächsten, kochen in Straßenunterführungen und Erdlöchern, zelten hinter Kieshaufen und in verlassenen Scheunen. Kein schützender Wald, kein Gesträuch, keine Berge, keine Dörfer, manchmal kann das Auge die Weite nicht mehr ertragen.
Daniel reißt ausgerechnet während der heftigsten Mittagsthermik ein Schaltzug. Glücklicherweise haben wir Ersatz dabei und vorsorglich ein Youtube-Video gespeichert: „Fädeln Sie den Seilzug vorsichtig durch Öse 8 und 9…“ Mit Ruhe und Geduld macht er sich allem Sturm zum Trotz an die Arbeit. Mein Gesicht jedoch scheint nach sieben Wochen Wind und Kälte nur noch „Ausgebrannt“ zu signalisieren, denn die wenigen Bewohner zeigen besonders viel Mitgefühl: Ein Ladenbesitzer winkt uns in seine Wohnstube, damit wir im Warmen Mittag essen können. Eine Studentin schenkt Bananen und Apfelsinen. In einer Herberge finden wir einen Tag Unterschlupf, die Besitzerin kümmert sich wie (m)eine Oma. Schweizer Urlauber pfropfen uns und zwei weitere Radfahrer in ihren Pickup, ersparen uns somit 120 Kilometer Gegenwind. Die Zuflucht, die uns Santiago und seine Schäfer geben. Immer wieder Quäntchen neuer Schubkraft, die mich letztlich davon abhalten, mein Rad im nächsten See zu versenken.
Unsere stürmischen Gegner heißen Brüllende Vierziger, Wilde Fünfziger und Schreiende Sechziger – im Wissenschaftsjargon. Wir befinden uns zwischen dem 40. und 60. Breitengrad und schon unter den frühen Seefahrern galt das Sprichwort: „Unterhalb des vierzigsten Breitengrades gibt es kein Gesetz mehr, ab den Fünfzigern auch keinen Gott.“ Verantwortlich für diese furiosen Stürme ist die Nähe zum antarktischen Kältepol. Von hier fließen frostige Meeresströme und Luftmassen Richtung Äquator – der Motor für diese außergewöhnlich starken und kalten Westwinde, die ungebremst um den Erdball jagen. Die Spitze des südamerikanischen Kontinents ist dabei die einzige nennenswerte Landmasse, die wie ein Finger in diesen Ventilator ragt. Was wir in Deutschland hin und wieder als Orkan erleben, ist hier der Normalfall.
Die Kontinentalmasse Antarktis ist dabei viel kälter als unsere Arktis, acht mal stärker als auf der Nordhalbkugel wehen daher die Westwinde der südlichen Breiten. Und in noch einer Sache hat Europa Glück gehabt: der Golfstrom hält uns warm. Denn Patagonien liegt in gar nicht so extremen Breiten wie man denkt: El Chaltén befindet sich auf dem gleichen Breitengrad wie Augsburg – bloß auf der Südhalbkugel – und selbst Ushuaia, immerhin die südlichste Stadt der Welt, ist genau so weit entfernt vom Süd- wie Kiel vom Nordpol. So kommt es, dass der patagonische San-Rafael-Gletscher auf dem 47. Breitengrad bis hinunter ins Meer fließt – es ist beinahe so, als würden die Alpengletscher ins Mittelmeer kalben.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten die Weißen die endlose Pampa als wertvolle Weiden. Einem kurzen Vernichtungskrieg gegen die Mapuche und Tehuelche folgten Schafzüchter, die die halbe Welt mit Wolle und Fleisch belieferten. Argentinien wandelte sich zu einem der reichsten Länder der Erde. Noch Mitte des letzten Jahrhunderts galt „Reich sein wie ein Argentinier“ in Deutschland als geflügeltes Wort. Bis in die 90er Jahre wurden die natürlichen Ressourcen ausverkauft, ausländische Firmen wie die Modemarke Benetton zu den größten Grundbesitzern des Landes. Heute jedoch sind die Weltmarktpreise für Wolle und Fleisch so verfallen wie die einstigen Gutshöfe, ist das Weideland vielerorts überweidet und der Erosion preisgegeben.
Doch hier im Nirgendwo sollen sie verschachert sein: Millionen von Dollar in Koffern und Containern. Schmiergelder, die das ehemalige Präsidentenpaar Kirchner von Bauunternehmen erhielt. Öffentliche Aufträge sind begehrt, denn keiner überprüft, ob die Straßen oder Wasserkraftwerke überhaupt entstehen. Der Whistleblower im jüngsten Korruptionsskandal war der präsidiale Chauffeur: akribisch notierte er seine „Dienstfahrten“ und sogar das Gewicht der Plastikbeutel voller Dollarscheine, die er im Auftrag der Kirchners durch das riesige Land transportierte. 160 Millionen Dollar – so viele Hotels konnte das Präsidentenpaar gar nicht bauen, um das Geld reinzuwaschen, deshalb rücken nun die Bagger auf der Suche nach vergrabenen Plastikbeuteln in Patagonien an. Senatorin Kirchner genießt jedoch Immunität, und weil Korruption fast zum guten politischen Ton in Argentinien gehört, gibt es Gerüchte, dass sie erneut zur Präsidentschaftswahl antritt.
Lange hatten wir uns darauf gefreut, schließlich gilt Chiles bekanntester Nationalpark als der Inbegriff Patagoniens schlechthin: Torres del Paine. Doch je näher das Highlight rückt, desto nüchterner stellen wir fest, dass das Weltnaturerbe zum Disneyland gerät. Massen asiatischer Touristen schieben sich im Gänsemarsch die Pfade entlang, beleibte Amerikaner mieten einheimische Träger, um Abenteuerluft am Ende der Welt schnaufen zu können. Wer mag, kann für 2.000 Dollar pro Nacht in einem der Luxushotels nächtigen. Nur Radreisende, die spontan auf einfachen Zeltplätzen lagern müssen, haben das Nachsehen. Und die Nationalparkbehörde wundert sich ob der explodierenden Besucherzahlen und erhöht die Eintrittspreise immer weiter – die wir umgehen, indem wir uns vor Sonnenaufgang am Tor vorbei schleichen.
Magellan und seine Mannschaft zermürbte die ewige Kälte auf hoher See, das immernasse Wetter, die endlosen Winternächte, nur durchbrochen von den flackernden Feuern der Ureinwohner – er nannte die Insel „Feuerland“. Um heute noch Siedler in diese harschen Gefilde zu locken, senkte der Staat die Einkommenssteuer und subventioniert massiv die Elektroindustrie. Fernseher, Kühlschränke und Smartphones – in Argentinien alles „Made in Tierra del Fuego“. „Die Leute hier sind Eiszapfen an der Nase gewöhnt“, lacht Blanca, die uns auf ihren Zeltplatz einlädt. „Wir öffnen Anfang Oktober, bei 7 Grad rennen uns die Familien die Tore ein.“
Erleichtert erreichen wir „die südlichste Stadt der“ Welt: Ushuaia. Im Haus von Zimmervermieterin Gloria tropft es von der Stubendecke, das Dach ist undicht und wir vermuten die argentinische Gelassenheit als Ursache. Sie kommt von selbst auf das Thema zu sprechen: Gas- und Strompreise seien erneut gestiegen, das Geld reiche einfach nicht, um zu sparen oder das Haus zu reparieren. Gelassenheit oder Geldmangel, vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. In der Pizzeria nebenan sechs Angestellte, eine kämmt sich die Haare, eine andere trinkt Kaffee, die nächste Mate, der andere flirtet, der Rest whatsappt. Am Flughafen frage ich den Kellner nach einem kleinen Rabatt und zahle den halben Preis – das sollte ich mal zu Hause versuchen?
Wir verlassen Kaltundwindistan und fliegen ins schwülheiße Buenos Aires. Der erste Weg führt zur Physiotherapeutin: Daniel kämpft mit Rückenschmerzen. Die Sprechstundenhilfe singt beschwingt, ihr Kollege empfängt in hautenger, kurzbeiniger Jeans. Eigentlich ist eine ärztliche Überweisung notwendig, aber „Tranquilo Amigo, das passt schon!“
Trotz seiner greisenhaften Silhouette hetze ich den alten Mann durch die Museen. Das ehemals größte Folterzentrum des Landes liegt mitten im Stadtzentrum. Während der Militärdiktatur wurden hier Ende der 70er tausende Oppositionelle gefoltert, vermummt und angekettet, aber nicht ohne noch ein Geschäft rauszuschlagen: Kinder der Regimegegner wurden unter Offizieren und Unternehmern verschenkt oder verkauft, Schwangere in einen extra Raum gedrängt, um zu gebären, bevor Piloten des Militärs sie mit den anderen Gefangenen narkotisiert ins Meer warfen. Als ihre Kinder und Enkel spurlos verschwanden, gingen die Mütter und Großmütter auf die Straße. Seit 1978 demonstrieren die Madres de Plaza de Mayo an jedem Donnerstag Nachmittag, wollen wissen, wo die Verschwundenen sind. 130 Enkel von 500 vermissten konnten sie finden. Niemand brachte sie zum Schweigen, auch dann nicht, als die Anführerin selbst verschwand wie ihr Sohn zuvor.
Zimmervermieter Nicolas lädt zum Asado: zur typisch argentinischen Abendbrotzeit, um zehn, wird das Grillgut aufgetafelt. Sein Stadtteil erinnert optisch an Neukölln. Anderthalb bis zwei Stunden pendelt die Freundin im Bus in die zehn Kilometer entfernte Downtown. „Freut ihr euch auf zu Hause?“, fragt uns Nicolas, als wir von unserem Flug nach Madrid berichten. Ja, nein. Nun.
„Südamerika war hart“, so könnte man die vergangenen sechs Monate zusammenfassen. Die Kälte der Hochgebirgswüsten, das Auf und Ab entlang der Carretera Austral, der Wind Patagoniens – die klimatischen Extreme zehrten mehr als erwartet, aber die Landschaften und Gastfreundschaft entlohnten zuverlässig für jede Müh. Bald werden wir Thüringen und Leipzig wieder so nahe sein wie seit zwei Jahren nicht mehr. Auf die Heimkehr stellen wir uns jedoch – noch – nicht ein und rollen in die entgegen gesetzte Richtung: nach Marokko.
Reisebericht Nordpatagonien
Nordpatagonien
30. Oktober – 29. Dezember 2018 | 2.270 km, 31.890 hm
Ich fühle mich seekrank und bin gar nicht auf dem Wasser. Nachbeben lassen mich schwanken. Doch keine seismische Kraft treibt mich aus dem Bett, sondern die Übelkeit nach dem stärksten Cocktail, den chilenische Familienfeiern zu bieten haben: „Terremoto“ – Erdbeben. Ein Gemisch aus Weißwein, klebrig süßem Grenadinesirup und Ananaseis. Ein paar Tage tanken wir Heimat bei Paulina im chilenischen Los Ángeles. Familienfeste bis zum Morgengrauen, Frühstück vielleicht um zwölf, vielleicht gar nicht, ungewiss auch die anderen Mahlzeiten, dafür jede Nacht Terremoto-Party mit dutzenden Verwandten. Alles also noch beim Alten seit unserem letzten Besuch 2014. Nach vier Tagen ist unser Biorhythmus völlig durcheinander, Schlaf- und Wachphasen auf den Kopf gestellt. Völlig selbstverständlich werden wir noch schnell zu Weihnachten und einer anstehenden Hochzeit eingeladen, „¡Mi casa es tu casa!“ Dass Daniels Eltern Paulina vor zehn Jahren als Austauschschülerin aufnahmen, hat uns letztlich eine zweite Familie auf einem anderen Kontinent geschenkt.
Paulinas Familie zählt zum Mittelstand Chiles, der Lebensstandard ist hoch im reichsten Land Südamerikas. Die Preise für Lebensmittel, Hotels, Autos und Hochzeiten ähneln denen in Deutschland. Lähmende Armut, wie in den Nachbarländern Peru und Bolivien, gibt es selten. Während der Pinochet-Diktatur wurden „auf freundliche Empfehlung“ der USA Kupfer, Wälder, Strom, aber auch Bildungs- und Gesundheitswesen, Rente, alles teil- oder ganz privatisiert. „Wir sind eben eine Kolonie der USA“, spotten ein paar Studenten. Das brachte ausländische Investitionen – jedoch auch alle Nebenwirkungen grenzenloser Privatisierung mit sich. Die Minengesellschaften im wüstenhaften Norden sicherten sich private Wasserrechte, in manch einer Kommune bleibt keines mehr für den häuslichen Gebrauch und wird teuer mit Tankwagen herangeschafft. Paulina musste für ihr Studium einen Kredit aufnehmen, ihre Schwester Geld sparen für eine OP in einer Privatklinik. Selbst die Nationalparkverwaltung vergibt Lizenzen an private Unternehmer, die zwar jeden Peso aus ihren Besuchern pressen, aber kaum investieren. Vergammelte Infrastruktur, lieblose Wanderwege, überquellende Toiletten, dafür saftige Eintrittspreise und die dreiste Masche, ausländische Touristen doppelt zur Kasse zu bitten.
Nicht nur riesige Shoppingmalls und protzige Autos, auf Pump gekauft, erinnern an den Lieblingsverbündeten. Wie die US-Amerikaner leiden viele Chilenen unter Einzäuneritis. Private Ländereien und Forstplantagen, ja sogar Rapsfelder sind lückenlos von Stacheldraht umgeben, was die Zeltplatzsuche enorm erschwert. Manchmal öffnen wir die Zäune und zelten heimlich, viele Bauern überlassen uns ihre Viehweiden aber auch ganz offiziell, oft mit Logenblick auf Vulkane und Gletscher. Guillermo und Myriam laden zu Abendbrot und Dusche. Überwältigt von so fernem Besuch ist auch Luisa, die ihren Sohn am Telefon abwimmelt: „Ich kann jetzt nicht, ich habe wichtige Gäste, es sind Deutsche!“
Von Dänemark bis in die Sahara, so weit ist es von der Atacama ganz im Norden Chiles bis zu unserem Ziel am südlichen Ende: Feuerland. Schlappe 4.200 Kilometer liegen dazwischen. Chile ist zwar lang, aber dünn wie ein Strich und daher gerade einmal doppelt so groß wie Deutschland. Nur 18 Millionen Einwohner zählt das Land. Zwei Drittel der Fläche bestehen aus unbewohnbaren Wüsten, zerklüfteten Gebirgen, Fjorden und ewigem Eis, nur ein kleiner Teil ist landwirtschaftlich überhaupt nutzbar.
Nachdem wir im Norden des Landes genug Sand geschluckt haben, wollen wir das zentral gelegene Seengebiet erkunden und landen auf Pferdepfaden. Durch manche Gebiete kommen mitunter nur noch Ross und Wanderer, und zwei bescheuerte Radtouristen, die ihre Lastesel durch das unwegsame Gelände schieben müssen. Doch das ist allemal sicherer als geteerte Hauptstraßen.
Bäume, aufgespannten Regenschirmen gleich, sind das Ziel der beschwerlichen Anreise. Die öligen Kerne der seltsamen Araukarien sicherten den Ureinwohnern in der nicht enden wollenden Winterzeit das Überleben, heute sind sie selbst vom Aussterben bedroht. 2.000 Jahre lang kann ein solcher Gigant Vulkanausbrüchen und Waldbränden trotzen – modernen Kettensägen hat die dicke Borke allerdings nichts entgegenzusetzen. Immer weiter schrumpfen die Bestände, um Platz zu machen für schnell wachsende Kiefern- und Eukalyptusplantagen.
Die Anden bilden das Rückgrat des Landes und sind das Ergebnis tektonischer Aktivität: seit 150 Millionen Jahren taucht die Nazca-Platte unter die Südamerikanische Platte, mit rasanten sechs Zentimetern pro Jahr, wird unter ungeheurem Druck aufgeschmolzen und ergießt sich in unzähligen Vulkanen. Über 2.000 sollen es allein in Chile sein, je nach Zählweise, davon sind 80 noch heute aktiv – mehr Vulkanismus gibt es nur in Indonesien.
Viele Feuerspucker der Region zählen zu den besonders anmutigen Stratovulkanen, die wie schneebedeckte Wächter ihre Umgebung überragen. Besonders zähflüssige Lava türmt sich im Laufe unzähliger Eruptionen zu einem spitzen, perfekten Kegel, oft von einer vergletscherten Spitze gekrönt. Immer wieder erschüttern spektakuläre Ausbrüche das Land, verschütten Dörfer und Städte, formen schwerste Erdbeben ganze Landschaften neu. Im Krater des Villarica brodelt gar seit zwanzig Jahren ein daueraktiver Lavasee. Angst vor der nächsten Verwüstung aber hat niemand, im Gegenteil. Während wir mit mulmigem Gefühl am Fuße der Feuerberge zelten, radeln, wandern, wundern wir uns, weshalb mehr und mehr Häuser gebaut werden und Hotels entstehen. Viele antworten: „Ich bin halt damit aufgewachsen.“ Angst hat man wohl vor dem, das man nicht kennt.
Nicht nur die Vulkane lassen unsere Herzen flattern. Dutzende Bäckereien werben mit „Kuchen“, Brauereien mit „Kunstmann Bier“. Deutsche Auswanderer wurden Mitte des 19. Jahrhunderts angeworben, sie hatten Geld, Know-How und machten die Gegend überhaupt erst urbar. Gut so – wir schlemmen uns durch Rhabarberkuchen mit Pudding und echte deutsche Bäckerbrötchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen auch einige Nazis nach Chile. Vor uns sprechen die Einheimischen jedoch weiterhin gut von den „Alemanes“ und verharmlosen allzu oft ihre Verbrechen. Antijüdische Verschwörungstheorien hören wir immer wieder. Und einmal mehr auf dieser Reise müssen ausgerechnet wir die Schandtaten der Deutschen erklären.
Auch die Aufarbeitung der eigenen Diktatur geht schleppend voran. Während des 17-jährigen Militärregimes wurden 2.000 Menschen ermordet, knapp 30.000 Oppositionelle gefoltert, verschwanden über 1.100 spurlos. Doch noch heute zeigen Umfragen, dass etwa die Hälfte der Chilenen die erst 1990 endende Epoche nicht grundsätzlich als etwas schlechtes empfindet. „Eines Tages haben Pinochets Männer meinen Neffen geholt, er ist bis heute verschwunden. Aber das war auch gut so! Er und seine sozialistischen Kameraden haben Bomben gebastelt, sie hätten uns ins Unglück gestürzt“, so Umberto, ein Grundbesitzer, der uns seine Gartenlaube für eine Nacht überlässt. Nein, nach seinem Neffen suche er ganz sicher nicht. Manche Lehrer würden das Wort „Diktatur“ im Unterricht vermeiden. Mittäter schweigen, Familien wissen immer noch nicht um die Rolle ihre Angehörigen im System. Vieles erinnert an die Aufarbeitung der SED-Dikatur in Ostdeutschland, bei der wir über das Wort „Unrechtsstaat“ streiten und „auch nicht alles schlecht war.“
Ausgerechnet ein Projekt Pinochets treibt uns Reiseradlern Freudentränen in die Augen: die Carretera Austral. Der Diktator befahl 1976 den Bau einer Straße im bis dahin nahezu unerschlossenen Süden Chiles, um in den schwelenden Grenzstreitigkeiten mit Argentinien Präsenz zu zeigen. 10.000 Soldaten trieben die 1.200 Kilometer lange Schotterpiste in Patagonien unablässig voran, die bis heute nicht fertiggestellt ist. Mittlerweile sind etwa 60 Prozent der Straße asphaltiert und ein Bauarbeiter mein persönlicher Held – er schiebt mich rennend einen ganzen Anstieg hinauf!
Viel haben wir gesehen in den vergangenen 20 Monaten, doch die Carretera Austral setzt allem noch ein landschaftliches Sahnehäubchen auf. Die Straße windet sich durch immergrünen Regenwald und offene Steppen, folgt Fjorden und Flüssen, passiert Vulkane und Gletscher, findet ihren Weg durch scheinbar unpassierbares Terrain. Nun, im Frühsommer, schmeckt die Luft nach Ginster, scheint die Welt parfümiert von blühenden Lupinen. Jeder Kilometer im Rausch – alle Frischverliebten wissen, wie wir uns fühlen.
Dazu unendlich viel Ruhe, nur ab und zu passieren wir kleine Ortschaften mit gut sortierten Tante-Emma-Läden. Die Verkäuferin hüpft aus dem Wohnzimmer ins Geschäft und zurück in die Küche, um uns die Schätze im Ofen zu zeigen: warme, selbstgemachte Brötchen. Dazu Butter, aufgeschnittene Tomaten, keine große Auswahl und doch alles da. Nirgendwo fliegt Müll herum, vielmals wird auf Plastiktüten verzichtet, ein Staudamm am wasserreichstem Fluss Chiles, dem Rio Baker, durch zivilen Protest verhindert. Umweltschutz wird (mittlerweile) groß geschrieben in Patagonien, bringt der naturnahe Tourismus doch berufliche Perspektiven und damit die junge Generation wieder zurück in die Region.
Wir übernachten im Garten von Polizist Jorge. „Hast du überhaupt irgendetwas zu tun hier?“, lachen wir. „Un pocito. Hauptsächlich Viehdiebstahl. Meist flüchten die Gauner über die grüne Grenze nach Argentinien, dann müssen wir mit den Pferden auf Suche gehen.“ Das Leben hier sei entspannter als im dichter besiedelten Norden, nur im Winter verdrückt er sich, „dann frieren die Wasserleitungen zu.“
Plötzlich endet der Asphalt. Wir passieren einen gewaltigen Erdrutsch, der ganze Berg scheint ins Tal geflossen zu sein. Eine kilometerlange Paste aus verbackenem Schlamm, daraus ragen zerborstene Bäume, busgroße Felsen, irgendwann Dächer: Ein halbes Dorf liegt unter dem Geröll begraben.
An einem Samstag Morgen vor fast genau einem Jahr hört Claris Lärm „wie von einem Bulldozer.“ Sie schaut aus dem Küchenfenster. Schlamm, Autos, die Nachbarhäuser fließen vorbei. Claris ruft Mann, Kinder, Enkel aus den Betten, und während das Geröll die Wände um sie herum eindrückt, den Boden des Holzhauses hebt, umklammert die Familie einander fest. Vier Minuten beten sie zu Gott, dann wird es still. Als sie sich ihren Weg nach draußen bahnen, finden sie das Bettchen des Nachbarkindes an ihre Hauswand gedrückt, darin der tote Junge. Claris’ Haus blieb als einziges im Umkreis von hundert Metern verschont. 23 Nachbarn starben. Und während viele Hinterbliebenen den Glauben an Gott verloren, erklärt sie sich ihr Glück mit dessen Willen: „Gott ist der Souverän.“ Warum er ausgerechnet sie hat überleben lassen? „Weil wir berichten sollen, dass wir ‘en serio’, wirklich an ihn glauben müssen.“ Mit 70 bauen sie und ihr Mann ohne staatliche Hilfe alles wieder auf. Geld gäbe es nur, wenn sie an einen sicheren Ort ziehen würden. Aber hier hätten sie doch alles, Wasser, Natur, Ruhe. Nur die Nachbarn fehlten. Blumen und Bäume hat Claris bereits gepflanzt.
Der Erdrutsch von Santa Lucia war Folge des Klimawandels und der schwindenden Gletscher, es fehlt an Permafrost, der die Bergmassive zusammenkittet. Doch noch steht das Campo de Hielo Sur, das zweitgrößte Gletscherfeld außerhalb der Polarregionen und versperrt Chiles längster Sackgasse den Weg gen Süden – die Carretera Austral endet im Dörfchen Villa O’Higgins. Nach vielen Wochen Sonnenschein erwischt uns kurz vor Weihnachten doch noch das patagonische Schmuddelwetter. Wir bauen am 24. Dezember im Morgengrauen das nasse Zelt ab, preschen sieben Stunden durch den Regen und schaffen es pünktlich zu Heilig Abend per Liveschalte an den Thüringer Gabentisch.
Trotz Hightech-Schalte scheinen wir von gestern, denn entlang der Carretera treffen wir auf eine neue Generation Radreisender, die bereits morgens weiß, wo abends das Zelt steht. Der Grund: Alle richten sich nach ein und derselben App. Zur Erinnerung: Wir sind in der patagonischen Region Aysén, selbst Sibirien ist dichter besiedelt. Oft bietet die Wildnis so viele schöne Lagerplätze, dass wir uns kaum entscheiden können. Viele kommen trotzdem nicht ohne Smartphone aus, das neben den GPS-Koordinaten auch die Nutzerbewertungen der Campingspots ausspuckt. Auf manchen würden laut App sogar „4 Zelte passen“. Das wäre ein Traum, im menschenleeren Patagonien auf’s Nacktduschen verzichten und mit drei weiteren Partien frühstücken, weil sich alle zum gleichen Flecken Wildnis haben navigieren lassen. Wie viele Apps braucht es, ab wann hört das Reisen, das bewusste Sich-Aussetzen, das Ungeplante auf? Wann fängt die Smartphone-geführte Tour an? Einer ruft uns auf dem Weg ins stürmische Feuerland gar noch hinterher: „Keine Chance da unten, ohne die App überlebt ihr nicht!“
Reisebericht Bolivien & Nordargentinien
Bolivien & Nordargentinien
26. September – 30. Oktober 2018 | 990 km, 9.890 hm
Jetzt trifft es auch die Reichen. In La Paz, dem Sitz der Regierung, fehlt das Wasser. Selbst im Villenviertel kommt 2016 kaum ein Tropfen aus dem Hahn. Bolivianer errichten Straßenblockaden, entführen gar Politiker, Geiselnahmen im Kampf um das Kostbarste der Welt. Bolivien hängt am Tropf der rasant schmelzenden Andengletscher und zählt zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern weltweit. Sein sozialistischer Präsident Evo Morales wirft dem Westen eine „historische Klimaschuld gegenüber dem Planeten“ vor, fordert die Abkehr von kapitalistischer Weltwirtschaft und ein internationales Schiedsgericht, das über die Einhaltung der Klimaziele aller Länder wacht. Gleichzeitig weicht der Regenwald den Sojaanbauflächen in seinem Land. An den Salzseen des bolivianischen Hochlands wurde Lithium entdeckt, die größten Vorkommen weltweit. Bolivianer und Chinesen verbrauchen und verseuchen das letzte bisschen Wasser für jenen Stoff, ohne den die Menschheit keine Smartphones hätte.
Bei unserer ersten Reise 2014 empfanden wir die Bolivianer eher als distanziert denn hilfsbereit. Noch immer lassen sich die Marktweiber ungern fotografieren, die Kamera sauge ihnen „die Seele aus dem Körper.“ So der Aberglaube. Doch plaudern wir häufiger miteinander, werden mit Wasser, Benzin für den Kocher und stets einem fröhlichen Winken aus dem Autofenster beschenkt. Vielleicht nehmen wir jedes Fünkchen Freundlichkeit auf den Rädern intensiver wahr, vielleicht waren unsere Ansprüche als in Watte gepackte Hoteltouristen und kindisch fordernde Reiseanfänger damals zu hoch. Vermutlich ist es beides.
Fast haben wir Argentinien erreicht. Noch schnell die letzten Insidertipps des Reiseführers pauken, der Autor weiß: „Ein BH ist Pflicht für Frauen in Argentinien, ebenso wie haarfreie Achselhöhlen und Beine.“ Auch solle die Touristin „derbe sexuelle Anmachen“ schlicht „ignorieren“. So so. Die Brüste hochgeschnallt, ganzkörpergewachst und jeglichen weiblichen Selbstbewusstseins entledigt, passiere ich mit Daniel die argentinische Grenze …
Die Argentinier sind hinterm Steuer gespaltene Persönlichkeiten: bei freier Bahn bejubeln sie uns wie Messi und Maradona, geht es jedoch enger zu, werden wir messerscharf geschnitten. Nach anderthalb Jahren unfallfreier Fahrt wollen wir das Glück nicht irrsinnig kitzeln und weichen auf Nebenrouten aus, die alles sind – außer asphaltiert. Dafür um Welten sicherer und hundertmal schöner als die wenigen geteerten Hauptstraßen.
In Purmamarca packen wir die Essenstasche voll, wieder blicken wir zwei Wochen steiler Passstraßen und Abgeschiedenheit entgegen. Mariella backt noch schnell Empanadas für uns und beschwert sich über die immer heftiger brennende Sonne: „Selbst ich Indigene trage jetzt Sonnencreme auf.“ Ein Satz, den wir in den kommenden Wochen häufiger hören werden.
Beladen mit Essen und 10 Litern Wasser packen wir an einem Tag 2000 m Anstieg, selbst stürmischem Gegenwind zum Trotz. Unser Blut muss von der Überquerung des Altiplano immer noch dick sein wie Erdbeersirup, die Beine Protein gewordener Stahl. Euphorie und das Gefühl, verdammt stark zu sein, halten allerdings nicht lange an. Werden rücksichtslos verdrängt von Verzweiflung, Wut, ja purem Hass.
„Die bekloppteste Piste der Welt“, das wäre mal ein Weltkulturerbe der Unesco! Den Preis gewinnt die „Straße“ entlang der Salinas Grandes. Knöcheltiefer Schotter, Sand, fußballgroße Felsen und ein Wellblech, dass die Bandscheiben aus den Fächern springen. Auf gerader Ebene rattern wir mit fünf Kilometer in einer Stunde, knapp hundert liegen noch vor uns. Mit Karacho trete ich gegen die Radtaschen, will meine Wut herauspfeffern. Daniel verflucht – wortwörtlich zähneknirschend – die sandbeladenen Gegenwinde. Völlig entnervt beschließen wir, die Andenrunde abzubrechen.
Just in diesem Moment hält ein Kleinbus und heraus purzeln lauter Sympathikusse. Nicht, dass wir die schweizer und deutschen Touristen persönlich kennen würden – doch jeder hält eine andere prickelnde Gabe in der Hand: der erste eine Gallone Wasser, die zweite Cola, die dritte Chips und der vierte eisgekühltes Bier – Halleluja! Als wir uns abends im Zelt zuprosten, fällt die Entscheidung leicht: die geplante Runde ziehen wir durch!
Vor uns liegt der höchste Pass Argentiniens, gar einer der höchsten weltweit: Abra del Acay. Gleich einer endlosen Spaghetti windet sich die Straße stetig bergan. Eigentlich wären wir ganz fix oben mit der Fitness unseres Lebens, doch holt mich die erste Erkältung seit über einem Jahr endgültig ein. Mit verstopfter Nase, Angina und high von Schmerzmitteln keuche ich hinter Daniel hinauf. Zähle Pedaltritte, um mich zu fokussieren, mache pedantisch alle 500 m eine kurze Verschnaufpause und sage mir immerfort, dass ich bessere Zeiten erst durch schlechtere verdienen muss. Psychospiele mit Erfolg. Nach vier Stunden erreichen wir den Pass, 4.995 m. Vor unseren Augen das Sinnbild der Menschheit: neben Marienfiguren liegen zerbrochene Bierflaschen, flattern Klopapierfahnen im Wind.
Am nächsten Morgen erwacht Daniel in moribunder Qual: Männergrippe. Mich plagt zur Erkältung nun noch eine Gürtelrose, ein Ruhetag muss her. Hotelengel Pepe hat ein Herz für Rotznasen, gibt uns das Zimmer zum halben Preis. Er wäre heute nicht hier, hätte sein Vater nicht das schlimmste Erdbeben der Umgebung überlebt. 1930 feierten die Dorfbewohner am Heiligen Abend das gute Erntejahr, einen Wimperschlag später waren nur noch eine Handvoll von ihnen am Leben. Darunter der Vater. Angst vor dem nächsten Desaster hat Pepe dennoch nicht: „Ich will doch das Leben genießen. Angst macht unfrei!”
Gelassen sieht auch Bauer Milagro der tektonischen Gefahr entgegen. Wovor er denn sonst Angst habe, wenn nicht vor dieser permanenten Bedrohung? Ohne Zögern antwortet er: „Vor dem Wassermangel.“ Der Alltagsheld zieht vier Kinder groß, pflegt seine Eltern, doch ob der Fluss noch bis an sein Lebensende Wasser führen wird? „Veremos.“ Mal sehen … Andere Ländereien habe er keine. Mariella, Milagro, selbst die zahnloseste Alte weiß um den „cambio del clima“, hier wie in Chile und Bolivien sowieso. „La contaminación“, Fabriken und Plastikmüll seien daran schuld, doch keiner zeigt auf uns, die Hauptverursacher.
Wasser, Nahrung, Öl, Holz, Bodenschätze. Ein Gefühl verfolgt mich auf dieser Reise mehr als jemals zuvor. Die fiese Gewissheit, mit meinen Konsum anderen Menschen etwas wegzunehmen. Nicht geldbringende Touristin, sondern Diebin, Gaunerin zu sein. Jede heiße Dusche löst neben enormer Befreiung inzwischen Gewissensbisse aus, jeder Plastikbeutel, der mir aus den Händen fliegt, panisches Hinterherrennen. Avocados haben wir ganz gestrichen, weil ein Kilo mehrere hundert Liter Wasser im Anbau verschlingt, den Menschen hier raubt.
Allein der Flug nach Santiago blies knapp drei Tonnen Kohlendioxid in die Luft, das entspricht fast der Hälfte unseres gesamten Jahresverbrauchs. Schon dieser Flug macht tausende „grüne“ Radkilometer zunichte. Doch was ist die Lösung? Uns das Fliegen verbieten, die Anzahl der Stempel im Reisepass limitieren? Andreas Altmann, der weltenbeste Reisereporter, schreibt: „Nur ein Einziges entscheidet über den Wert einer Reise und den Sinn des Fortgehens: die mitgenommene Neugier, der Wissensdurst, die Freude am Entdecken, der Hunger nach allem.“ Neugier meint nicht Sonne tanken, Yoga, bummeln, essen, shoppen, „mal raus kommen“. Neugier bedeutet all das zur Not links liegen zu lassen, um Land und Leute auszukundschaften. Legte man den Maßstab der Neugier zugrunde, würde das vermutlich schon die Hälfte aller touristischen Flüge einsparen.
Staunend verrenken wir die Hälse, bis der Nacken schmerzt: 12 Meter hoch ragen die Kandelaberkakteen des Parque Nacional de Los Cardones in den Abendhimmel. Stark wie Bäume, mehrere Tonnen schwer und mit fürchterlich langen Dornen. Es fällt schwer, einen Lagerplatz zwischen all den stacheligen Gewächsen zu ergattern, und natürlich handeln wir uns zerstochene Reifen und Isomatten ein.
Nach sieben Wochen in extremer Trockenheit und Höhe können wir keinen Wind, keinen Sand, keine Kälte mehr ertragen. Eine lange Abfahrt führt endlich zurück ins Paradies: dicke, warme, feuchte Luft, Bäume, ja richtige Wälder, BASF-Felder, selbst Bananenstauden und Palmen schmücken die Gegend um Salta.
Daniel wünscht sich Gehacktes, ich als Vegetarierin wage mich zum Fleischer, ziehe eine Nummer wie auf dem Bürgeramt und setze mich auf die Wartestühle inmitten des Supermarktes. Denn der Gang zum Metzger, dem wichtigsten Verkäufer des Landes, ist kein bloßer Akt, sondern hingebungsvolle Prozedur, die Vorbereitung zum wichtigsten Mahl der Woche: dem Asado, Rindersteaks auf dem Holzkohlegrill. Vor lauter dummen Fragen entschuldige ich mich beim Verkäufer, ich sei Vegetarierin. „Ich auch.“, erwidert Nicolas. Und ich zweifele an meinem Spanisch. Der Fleischer selbst ein Vegetarier – wie um alles in der Welt konnte das passieren? Nicolas erzählt die Geschichte vieler junger Argentinier. Als Informatiker finde er im krisengebeutelten Land keine Arbeit, habe jeden Job genommen, der ihm geboten wurde. Heute ist er also Fleischer.
„Man muss flexibel bleiben“, lächelt unser Zimmervermieter José verschmitzt, die ständigen Wirtschaftskrisen forderten permanente Anpassung, kein Beruf sei sicher. Er selbst verkauft Autos, seit längerem jedoch nur schleppend. Deswegen sattelt er jetzt um auf nackte Haut: „Ich eröffne bald zwei Dessousläden und einen Pornoshop, das geht immer. Aber wichtig ist, dass wir das Zeug auch online anbieten, hier im katholischen Argentinien traut sich nicht jeder persönlich in den Laden.“ Die Wirtschaftskrisen Argentiniens sind ein Kapitel für sich – doch wer die Schuld daran trage, da antworten alle mit den exakt gleichen Worten. „¡Porque los politicos nos roban todos!“ Die Politiker bestehlen uns alle! Was José dann von der Wahlpflicht in seinem Land halte? „Gäbe es keine Pflicht zum Wählen, würde es keiner mehr tun.“
Systemkonform wollen wir am nächsten Tag die Busfahrer bestechen, um mitsamt den Rädern ins weit entfernte Mendoza zu gelangen. Schon am Eingang zum Bahnhof wetzt uns ein pummeliger Zwerg entgegen, in zerfledderten Jeans, mit schwarzen Fingernägeln. Pepe meint – augenzwinkernd – die Räder müssten per Post versandt werden, zufällig arbeite er dort, werde die guten Stücke in Kartons packen und die Busfahrer zur Mitnahme überreden. Wir wittern einen Trick, kaufen die Tickets und wollen die Steuermänner lieber selbst bestechen. Doch in diesem Land, in dem Polizisten, Ärzte, Politiker, Lehrer so selbstverständlich geschmiert werden wie die Jungfrau Maria heißt, erweisen sich ausgerechnet die Busfahrer als nicht käuflich. Nein, Räder seien im Gepäckraum verboten, da nütze auch kein Schmiergeld. Der Bus fährt ohne uns. Niedergeschmettert entschuldigen wir uns bei Pepe für unser Misstrauen, der Gute packt die Räder ein und regelt den Transport. Was haben wir den kleinen Mann unterschätzt, aus Scham verdoppeln wir sein Trinkgeld! Noch während wir auf die Abfahrt warten, spricht uns eine gut gekleidete Frau an, versucht uns mühsam ein Gespräch ans Bein zu nageln. Just in diesem Moment streunt ein Teenager um die Räder – die übliche Diebesmasche, eine lenkt ab, der andere stiehlt. Als die Frau erfolglos von dannen zieht, ist auch der Junge verschwunden.
Man halte also fest: einem kleinen Postboten in zerschlissener Kleidung kann man trauen, gut gekleideten Damen nicht. Polizisten besticht man, Busfahrer nicht. Verstehe einer die Spielregeln dieses Landes!
In Mendoza absolvierte Daniel 2010 einen Teil seines praktischen Jahres im öffentlichen Krankenhaus der Stadt. Verändert hat sich wenig. Schon damals bröckelte der Putz, pfiff der Wind durch die zerbrochenen Fenster. Erinnerungen an überfüllte Zimmer mit acht, zehn Patienten. Junge Kerle mit gebrochenen Beinen, die sich keine Operation leisten können und sieben Wochen auf der Streckbank liegen: einen Nagel durch die Ferse, daran ein Ziegelstein, so werden die Frakturen der Armen gerichtet. Morgens Tee mit trocken Brot, mittags auch, abends sowieso. Fast täglich werden Opfer der Bandenkriege eingeliefert, manchmal von Angehörigen in der Schubkarre angeschleppt, mit literweise Blut ausgekippt, auf’s Übelste zugerichtet und in diesem Krankenhaus sowieso schon tot. Es mangelt an Medikamenten, Papier, Kugelschreibern. Die Ärzte arbeiten morgens im öffentlichen Krankenhaus und nachmittags in den privaten, um überhaupt Geld zu verdienen. Und in Deutschland? Beschweren sich Patienten über’s Essen …
Die maroden Krankenhäuser sind nur ein oberflächliches Symptom der seit Jahrzehnten schwelenden Wirtschaftskrisen. Argentinien zählte zu den reichsten Ländern der Welt, exportierte während der Weltkriege Wolle und Fleisch ins zerstörte Europa. Fallende Weltmarktpreise, Misswirtschaft, Korruption und Sparmaßnahmen in allen sozialen Bereichen trieben das Land 2001 in die sogenannte „Tango-Krise“. Banken wurden geschlossen bis die Ersparnisse der Kunden keinen Wert mehr besaßen. Bis heute versickern Hilfsgelder in löchrigen Hosentaschen der Staatsbediensteten, fehlt ausländischen Investoren das Vertrauen, taumelt das Land von einer Krise in die nächste. Im reichen Nachwende-Deutschland geboren, konnte ich mir bis dato nicht wirklich vorstellen, wie es den Alltag verändert, wenn die Inflationsrate 30, oder gar 40 Prozent übersteigt, sich die Preise für Strom, Gas und Wasser innerhalb eines Jahres verfünffachen. Überall trübe Gesichter, kaum eine Spur südamerikanischer Leichtigkeit. Der argentinische Peso verlor die Hälfte seines Wertes, der Dollar kostet nun doppelt so viel, Kleidung, Elektronik, Lebensmittel, alle Importprodukte verteuerten sich in diesem Jahr quasi über Nacht. Kleiner Mann – was nun?
So wenig wie den Politikern und Richtern vertrauen die Argentinier ihrem eigenen Geld. Dollarscheine werden unter dem Kopfkissen versteckt oder das verdiente Geld gleich in Autos, Kühlschränke, Smartphones investiert – keiner bringt seine Ersparnisse zur Bank. Und das System ist umständlich: Viele bezahlen noch immer Miete, Strom- und Telefonrechnung in bar, einen halben Tag Arbeitszeit raubt das Schlangestehen. Obendrein lähmt die tägliche Siesta Menschen wie Wirtschaft. Zwischen zwei und sechs Uhr haben Apotheken, Geschäfte, Banken geschlossen, die Welt steht still. Nichts geht, alles schläft. Einmal explodiere ich, eine halbe Stunde an der (kaputten) Kasse wartend: „Señora, ich verliere Lebenszeit!“ Die Señora lacht nur.
Ein Teufelskreis der Lethargie und Korruption, in dem jeder jeden für die miserable Lage im Land verantwortlich macht und doch alle dazu beitragen. Ein Leben in permanenter Unsicherheit. „Ich bin müde von den vielen Krisen“, meint Eric, Daniels ehemaliger Zimmerkollege. Eigentlich studierte er Geschichte, heute hat er, wie viele seiner Altersgenossen, mehrere Jobs: ist Sommelier, vermietet Cabañas, tischlert. Bald wird er nach Chile gehen, auf einem Weingut sein Geld verdienen.
Die steigende Armut treibt viele in die Kriminalität. Ab zehn Uhr ziehen Banden durch ihre Viertel, nimmt man besser ein Taxi selbst für kurze Strecken. Daniels ehemalige Freundin Theresia arbeitet in Mendoza als Kindertherapeutin. Viele ihrer jungen Patienten seien verhaltensauffällig, weil die Eltern Drogen konsumierten oder im Gefängnis schmorten. Auch der Machismo, die Degradierung der Frau, potenziere die häusliche Gewalt.
Während wir uns unterhalten, schmettert ein Straßenmusiker Folklore. Plötzlich stimmt ein Passant mit ein, voller Inbrunst und Emotion, ohne Scham und Scheu. Auch das ist Argentinien, das offen Leidenschaftliche, das nach außen hin Gefühle zeigende. Keinem zwickt hier ein Stock im Hintern und alle lachen, wenn wir den deutschen Tanzklassiker schlechthin vorführen: den „Thekensteher.“
Reisebericht Atacama & Altiplano
Atacama & Altiplano
25. August – 26. September 2018 | 900 km, 8.710 hm
Sofort packt uns Santiago de Chile, lässt uns keine Zeit, das Erlebte in Nordamerika zu verdauen. Wir gönnen uns ein kleines Apartment, wollen uns verkriechen in Privatsphäre, langsam an Chile herantasten, Freunde wiedersehen. Nichts da! Für den googlenden Reisenden gibt es keine Gnade.
Bei Recherchen zur Pinochet-Diktatur wirft mir die Suchmaschine ein Foto unserer Air-BnB-Gastgeberin entgegen. Constanza sucht Eltern, sucht Töchter und Söhne. Während des Militärregimes in den 70er und 80er Jahren wurden die Kinder getöteter Oppositioneller verkauft. Ein Markt entwickelte sich, Ärzte, Hebammen, Sozialarbeiter, Richter, Politiker beteiligten sich am Menschenhandel. Verkauften nun auch Neugeborene mittelloser Eltern und hielten sie in dem Irrglauben, ihre Babys seien kurz nach der Geburt verstorben. Nachdem Constanza erfuhr, dass sie selbst verkauft wurde, gründete sie die Organisation „Nos buscamos“ („Wir suchen uns“). Constanza und ihr Team aus Ehrenamtlichen fahnden nach Geburtsurkunden und Akten, welche die wahren Eltern auflisten, arbeiten mit einem DNA-Labor zusammen. Überall hin wurden die Kinder geliefert, in die USA, nach Schweden, Deutschland. Bisher haben sich mehr als 3.500 Suchende in ihrer Organisation registriert, 32 Familien führte sie bereits zusammen, zuletzt verhalf sie einem in Chile geborenen Kalifornier zurück zu seinen Wurzeln. Ich versetze mich in die Lage seiner Mutter, der Constanza telefonisch beibrachte: „Ihr Junge lebt und sucht nach Ihnen.“ Einmal mehr auf dieser Reise schlucke ich Tränen. „Immer, wirklich immer, wenn ich öffentlich oder auf privaten Partys über Nos Buscamos spreche, ziehen mich anschließend Gäste zur Seite, die selbst auf der Suche nach ihren Eltern oder Kindern sind.“ Staatliche Zuschüsse für die Organisation hat sie hart erkämpft. Eine, die nicht nur Haltung zeigt, sondern handelt.
Constanza (unten rechts) mit ihrer wiedergefundenen Familie. Quelle: www.paula.cl.
Seit unserem letzten Besuch in Santiago 2014 hat sich allerhand gewandelt. Auffällig viele Schwarze verkaufen heute Tand und Snacks in den Straßen. Die vorherige sozialistische Präsidentin Bachelet öffnete die Grenze für Haitianer, die nach den Venezolanern die zweitgrößte Einwanderungsgruppe stellen. Und kaum Anschluss finden. „Als ich vor ein paar Jahren den ersten Schwarzen in meinem Leben hier sah, konnte ich nicht anders, als ihn anzustarren“, meint eine chilenische Freundin. Die aktuelle rechtskonservative Regierung um Piñera fährt zweigleisig: Sie wirbt die meist gut ausgebildeten, Spanisch sprechenden Venezolaner an, setzt jedoch die Hürden für Haitianer höher. Seit 2014 hat sich die Zahl der Migranten verdoppelt, mitunter kamen 30.000 Einwanderer pro Tag ins Land.
Und noch etwas fällt auf: In den Supermärkten sind viele Produkte mit Warnungen bedruckt: Achtung Zucker, Fett, Kalorien! Das zunehmend übergewichtige Chile hat eines der strengsten Gesetze zur Kennzeichnung und Werbung von Lebensmitteln weltweit eingeführt. Auf zuckerhaltigen Müslis dürfen nicht einmal mehr bunte Comicfiguren abgedruckt sein.
Nach einer Woche Radelfrei wollen wir weiter. „Da wart ihr doch schon?“, erinnert sich eine Bekannte, als wir von unserem Plan berichten, die sogenannte „Lagunenroute“ zu fahren. Recht hat sie, allerdings sind wir 2014 in geführter Tour im Sechsmann-Touristenjeep durchgepeitscht. Diesen Augenschmaus wollen wir noch einmal auf dem Rad erfahren. Das Rahmenprogramm klingt so verlockend wie abschreckend: Die Strecke führt von der Atacamawüste ganz im Norden Chiles hoch in das Altiplano Boliviens entlang unzähliger Lagunen und Vulkane zum Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Erde. Dazwischen liegen 440 Kilometer Sand- und Schotterpiste, Geröllfelder, Vulkan- und Salzwüste. Viele namenlose Pässe führen bis in knapp 5.000 m Höhe. Sauerstoff, Wasser und Nahrung sind – na klar – knapp.
Die Atacama erstreckt sich vom Süden Perus bis weit nach Chile, über 2.000 Kilometer Lebensfeindlichkeit. An manchen Orten hat es seit Menschengedenken, wahrscheinlich sogar seit mehreren tausend Jahren, nicht mehr geregnet. Der kalte Humboldtstrom im Westen verdunstet zu wenig Wasser, das sich abregnen könnte, und die hoch aufragenden Anden im Osten verhindern ein Hinüberschwappen feuchter Luft aus den Wäldern des Tieflandes. Umgeben von Wasser, und doch davon abgeschnitten: die trockenste Wüste der Erde.
Während der gut hundert Kilometer langen Fahrt von Calama nach San Pedro zähle ich eine Eidechse, zwei Fliegen und ein paar Büsche, ansonsten flimmert nur Sand vorüber, Schotter und verbackener Lehm. In der Pause schmiere ich ein Brötchen, das währenddessen schon zu Knäckebrot verdorrt. Abends kämmen wir uns Salz aus den Haaren, obwohl wir gar nicht merkten, dass die Haut überhaupt je feucht wurde. Die Lippen platzen auf wie Blätterteig, Bronchien und Schleimhäute wehren sich gegen das ungewohnte Klima. Schnaufend liegen wir im Schlafsack und haben nicht einmal 70 Kilometer geschafft. Zweifel kommen auf.
In San Pedro verbringen wir die Zeit mit der Suche nach möglichst energiereicher Nahrung, jede Kalorie pro Gramm zählt. Als Geheimwaffen entpuppen sich Butter, Parmesan und Dulce de Leche, der hier übliche karamellähnliche Brotaufstrich. Um unseren Kreislauf an die Höhe anzupassen, fahren wir zum Vulkan Lascar, dem aktivsten Nordchiles. Die Akklimatisation wird sich später bezahlt machen, bis auf Verdauungsstörungen und leichte Schlafapnoe wird uns die Höhenkrankheit verschonen.
„¡Vamonos – auf geht’s ins Altiplano!“ Von San Pedro führt eine steile, serpentinenlose Rampe in nur 42 Kilometern in über 4.600 m Höhe. Die klare Luft lässt die Dimensionen schrumpfen und wachsen zugleich, Entfernungen sind kaum schätzbar. Die Räder bleischwer bepackt, mit Nahrung für acht Tage und zehn Extralitern Wasser. Wir erliegen dem Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. Es ist, als würde man den ganzen Tag auf einem Ergometer sitzen und auf ein hübsches Landschaftsbild starren. Nach acht Stunden sind wir oben und passieren zugleich die Grenze Boliviens.
Seit mindestens 30 Millionen Jahren schiebt sich die ozeanische Nazca-Platte unter ihren östlichen Nachbarn, ein bis heute andauernder geologischer Prozess, der die Südamerikanische Platte an ihrem Rand immer weiter in die Höhe treibt und jene spektakuläre Berglandschaft bildet, die wir als Anden kennen. Die Abertrillionen Tonnen aufgeschmolzenen Gesteins fanden ihr Ventil in hunderten Vulkanen: Mal aufgereiht wie an einer Perlenkette, mal verstreut wie Pockennarben, die meisten erloschen, manche über 6.000 Meter hoch. Mittendrin bildete sich eine ausgedehnte Schüssel: das Altiplano. In der abflusslosen Senke konzentriert sich der Niederschlag der umliegenden Berge in bunten Lagunen. In den extrem salzigen und schwermetallhaltigen Gewässern können nur besonders robuste Mikroorganismen überleben.
Die Lagunenroute ist berüchtigt für ihre fürchterlichen Pisten. Ein Potpourri aus Wellblech und sandigen Wegen in allen nur vorstellbaren Zerfallsstadien, je nach Untergrund mal besser, meist jedoch schlechter fahrbar. Anhand der Staubwolken entgegenkommender Geländewagen versuchen wir zu erraten, welche Spur über festen Grund verlaufen wird, wechseln ständig die Seite, müssen absteigen und durch den tiefen Sand schieben, wieder für wenige Meter auf den Sattel, und so weiter. Ein kniffliges Taktikspiel – jeder gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer.
Vier Stunden wärme ich meine traktierten Muskeln in einer heißen Thermalquelle am „Straßen“rand auf. Irgendwann steigt ein Spanier dazu und der siebte Sinn trügt nicht: Pedro ist kein normaler Jeeptourist, sondern auf der Suche nach UFOs. Jetzt ist Feinsinn gefragt, wie erfährt man Details ohne ihm auf den Schlips zu treten? Schließlich will ich Daniel und mir die Viertelstunde Lachen gönnen, die wir laut Apothekenumschau täglich brauchen. Je naiver meine Fragen, desto mehr kommt Pedro in Schwung, ahmt energisch mit zwei Händen die Blinksignale der UFOs nach, singt Mantren, mit denen ich sie anlocken könne, verrät, er spüre hier Aliens überall. Der Energieling ist ganz eins mit der Natur, nimmt ein Billigshampoo, wäscht sich mit viel Schaum in der streng geschützten Quelle die Haare, und schaut dabei zu, wie die Energie der Chemikalien und die Chemikalien selbst direkt in die Lagune zu den Flamingos fließen …
Unser schöner Plan, die vorherrschenden Südwestwinde auszunutzen, scheint zunächst aufzugehen. Doch bereits am Abend künden Lenticularis-Wolken von einem Wetterwechsel, und tatsächlich: Die Vorhersage lässt einen orkanartigen Gegensturm mit Spitzengeschwindigkeiten von 110 km/h für den nächsten Tag erwarten. Um der gröbsten Thermik zum entgehen, starten wir schon im frostigen Morgengrauen. Eine kräftige Brise bläst von vorn, die gefühlte Temperatur sinkt auf -10 °C. Wenigstens geht es steil bergauf und uns wird warm. Erste Böen pusten mich vom Rad. Immer stärker wird der Sturm und schickt meterhohe Staubwände in unsere Richtung, bis die Zähne knirschen. In knapp 5.000 m Höhe kämpfen wir uns im ersten Gang durch den brüllenden Wind, kurbeln gegen eine unsichtbare Pranke, die an den Klamotten, Haaren, allem reißt, uns an den Armen packt und ins Gesicht schlägt. Alle paar Minuten müssen wir anhalten, einen sicheren Stand suchen und den Kopf unter die Achsel stecken, um uns vor dem Gröbsten zu schützen. Über vier Stunden benötigen wir für 22 Kilometer – Negativrekord.
Da war das Wetter noch besser.
Endlich biegt die Straße nach rechts, in die vermeintliche Sicherheit des Seitenwindes, und verläuft sich in unzähligen, nutzlosen Spuren eines Geröllfeldes. Die seitlichen Böen finden an den großen Fahrrädern eine noch bessere Angriffsfläche, werfen uns hin und her, vor und zurück, als würde man Spießrutenlaufen und jeder tritt mal kräftig dagegen. Wir hoppeln wie zwei Karnickel auf Speed über das Geröll, bis ich entnervt aufgebe und schiebe, ach, mich in den Dreck setze und fluche. Ich verfluche den Wind, die Kälte, die Armut Boliviens, das sich kaum Straßen leisten kann, aber am meisten verfluche ich mich selbst, dass ich mich auf dieses Himmelfahrtskommando überhaupt eingelassen habe, ich Idiot!
Ein Schweizer Pärchen im Geländewagen hält neben uns, Dahe kurbelt das Fenster herunter. „Voll geil, wenn ich mal groß bin, mache ich das auch!” Ich bin mir nicht sicher, ob er das ernst meint. „Wenn du blöd genug bist, nur zu…”, erwidere ich bitter lächelnd. Ehe ich mich wehren kann, stecken 100 Dollar in meiner Jackentasche. „Trinkt einen auf mich, wenn ihr in der Zivilisation angekommen seid!”, aufmunterndes Schulterklopfen gibt es obendrein. Extrem beschwingt von soviel Zuspruch und mit der Aussicht auf ein deftiges Essen, eine Flasche Wein und zwei Kilo Schokolade schieben wir weiter.
Hier gibt es eine kleine Herberge, die Wirtin schenkt uns mitleidsvoll ein warmes Mittagessen, ihr Mann will wissen, welche Länder wir bereits besucht haben. Als ich bei den USA angelange, stellt er mir eine Frage, die mich fast von der Bank fegt: „Dort sterben die Meerestiere, weil der Ozean verschmutzt ist, richtig?“ Er lebt an einem der trockensten Orte der Erde und ich bezweifle, dass er je einen Fisch in Natura gesehen hat. Trotzdem kümmert ihn das Sterben der Meerestiere. Wer von uns schert sich um ihn, dem der Klimawandel das Wasser raubt?
In den wenigen Herbergen unterwegs bemutteln und bevätern die Bolivianer uns, lassen uns kostenfrei übernachten, schenken uns Obst und Brot, obwohl sie täglich viele Touristen bewirten. Auch die Urlauber selbst vermachen uns die meist üppigen Reste ihres Abendbuffets, wir könnten essen für zehn! Wir sind unendlich dankbar für jedes liebe Wort, für jede Hilfe der Einheimischen und anderer Touristen, die uns unterwegs unzählige Motivationsspritzen injizieren. Ob wir es ohne sie gepackt hätten?
Nur einen Anstieg nach der Lagune beginnt die Siloli-Wüste, ein himmelweites Meer aus Schutt und Kies, wir winzig darin wie ein Stäubchen auf einem Körnchen Sand. Wir trauen uns nicht ohne zwei GPS-fähige Smartphones mit detaillierten Offline-Karten, Papierkarten und Kompass hierher, und obwohl die Navigation deutlich einfacher als früher ist, verfransen wir uns im Nirgendwo. Es bleibt nichts anderes, als ungeschützt auf 4.700 m zu zelten. Als die Sonne hinter den Bergen versinkt, fällt das Thermometer fast augenblicklich unter den Gefrierpunkt. Weit darunter, bis auf -15 °C. Vorsorglich verstauen wir die kälteempfindliche Elektronik und etwas Wasser für den nächsten Tag im Innenzelt. Am Morgen treiben mich keine zehn Lamas aus der Molligkeit der Daunen, bevor nicht die Sonne das Zelt auftaut. Die Schlafsäcke sind mit einem Panzer aus gefrorenem Kondenswasser überzogen, Raureif rieselt auf nackte Haut, die Zahnpasta ist zu Kaugummi erstarrt. Rein in die knochenharten Stiefel, Zähneputzen mit Eiswasser. Die Radtaschen sind so steif, dass die Finger bluten und selbst das Kocherbenzin so kalt, dass es kaum brennt.
Nach neun Tagen steigen wir allmählich herab und erreichen die Salzpfannen am Fuße des Altiplano, endlich wird die Luft wärmer und dicker. Pünktlich zum Sonnenuntergang frischt die Thermik noch einmal auf, und als wir das Zelt im Wind verankern wollen, wird klar, was wir vergessen haben: einen Stein! Wer hätte auch geahnt, dass es plötzlich an Steinen mangelt? Keine Chance, die Heringe in den harten Boden zu hämmern, also binden wir die Räder ans Zelt und hoffen auf das Beste.
Salar de Uyuni, der Salzsee von Uyuni. Schon sein Name lässt die Ohren klingeln und es gehört wohl zu den unverrückbaren Träumen einer jeden Radlerseele, einmal im Leben über seine unendlichen Weiten zu rollen. Wobei „unendlich weit“ nicht einmal metaphorisch gemeint ist: hundert mal hundert Kilometer, 10.000 Quadratkilometer misst der größte Salzsee der Erde und ist damit halb so groß wie Sachsen-Anhalt. Wer in seiner Mitte steht, sieht weiß, egal in welche Richtung.
Unser Ziel ist die Isla Incahuasi, Spitze eines erloschenen Vulkans, die aufgrund der Erdkrümmung vom Ufer aus allerdings nicht sichtbar ist. Dem Kompass folgend tauchen nach zwanzig Kilometern die ersten Umrisse auf, nehmen Kontur an, formen sich zu Kakteen und Felsen. Sie bietet Schutz, denn – kaum vorstellbar – auf dem See zu zelten, ist nicht ganz ungefährlich. Bolivianische Drogenschmuggler rasen unbeleuchtet durch die Nacht Richtung Chile, viele Fahrer der Tourjeeps tun es ihnen nach, um ihren Gästen einen besonderen Nervenkitzel zu bescheren. Immer wieder kommt es zu tödlichen Zusammenstößen.
Und das Salz ist keineswegs überall kompakt: Während der Regenzeit füllt sich der Salar, steht das Wasser knöcheltief und verdunstet im Laufe des Winters. Nun, während der Trockenzeit, ist die Oberfläche meist trocken und fest, doch der Wasserspiegel liegt nur wenige Zentimeter darunter. Das Salz schwimmt darauf wie eine Eisdecke. An manchen Stellen stehen Pfützen, an anderen bilden sich große Löcher, so tief, dass man deren Ende nicht sieht.
Die Mitte der Salzpfanne ist betonglatt, als rolle man über ein Blatt Papier, die Kristalle knuspern schön wie Kekskrümel. Je näher wir aber dem Ufer kommen, desto schlechter wird die Spur, ist oft nass und rau wie überfrorener Schneematsch, erinnert meist aber an in Porzellan gegossene Kiesel. Wie ein winziger Radfahrer, der über Legosteine rüttelt. Die ersten Schrauben fliegen vom Rad, der Kocher zerlegt sich selbständig, nach 60 Kilometern sieht der Inhalt der Lenkertasche aus wie durch den Betonmischer gedreht.
Mit tauben Händen und den Hintern bis ins Hirn gehämmert erreichen wir Uyuni. Was uns während unseres letzten Besuchs vorkam wie das letzte Kaff auf Erden, erscheint nun wie deren pure Verheißung. Wir schwelgen in den Annehmlichkeiten der Zivilisation, genießen ein richtiges Bett und dieses Loch in der Wand, aus dem heißes Wasser kommt, man nennt es wohl „Dusche“, und verstopfen fast den Abfluss.
Wir lesen noch einmal unseren Blog aus 2014, als wir die gleiche Route im beengten Geländewagen unternahmen. Binnen zwei Tagen wurden wir zum Ziel gekarrt. Dem Altiplano widmeten wir damals genau einen Abschnitt, heute füllen wir Seiten. Verliebt und millionenfach dankbar lächele ich mein Fahrrad an. Wie viel intensives Erleben, intensives Leben du uns doch schenkst!
Reisebericht Kalifornien II
USA - Kalifornien II
26. Juli – 25. August 2018 | 1.000 km, 9.650 hm
Mit – kein Witz – erhobenen Händen wagten wir uns etwa 70 Mal auf amerikanische Privatgrundstücke, um nach einem flauschigen Stück Rasen für unser Zelt zu bitten. Nur einmal reagierte der Eigentümer fuchsteufelswild. Keiner zog seine Knarre. Heute öffnet der Jackpot die Tür: die “Bezaubernde Jeanne”! Ein wahrlich guter Geist, denn sie bewirtet hauptberuflich auf Hochzeiten. Jeanne jubelt: “Come on in and have a drink!”, als hätte sie den ganzen Tag auf nichts anderes gewartet als zwei verschwitzte Radfahrer. Schwups hat sie Caipirinhas gezaubert und die mundgerechten Snacks einer Catering-Königin vor uns drapiert. Heiß duschen können wir auch. Und so eingemummelt in Gastliebe kann der Tag nicht wärmer enden!
Jeanne weiß, dass eine durchschnittliche Hochzeit in den USA 30.000 bis 50.000 Dollar kostet. Oft schon wurde mir in den letzten Monaten schwindelig angesichts der Beträge, mit denen hier bereits junge Erwachsene rechnen: eine Physiotherapeutin zahlte 100.000 Dollar für ihr Studium, ein Arzt mehrere Hunderttausend. Der übliche Pickup-Truck kostet 50.000, lediglich Häuser scheinen mit 100.000 bis 150.000 etwas günstiger. Im dürregeplagten Kalifornien bohrt man zudem regelmäßig, ob legal oder illegal, den eigenen Brunnen tiefer – für weitere 100.000 Dollar. Dazu sind die Häuser mit allem ausgestattet, was Mensch nicht braucht. Kein Single hinterfragt den wandschrankgroßen Kühlschrank, elektrische Korkenzieher und Eiswürfel-Dispenser gehören zur Grundausstattung und selbst in den trockenheißen Wüstenstaaten rumpelt der Trockner rund um die Uhr – es ist eben einfacher, die Wäsche von einem Loch ins nächste zu stecken, als mühevoll im Hof aufzuhängen. Der Zwang zum Unnützem, zum Horten von Ramsch bis das Haus platzt, ist auch durchs Camping nicht therapierbar. Ziemlich „outdoorsy“ sind die Amerikaner, doch selbst auf dem Zeltplatz müssen einige ihr gesamtes Spielzeug mitnehmen: Der Wohnwagen in Omnibusgröße reicht nicht aus – dieser zieht meist noch einen „Klein“wagen und der wiederum einen Anhänger mit Fahrrädern, Harleys und Boot. Selbst ein Flugzeug auf dem Trailer ist schon an uns vorbeigedüst. Stolz berichten manche, ihr ganzes Haus für das Camperleben verkauft zu haben: „Ich hätte nie gedacht, mit so wenig auszukommen.“ Ein Blick in das Wohnwagenschloss und ich weiß: Darin befindet sich mehr, als ich je besaß.
Das alles erzeugt den enormen Druck, Geld im Übermaß zu scheffeln. Amerikaner arbeiten nicht nur mehr Stunden am Tag als der Durchschnittsdeutsche, auch die Anzahl bezahlter Urlaubstage fällt mit etwa zehn pro Jahr mickrig aus. Die Kehrseite des amerikanischen Traums. Viele, die wir treffen, frönen einem Lebensstil, der sie zwangsläufig zu Jongleuren macht. Die sündhaft teure Ausbildung und Hochzeit, Haus und Truck sind der Anfang, immer neue Bälle kommen hinzu, immer höher der Einsatz, und immer schwieriger wird es, das rasante Spiel am Laufen zu halten. Wer bis Mitte 50 durchhält, kann sich wohlverdient zur Ruhe setzen und einen langen Lebensabend im Motorhome genießen. Wer jedoch einen Ball verliert, dem kracht mitunter die gesamte Existenz zusammen. Meist ist dieser entscheidende Ball die Gesundheit: Klinikrechnungen sind die Ursache für zwei Drittel aller Privatinsolvenzen in den USA.
„Meine Kasse wäre mich liebend gern los, die nennen mich ihr Million Dollar Baby!“, lacht ein Kalifornier, dessen Nieren-OP erdrückende 250.000 Dollar verschlang. Ein einwöchiger Krankenhausaufenthalt kostete – wohlgemerkt ohne jegliche Diagnostik oder Therapie – unfassbare 35.000 Dollar. Eine Mutter berichtet von ihrem privaten Spendenmarathon, um den Mindestbetrag von 5.000 Dollar zusammenzukratzen, damit ihre Tochter überhaupt auf die Organspendeliste durfte. Ein anderer beklagt den Verkauf seiner Waffensammlung, um die Krebstherapie der Frau zu bezahlen. Trotz der immensen monatlichen Beiträge für die Krankenkassen bleiben oft eine hohe Selbstbeteiligung und begrenzte Maximalerstattung, Zusatzpolicen und Ausschlussklauseln. Wen wir auch fragen, über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg, der Tenor ist stets der gleiche: „The whole system sucks!“
Dabei geben die Amerikaner mehr Geld für ihre Gesundheitsversorgung aus als jede andere Nation, mehr als doppelt so viel wie die Deutschen. Pharmakonzerne diktieren Arzneipreise und Ärzte verdienen Hunderttausende – auch, um die enormen Haftpflichtbeiträge zu finanzieren und Ausbildungsschulden zu tilgen. Da Krankenhäuser sowohl Gewinne maximieren als auch Notfallbehandlungen für Unversicherte durchführen müssen, werden regulären Patienten Mondpreise abgeknöpft und Notfallambulanzen geschlossen. Die USA zeigen, wie ein weitgehend marktreguliertes Gesundheitssystem scheitert. Uns gruselt, dass Deutschland in die gleiche Richtung steuert – wenn wir uns nicht dagegen wehren.
Wir wollen die wunden Nervenspitzen heilen und flüchten in die Natur, ganz im Norden Kaliforniens. Ihre Stämme schießen wie Nadeln, lang und astlos, über 110 m in die Höhe und überragen damit nicht nur die Freiheitsstatue, sondern locker alle anderen Bäume dieser Erde: die Redwoods. Ihre außergewöhnlich dicke, schwammige Borke macht sie unempfindlich gegen Waldbrände und Krankheitserreger, die schlanke Form trotzt Stürmen über Jahrhunderte – Sequoia sempervirens, der „Immerlebende“, fällt manchmal erst nach 2.000 Jahren dem eigenen Gewicht zum Opfer. Oder Holzfällern: Mitte des 19. Jahrhunderts versiegte der kalifornische Goldrausch und andere Rohstoffe mussten her. Als der Mensch die höchsten Bäume des Planeten entdeckte, tat er, was der Mensch eben tun muss: sie fällen und Hotels draus zimmern. Heute stehen noch 3 Prozent der ursprünglichen Bestände, der Rest wurde zu Bauholz und Zahnstochern verarbeitet. Wir verbringen einige Ruhetage auf dem schönsten Zeltplatz der Reise. Claudia wird plötzlich spirituell, umarmt die Bäume – und schreibt sich die Finger wund: „Das tollste Arbeitszimmer der Welt!“
Als wir die Küste verlassen, bestimmt eine ganz neue Herausforderung unsere Routenplanung: Feuer! Bereits im Juli steht Kalifornien in Flammen. Gewitterwolken gleich rollen Rauchschwaden in die Täler und verdunkeln den Himmel, die Temperaturen fallen spürbar. Glutrot flackert die Sonne selbst mitten am Tag, die Luft kratzt und schmirgelt wie Schleifpapier in meiner Lunge. Nachts rieselt Asche auf unser Zelt. Nie sind wir wirklich in Gefahr, doch die Dichte der Feuer trübt die Sicht wie dicker Nebel scheinbar überall, niemand kann sich dem Rauch entziehen, ein unheimliches Fahrgefühl.
Ende Juli platzte einem Autofahrer ein Reifen, die auf dem Asphalt schleifende Felge schleuderte einige Funken in die benachbarte Böschung, die augenblicklich zündelte. Was so harmlos anfing, sollte sich zu einem der verheerendsten Feuer der Geschichte des Bundesstaates auswachsen: das Carr-Fire. 40.000 Menschen werden evakuiert, acht sterben, mehr als 1000 zerstörte Wohnhäuser, 1,6 Milliarden Dollar Schaden. Der benachbarte Mendocino-Komplex vernichtet derweil ein Gebiet doppelt so groß wie Berlin und geht gar als größter Waldbrand in die Geschichte Kaliforniens ein – dabei hat die Saison gerade erst begonnen.
Der Bundesstaat erlebt seit Jahren wiederkehrende Dürren, schätzungsweise 130 Millionen verdorrte Bäume warten darauf, in Flammen aufzugehen. Die lang ersehnten Regenfälle 2017 segneten die Landschaft zwar mit üppigem Grün, das nun aber, im nächsten Jahr der Trockenheit, überall lichterloh brennt. Flächenbrände sind zwar Teil eines natürlichen Zyklus, werden aber oft schon im Keim erstickt, um besiedelte Gebiete zu schonen, denn immer mehr Städter ziehen aufs Land. Wesentlicher Faktor ist jedoch der Klimawandel mit sich beinahe jährlich überbietenden Rekordtemperaturen, die verheerende Waldbrände wahrscheinlicher machen. Selbst die Trump-Administration prognostiziert eine Erwärmung der Erdatmosphäre um bis zu 4 °C bis zum Jahr 2100, hält Gegenmaßnahmen aber für nicht durchsetzbar – das sei zu aufwändig.
14.000 Feuerwehrmänner sind in diesem Sommer im Einsatz, angespornt von bunt bemalten Plakaten der Einheimischen. Einer der Nationalhelden ist Tommy, ehemaliger Germanistikstudent und nun “Smokejumper”. Er springt mit dem Fallschirm in abgelegene Waldbrandherde und verbringt dort bis zu zwei Wochen, hackt in sengender Hitze Feuerschneisen frei, bedeckt die Flammen mit Staub und Steinen. Ein Knochenjob. Nur alle paar Tage bringt ein Helikopter frisches Trinkwasser und Nahrung.
350 Mal sprang er bereits, einmal sei er dabei im Baum gelandet. Angst im Feuer zu sterben hat Tommy nicht: “Ich würde schneller in einem Büro krepieren!” Er führt uns durch seine Basis im Bundesstaat Washington, hilft Daniel den 60-Kilo-Rucksack auf den Rücken zu wuchten, mit denen die Smokejumper nach vollendeter Mission zurück zu einer Straße wandern müssen. Für den Adrenalinsüchtigen ein Traumjob, der es ihm ermöglicht, im feuerfreien Winter das im Sommer verdiente Geld auf Hawaii zu verjubeln.
Wir überspringen einen Teil der verrauchten Gebiete dank unserer Mitfahrgelegenheit Dave, als verwundeter Veteran schon seit 30 Jahren berentet. Die Irakis schossen im Zweiten Golfkrieg seinen Helikopter vom Himmel, zwei seiner Kameraden starben. Veteranen sind wichtiger Teil des amerikanischen Mythos, der den Patriotismus schürt und die Nation zusammenhält: Straßen werden ihnen gewidmet, in fast jedem Supermarkt hängen Fotos der lokalen Krieger. „America, land of the free because of the brave“ – Freiheit daheim als Rechtfertigung für dutzende Invasionskriege. Trotz der allgegenwärtigen Heroisierung nehmen sich 22 Veteranen täglich das Leben. Eigentlich stellt das Department for Veteran Affairs extra Krankenhäuser und Therapeuten bereit, doch werden die Kriegsversehrten häufig auf Wartelisten geschoben. Selbst körperliche Wunden bleiben spärlich versorgt, ganz zu schweigen von den seelischen. Alkoholismus und Drogenkonsum folgen, jeder fünfte Obdachlose ist Veteran.
Über Veteranenkult und Kriegstreiberei regt sich einer ganz besonders auf: Kelvin, mit dem wir uns am Lake Tahoe zum Kayaken treffen. Ein schwuler Anarchist und hierzulande ein Exot, weil er in Gebiete verreist, deren Namen die Amis schwer aussprechen können. Kelvin chauffiert uns im Pickup, wir peppen die Junggesellenküche am Lagerfeuer auf – ein guter Deal!
Auch der weltbekannte Yosemite-Nationalpark bleibt aufgrund der dicken Luft wochenlang geschlossen, einmalig in dessen Geschichte, und so weichen wir zu den Vulkanen des Lassen-Nationalpark aus. Daniel checkt sämtliche Qualmprognosen täglich, mehrfach, stündlich, in aufgeregter Erwartung. In 2.500 m Höhe sind die Schwaden dünn genug, um Anfang August die Lightshow des Jahres zu bewundern: den Perseiden-Schauer. Bis zu hundert Meteoriten pro Stunde jagen über das Firmament, explodieren mit feurigem Schweif, der noch Sekunden nachglüht. Wir liegen im Schlafsack unter freiem Himmel, von Mitternacht bis zum Morgengrauen, und genießen den Film.
Das Visum drängelt und wir müssen schnellstens vom Inland nach San Francisco. Kaum zu schaffen, doch erneut purzeln wir ins Glück: Neben uns campen Mitch und Joni. Eigentlich ist deren Pickup schon voll bis oben hin, aber Mitch spielt verdammt gut Tetris und pfropft noch jeden Reiseradler mitsamt Gepäck ins Auto. Wir übernachten in ihrem Gästezimmer, werden mit Pizza und extrastarken Mojitos beglückt und am nächsten Morgen zur Fähre nach San Francisco kutschiert.
Dort begann unsere Nordamerika-Runde im Februar, die Stadt ist wie Cola: prickelnd, süß, trotzdem viel Elend. Doch wir kehren aus einem anderen Grund zurück: dem Wiedersehen mit Ruth und Edward. Die inspirierendsten Gastgeber der Warmshowers-Gemeinschaft. Die Weltgewandtesten. Reiseführer, Geschichtsbücher, Sprachführer, politikwissenschaftliche Analysen, die spannendsten Romane – ich will in ihren hunderten Büchern baden und erst wieder auftauchen, wenn ich all das Wissen eingesogen habe, das darin offenbart wird. Ruth kündigte ihren Job im Silicon Valley, um als Mathelehrerin zu arbeiten, Edward schreibt Reiseführer, verweigerte in den 80ern die Registrierung auf einer Anmeldeliste für einen möglichen Militäreinsatz in Afghanistan – und handelte sich damit viereinhalb Monate Gefängnis ein. In ihrem Haus hängen Demoplakate, für Obamacare, gegen Polizeigewalt, für weniger Rüstungsausgaben. Am liebsten würde ich gleich damit losmarschieren! Während ich den ersten Kuchen seit anderthalb Jahren backe, tobt sich Daniel im Garten aus. Er alleine übernimmt dieses Mal die Verabschiedung – stumm bin ich nur noch damit beschäftigt, nicht zu weinen.
Es gilt noch eine offene Rechnung zu begleichen: Big Sur. In engen Schleifen windet sich der legendäre Highway 1 die Steilküste entlang, rechts der Pazifik, links die kilometerhoch aufragende Santa Lucia Range. Noch bis August versperrte ein 800 m breiter Erdrutsch die Weiterreise nach Los Angeles, nach über einem Jahr Bauarbeiten ist die Durchfahrt wieder frei.
In Los Angeles, der Stadt der Engel, lebt eine besonders Herzensgute: Karen. Auch Mitglied bei Warmshowers. Bei unserer Ankunft ist der Kühlschrank für uns proppevoll gefüllt, auch hat sie bereits Kartons für den Flugtransport der Räder organisiert und ein vorausgeschicktes Paket mit Ersatzteilen aufbewahrt. Karen besteht darauf, allabendlich zu kochen und tanzt und springt wie ein junges Mädchen zwischen Herd und Esstisch. Das größte Wunder für sie selbst: Noch vor zwei Jahren konnte sie kaum gehen, mit 50 schon waren beide Hüften verschlissen. Karen, durch eine lang ersparte OP wieder fit, chauffiert uns sogar zum Flughafen.
Und nun folgt der schwerste Abschied. „Die Amis haben einen Knall“, meinte ein anderer deutscher Radtourist. Ja, ihr Konsumwahn, Veteranenkult, die Verschwendungssucht, närrische Waffenliebe, Kriegstreiberei und alles, was ihre aktuelle Regierung angeht, ist hanebüchen und himmelschreiend furchtbar. Und nein, wir wollten in diesem Land ganz sicher nicht leben: Die reichste Nation der Welt leistet sich ein Dritte-Welt-Gesundheitssystem mit beschämender Säuglingssterblichkeit und gar sinkender Lebenserwartung – im einzigen Industrieland überhaupt. Schon vorbeisausend auf dem Rad sind die Ursachen unheimlich spürbar: der ungesunde Lebensstil, die Verelendung ganzer Landstriche, Waffengewalt und die jüngste Opiatseuche, infolge derer mehr Menschen einer Überdosis erliegen als je zuvor. So abgesichert wir in Deutschland leben, so riskant ist das Jonglierspiel des amerikanischen Traums: Pechvögel können mitten im Diesseits bis in die Hölle fallen.
Dennoch war es hochspannend und lehrreich sich mit Menschen unterschiedlicher politischer Couleur auszutauschen. Die Neugier der Amerikaner, ihre entspannte Art, die Unterhaltungen am Lagerfeuer, vor Supermärkten, am Straßenrand, aber vor allem ihre wahnsinnige (!) Gastfreundschaft haben uns tief beeindruckt. Uns einen Spiegel vorgehalten, Himmel, wie verkappt und misstrauisch wir doch sind! Ich erwarte keine völlige Transition, keine Erleuchtung, auch nach einer solchen Reise bleibt der Mensch der gleiche, vielleicht etwas sortierter. Ein Erfolg wäre schon, sollten wir auch nur einen Bruchteil ihrer Geselligkeit übernehmen. Dann hätten uns die Amerikaner tatsächlich zu beschwingteren, hilfsbereiteren Mitmenschen gemacht.
Reisebericht Washington & Oregon
USA - Washington & Oregon
27. Juni – 26. Juli 2018 | 1.950 km, 14.950 hm
Niemals streiten Daniel und ich, jede Sekunde scheint die Sonne auf unsere Liebe (haha). Nun, bei diesem Reisebericht hat es gekracht: Gezankt und gefeilscht haben wir um jede der Zeilen, die den vier Nationalparks und vielen Geschichten in Oregon und Washington gerecht werden sollen. Liebe Lesende, entscheidet selbst, wie viel Zeit ihr euch nehmt für Naturschönheiten und Lebenskünstler, wie viel ihr vertragt von Cannabis-Fotografen, Vom-Leben-Gescholtenen, radikalen Abtreibungsgegnern und Heimgeschulten.
Eigentlich wollten wir nach Alaska. Doch der Westen der USA umgarnt uns mit landschaftlichen Reizen, die radlerfreundlich dicht beieinander liegen. Deshalb setzen wir mit der Fähre von Vancouver Island nach Washington über. Im letzten Eck des “immergrünen” Bundesstaates trotzt eine Halbinsel den immerfeuchten Strömen der Westwindzone: die Olympic Peninsula. Aus ihrer Mitte ragt widerspenstig der Mount Olympus empor, ein über zwei Kilometer hoher, vergletscherter Regenfänger. Bis zu 6.000 mm Wasser fallen hier jährlich vom Himmel, in Leipzig sind es 500. Landregen, Starkregen, Nieselregen und Sprühregen tränken die Vegetation (und uns), es tropft, trieft, dampft und nebelt überall. Moose hüllen die knorrigen Baumstämme in ein wattiges Gewand, herab hängen meterlange Flechten, hinauf wachsen Epiphyten und Misteln, darunter Farne und Pilze, alles ineinander und durcheinander. Jeder Quadratzentimeter Grün!
Unser Leipziger Lieblingsausrüster vermittelt uns den Kontakt zu Andreas in Seattle: Der gebürtige Sachse zog Anfang 2000 in die USA, ein Jobangebot bei Microsoft gab den Ausschlag. Nun lädt er zu sich nach Hause ein, ohne uns zu kennen. Wir köcheln, trinken Wein, quatschen bis zum Morgengrauen, als ob wir einen guten Kumpel nach langer Zeit wiederträfen. Am 4. Juli, dem Amerikanischen Unabhängigkeitstag, sitzen wir auf dem Dach, das größte, längste, emotionalste Feuerwerk meines Lebens explodiert direkt vor uns. Andreas’ Partygäste erzählen von den tagelangen Freudentänzen, als Marihuana legalisiert wurde, ebenso die Homoehe. Und dem bis heute anhaltenden Alarmzustand, nachdem Trump ins Weiße Haus einzog. Mit einem Mindesteinkommen von 15 Dollar und einer lokalen Einkommenssteuer entgegen der Landesverfassung ist Seattle liberaler Leuchtturm im sonst republikanisch geprägten Washington. Ich leere das x-te Glas und frage mich, wohin dieses Land steuert, dessen Einwohner uns die tollste Zeit der bisherigen Reise bescheren, und sich gleichzeitig so entgegen stehen?
Der Tod kracht auf jeden ein, der hier vorbeifährt. 43 Grabsteine lassen uns erschaudern, völlig unerwartet auf dem Weg zur Bergkette der Northern Cascades. 2014 verschüttete der Oso-Erdrutsch ganze Familien in ihren Häusern. An einem Samstag Vormittag wurde ihr Leben vom Geröll verschluckt, ob genutzt oder vergeudet, genossen oder ertragen. Ich denke an den Amerikaner vorm Supermarkt, der uns belustigt fragte, wann wir denn endlich „im real life“ ankommen würden. „Job, house, children?“ Arbeit, Kinder, Eigenheim, eine spannende Definition vom „realen Leben“. Doch wieso sollten wir die für uns schönsten Dinge der Welt, Reisen, Fotografieren, Lesen, eintauschen gegen einen Arbeitsalltag? Noch tickt keine biologische Uhr, noch ist die Neugier größer als die Lust auf Routine. Das alles kann warten, zwei Radreisejahre allemal. Was zählt: Jeder soll leben nach seinem Geschmack, schließlich drehen wir nur eine große Runde auf der Erde. Jeder bestimmt, wie viel er mitnimmt bei seinem einzigen Lauf. Und ich will vollgepackt bis oben hin ins Grab flanieren.
Zum anderen: Woher soll ich wissen, was wichtig ist, was unnütz und nichtig? Wenn ich nicht mit Menschen in verschiedenen Ecken der Welt gelitten, gelacht, geweint, sie nach ihren fatalen und goldrichtigen Entscheidungen gefragt habe? Was in der Schule noch verboten war, betreibe ich auf Reisen täglich: Ich spicke. Ich spicke und lunze Lebensmodelle und -weisheiten. Man kann das Leben bunter gestalten, als es die Vorstellungskraft erlaubt und Wege gehen, die man (noch) nicht kennt. Das alles habe ich dem Experten für das „real life“ vorm Supermarkt verschwiegen.
Die Kaskadenkette im Nordwesten der USA zieht sich über 1.100 km vom kanadischen British Columbia bis hinunter nach Kalifornien und teilt die Gegend in zwei klimatische Extreme: sattgrün und kühl im Westen, heiß und trocken im Osten.
Der Gebirgszug ist Ergebnis andauernder tektonischer Aktivität: Seit 70 Millionen Jahren kollidieren tektonische Platten, die einen senken sich und schmelzen, die anderen heben sich und wachsen. Verheerende Erdbeben und Vulkanausbrüche erschüttern die Region in unregelmäßigen Abständen, wie etwa die Explosion des Mount St. Helens 1980, die Asche 24 km hoch in den Himmel schoss und über elf Bundesstaaten regnen ließ. Dutzende Vulkane ploppen aus der zackigen Berglandschaft, ordentlich aufgereiht wie an einer Perlenkette, schneebedeckte Wächter, die ihre Umgebung locker um ein paar Kilometer überragen. Der höchste, und sicher einer der schönsten ist Mount Rainier, ein Klischee von einem Berg: 4.392 m hoch, mit vergletschertem Haupt, kristallklaren Bächen und Almwiesen, die erst jetzt im Juli in voller Blüte stehen.
Wir fahren im Zickzack, erneut geht es für uns Richtung Küste: Highway 101, eine der „Traumstraßen dieser Erde“, entpuppt sich eher als Highway to Hell. Überladene Holztransporter, unsichere Wohnwagenfahrer und genervte Berufspendler verderben selbst die schönsten Abschnitte. Ein besonders gehetztes Arbeitstier bespritzt Daniel gar mit Wasser, damit der von der Fahrbahn springt. Noch nicht bereit zu sterben, fliehen wir zurück ins Inland.
Ich giere nach Feierabend, doch inmitten eingezäunter Enge bleibt nur die Suche nach einem hübschen Vorgarten für unser Zelt. Wir klopfen an – und Miriam öffnet die Tür. Etwa 40, hinter ihr eine große Kinderschar, dazu tragen sie und ihre Töchter gehäkelte Kopfbedeckungen und lange Jeansröcke. Ich habe nur noch Fluchtgedanken, ahne schon den Abend dahinkriechen in Sermonen und missionarischen Umpolungsversuchen. Doch Daniel nimmt bereits die Einladung zum Frühstück an. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus – Gott sei Dank!
Miriams Mutterherz beschlagnahmt uns sofort, sie tischt Pfannkuchen und Früchte auf, Eier und Speck. Während sie zuhause rackert, transportiert Ehemann Rick Benzin, von 1 Uhr nachts bis 18 Uhr abends, zuweilen bis 22 Uhr. Sie sind Mitglieder einer kirchlichen Krankenvereinigung, einmal im Monat überweisen sie Geld, allerdings direkt an den Betroffenen in ihrem Verbund. So wissen sie, wen ihr Beitrag heilt, wem sie das Leben erträglicher machen. Der Nachwuchs wird zuhause unterrichtet. Das Gesetz Oregons verlangt, dass heimgeschulte Kinder alle paar Jahre staatliche Tests in den Hauptfächern absolvieren, dennoch bleibt viel Freiraum. Im Bio-Unterricht der Familie wird Darwin kritisch hinterfragt, denn „God created everything.“ Harry Potter hat keines der Kinder gelesen, weil die Bibel Zauberei und Magie als satanische Sünde verdammt, Hexen und Geister gelten als Diener des Teufels. Nur die Eltern besitzen ein Smartphone, Nachrichten schaut die Familie kaum. Erstaunlicherweise sind Victoria und ihre Geschwister die charmantesten, ausgeglichensten, fröhlichsten und neugierigsten Kinder, die wir seit Langem treffen. Ich muss mich selbst daran erinnern, es nicht gut zu finden, dass die Komplexität meiner Welt in ihrer vielleicht nicht existiert.
Wir erzählen von unserem Plan, es per Anhalter zum weit entfernten Crater Lake zu versuchen – und sitzen zwanzig Minuten später allesamt in der Familienkutsche. Ein spontaner Roadtrip, 350 km mal eben für uns Reiseradler, die wir die Zeit für diesen Abstecher nicht hätten. Ich denke an den Vorabend zurück, meine Anti-Haltung gegen fundamentale Christen. Aber diese Familie überrascht, weil sie nicht zu missionieren versucht, sich nicht nur hinter der hohlen Phrase der Nächstenliebe verbarrikadiert. Ganz nebenbei erzählen sie von ihren Heldentaten, an ihren eigenen Geburtstagen singen sie im Altenheim, backen Kuchen für Nachbarn, versorgen die Witwe nebenan mit Mittagessen. Und verwöhnen uns Fremde.
Crater Lake ist das Überbleibsel des Mazama-Vulkans, dessen Magmablase sich vor knapp 8.000 Jahren zum letzten Mal füllte: Immer weiter erhöhte sich der Druck der gashaltigen Schmelze, bis der Korken knallte und sich ihr Inhalt unter ungeheurem Getöse entleerte. Als würde man eine Seltersflasche schütteln und zu schnell öffnen. Irgendwann war die Kammer leer, stürzte ein und hinterließ eine gewaltige Caldera. Regen und Schmelzwasser füllten die Wanne und schufen den heutigen Kratersee, mit 594 m das tiefste Gewässer der Vereinigten Staaten.
Unser US-Visum läuft bald aus, in Zeitnot müssen wir immer wieder Teilstücke per Anhalter überspringen. Und da stehen wir nun am Straßenrand: Arzt und angehende Lehrerin, in verschwitzter Kleidung, einzig das Rad unterscheidet uns von den vielen Kaputten dieser Gegend. Mitunter steigen wir zu den irrwitzigsten Figuren ein: Da ist Ben, der seinen Lebensunterhalt locker flockig mit dem Fotografieren von Marihuana bestreitet. „Ich komme kaum hinterher mit den vielen Aufträgen, der Markt boomt, seit Pot legalisiert wurde.“ Oder Josh, der als Elektriker 1000 Dollar am Tag verdient und dafür Frau und Kind nur alle zwei Wochen zu sehen bekommt: „Geld macht nicht glücklich, aber süchtig.“ Eric, der 180 km extra für uns fährt: „Ich arbeite Gleitzeit und hab noch keine Lust auf meinen Schreibtisch.“ Dessen Frau psychisch krank ist und kaum Rente ansparen kann. „Es ist völlig unklar, wie sie im Alter zurechtkommt, ich verdiene gerade genug für mich.“ Doch der Tief- und zugleich Höhepunkt ist Melanie. In einem Wagen, der so aussieht, als hätte ihn Henry Ford noch persönlich zusammengeschraubt, zieht sie um, von der Hölle in die Wüste. Ihr Mistkerl von Ehemann prügelte sie grün und blau. Sie las zunächst als Flucht-Strategie, selbst das Britannica Lexikon lenkte sie ab von ihrer erbärmlichen Gegenwart. Nun prescht die Spindeldürre fort, mit ein paar Habseligkeiten und – mühevoll dazwischen gequetscht – 12 Radtaschen und zwei Fahrrädern. Müde wirkt sie, nervös und entschuldigend. „Do you smoke pot?“, fragt sie. „I need only one hit.“ Die zwei Züge beruhigen sie tatsächlich. „Warum hast du uns mitgenommen?“, will ich wissen. „Wir sollten uns doch alle gegenseitig helfen. Pay it forward!“
Nachdem wir in Arizona bereits einen waffennärrischen Priester kennenlernten, übernachten wir nun in der Kirche eines fanatischen Abtreibungsgegners. Pastor Greg ist jung, dynamisch und stimmte 2016 für die Republikaner. Seine Begründung: „Trump schützt das Leben!“ Den Satz muss ich erst einmal verdauen.
Noch ist Abtreibung in den USA erlaubt, jedoch bestehen zwischen den Bundesstaaten starke Unterschiede etwa in der Anzahl durchführender Ärzte. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau interessiert Greg kaum. „Mir geht es nicht um ihren Uterus, sondern um das Leben darin.“ Zu Abtreibungen nach Vergewaltigungen sagt der Pastor: „Was ist schlimmer? Vergewaltigung oder Vergewaltigung plus Mord?“
Später setzt sich eine Glaubensschwester zu uns und beichtet: Ihr Schwiegersohn, christlich und Pastorensohn, chatte in Schwulenportalen. Tauscht Nacktfotos wie Panini-Bildchen. Die Tochter habe ihn dabei ertappt. Auf Empfehlung eines kirchlichen Beraters zog sie kurzzeitig aus, damit sich ihr Ehemann wieder „berappele“. „Wir sind alle Sünder“, zittert das Mütterchen. „Aber ich mache mir große Sorgen, dass mein Schwiegersohn nicht wieder auf den richtigen Weg kommt.“
Wir wollen unsere Leipziger Filterblase überwinden und sind dankbar für jede Story – je haarsträubender, desto besser. Aber manchmal fällt es brutal schwer, Haltung zu wahren, höflich zu bleiben. So leicht könnte die Kirchliche es haben, den Schmu einfach nicht glauben. Dann wäre der schwule Schwiegersohn kein Sünder, sondern ein normaler Mensch, und sei es in Gottes quirlig buntem Tiergarten. Ich wünsche ihr viel Kraft zum Abschied. Eine glatte Lüge, denn eigentlich wünsche ich ihr nur eines: Besinnung.
AA Vorlage Reiseberichte Rucksackreise
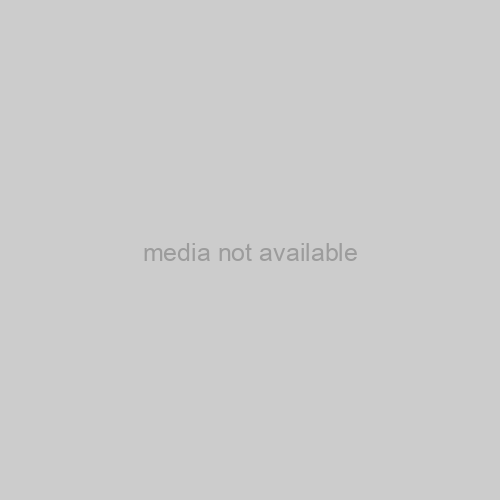
Beispielüberschrift
23. April – 20. Mai 2017 | 1.530 km, 9.310 hm
Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext. Hier steht Beispieltext.
Mutprobe am Morgen.
Weiterlesen...
Reisebericht Kanada
Kanada
31. Mai – 27. Juni 2018 | 460 km, 3.950 hm
Los geht’s mit unseren vorerst letzten Metern in den USA und Gott hat einen besonders bescheidenen Tag. Es gießt in Strömen, Anfang Juni ist Daunenjacken-Wetter. Eigentlich schuftet die Sonne bis 22 Uhr, doch heute macht sie blau, so gäkig ist es draußen. Wir würden triefnass und fluchend in die Pedale treten, wäre da nicht die soziale Ader der Amerikaner. Dieses Mal heizen Kristi und Roger ihren Wohnwagen vor und im Molligwarmen frühstücken wir Pancakes. Regen, der an Scheiben prasselt und nicht ans Außenzelt – es gibt keinen größeren Luxus. Alle Radtaschen sind schon im Trockenen verstaut, die Räder auf dem Anhänger. Kristi und Roger chauffieren uns über die Grenze. Mit dabei eine Blechdose, wertvoller als alles Geld der Welt. Die Asche ihres Sohnes. Jonathan rauchte, sniffte, naschte, spritzte sich, bis sein Körper aufgab. “Er wollte nicht leben”, sagt Kristi stumm. Mit 33 hatte er es geschafft.
Eigentlich arbeitet sie als Krankenschwester, aber wie soll man helfen und heilen, wenn man selbst gerade zerbricht? Ehemann Roger kaufte einen Wohnwagen, seine Frau müsse raus aus ihrer schwarzen Welt. Hinein ins Schöne, Bunte, in die Ruhe, ins Abenteuer. Sie fahren nach Alaska. Wenn das eigene Kind stirbt, wie erhält man sich selbst am Leben? Ihre Kraft bereitet mir Gänsehaut. Lachend erzählt die Krankenschwester ihre beste Story aus dem Geburtssaal. Ein weißes Ehepaar, die Frau liegt in den Wehen, Stunden später gebärt sie ihr Baby, ein dunkelhäutiges. Kristi vergewissert sich noch heimlich beim Arzt: “Doc, das Kind ist doch schwarz!?” “Oh ja…” Kein Spielverderber findet sich, alle spielen die Show mit. Alle lächeln auf dem ersten Familienfoto.
Unser Gepäck bleibt unbefingert, ohne Kreuzverhör rollen wir über die kanadische Grenze. Wer in das Bollwerk USA einreisen durfte, muss harmlos, weiß und wohlhabend sein, wir werden lässig durchgewunken. Nur schemenhaft lassen sich im Nebel die verkohlten Baumleichen ausmachen, die zu Abertausenden die Straße säumen. 2017 entfachten Blitze ein Feuer und kaum jemand rechnete damit, dass es nach mehr als drei Wochen noch immer nicht unter Kontrolle sein würde. Die Feuerwalze fraß schließlich knapp 40 Prozent des Waterton Nationalparks und zerstörte mehr als Dreiviertel aller Wanderwege und Campingplätze.
Nach den Wochen der Kälte ist es endlich wieder angenehm warm und die Fahrt entlang der Rockies ein Genuss. Auf und ab durch welliges Hügelland, links die Berge, rechts die Prärie. Keine Private-Property-Schilder, dafür Menschen mit europäischen Kleidergrößen und handlichen Autos. Niemand protzt mit seinen Waffen. Doch irgendwie sind alle kühler, kaum eine Seele spricht uns an. An der Kasse unterbricht nur das Piepsen die distanzierte Stille. Unglaublich, wir vermissen die Amis!
Gar frostig wird es, erwähnt man die südlichen Nachbarn. Trump hat den Handelsstreit ausgerufen, Strafzölle verhängt. „Wir sind ziemlich pissed off“, meint Warmshowers-Gastgeberin Kiersten, sie boykottiere jetzt amerikanische Produkte. „Statt Heinz Senf kaufe ich einfach Kozlik’s.“ Ein anderes Paar verzichtet gar auf den jährlichen Urlaub in Malibu Beach.
Doch selbst T***p kann uns die Stimmung nicht versauern, euphorisch wetzen wir zwei großen Wiedersehen entgegen. Zunächst passen uns Jochen und Beata ab, die unermüdlichsten Weltendecker. Beata arbeitet für das Goethe-Institut, alle fünf Jahre ziehen sie „berufsbedingt“ von einem exotischen Wohnort zum anderen. 2013, auf unserer ersten Langzeitreise, lud uns Fotofreund Jochen ins indische Mumbai ein. Zuvor lebten sie in Brasilien, fast schon zuhause sind sie demnächst in Lissabon. Jochen gehört zur Handvoll jener, die uns regelmäßig schreiben. Kein Reisebericht bleibt ohne seine Reflexionen, Anerkennung, Witz – der Kosmopolit sendet turnusmäßig Treibstoff für tausend Gipfelstürme.
Bei zwei verrückten Wanderern kommen wir unter in Calgary. Im Haus von Heather und Egbert wabert die gewagte Duftmischung aus Kakao, Dörrobst und getrocknetem Rind. Eifrig brummt der Dehydrator. Um leichter unterwegs zu sein, absolvierten sie einen Hochschulkurs im Dehydrieren. Auch uns statten sie aus, mit selbstgemachter Mousse au Chocolat zum Anrühren und einer ordentlichen Portion Trockenfleisch für Daniel. Wir sind gerne Versuchsmäuse! Völlig entspannt reagieren sie auf unsere Invasion, schmunzeln, als wir ihren gesamten Hof für das Schrubben der Ausrüstung okkupieren. Wir machen uns schick für lang ersehnten Besuch. Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Daniels Familie half uns durch die chinesische Einsamkeit zu Weihnachten, die schwierige Zeit in Südostasien und jede Strapaze der vergangenen Monate.
Meine armen Eltern haben durch ihre globetrottenden Kinder ein hartes Los gezogen, besuchten schon meinen Bruder auf den Philippinen, meine Schwester in England und mich in Argentinien – und nun also uns in Kanada, zusammen mit Tanten und Onkeln als Verstärkung. In zwei Wohnwagen wollen wir Richtung Vancouver kurven und sind gespannt, wie uns das Reisen auf vier Rädern taugt.
Um die zwei Schiffe in den Nationalparks unterzubringen, müssen wir nun vorher reservieren. Einfach so dazwischenmogeln geht nicht mehr. Enorm wichtig ist plötzlich auch die Verfügbarkeit von Steckdosen: Gewisse Semester können nicht mehr ohne Fön. Claudia geht mit meinem Vater joggen, die männliche Fraktion kümmert sich um ordentliche Steaks, während uns die weibliche auf’s Beste verwöhnt. Claudias Familie schickt Briefe zum Geburtstag, seitenlange Rührung, den gesamten Morgen liest sie mit dunkler Sonnenbrille – meine Tanten hatten bereits im rumpelnden Wohnwagen einen Kuchen gebacken.
Mit Fönfrisur wandern wir die Rockies hoch und runter und sind erstaunt, wie fit unser Trupp über Eis und Fels graziert. Banff und Jasper – selbst die größte Couchpotato, der süchtigste Ballerspielzocker wäre gerührt von diesen Nationalparks.
Im Lauf der Jahrtausende hobelt das fließende Eis tiefe Täler in den harten Fels und zermahlt das Gestein zu feinstem Schlamm. Das „Gletschermehl“ trübt die ablaufenden Flüsse milchig grau. Später sinken die größeren Partikel zu Boden, übrig bleiben feinste Schwebepartikel, die vornehmlich die blaugrünen Anteile des Sonnenlichts reflektieren. Je nach Jahreszeit verändert sich daher das Antlitz der Gebirgsseen: Schlammig grau im Frühjahr, wenn viel Eis schmilzt, leuchtend türkis im Sommer, wenn weniger Nachschub kommt, kristallklar im Spätherbst, wenn die Zufuhr versiegt. Ein typisches Phänomen vieler von Gletschern gespeisten Seen der Erde.
Mehr als einmal starten wir die motorisierte Wagenburg schon im Morgengrauen, um die Landschaften im besten Licht zu sehen, während meine Eltern noch schaukelnd schlafen – oder zumindest so tun. Es ist erstaunlich und unendlich stark, auch selten unter Familien, wie kompromisslos kompromissbereit jeder ist und selbst zusammengeworfen auf engstem Raum keine Fetzen fliegen. Allabendlich zelebrieren wir die gemeinsame Zeit am Lagerfeuer und genießen jede Sekunde der intensiven, vertrauten Unterhaltungen.
Unser Trip endet auf Vancouver Island. Die urigen Küstenregenwälder des Pacific Rim Nationalpark reichen bis zum Strand, dahinter kommt über viele tausend Kilometer nichts, dann irgendwann Japan. Die Wellen des Pazifik haben einen weiten, ungebremsten Weg hinter sich, bringen Treibgut vom anderen Ende der Welt und formen das Antlitz der Küste jeden Tag neu.
An einer Tanke setzen sie uns aus, links McDonalds, rechts die Autobahn, ein schmerzlicheres Bild kann es für Eltern nicht geben. Zügig bepacken wir die Räder. Jede Sekunde zählt, die den Moment verkürzt. Sorgen und Stolz ringen miteinander, gehen die Kinder unklare Wege, fort aus Deutschland, im weiten Bogen um die Norm. Angst und Neugier fechten und streiten, wenn man den Atlas durchkämmt, um den Nachwuchs zu orten. Klatschbasen fragen, wann denn der Spross endlich arbeite. Schütteln und Kopfwaschen will man die Kinder, die man zum Flughafen bringt, statt deren Babys zu schaukeln. Die immerfort reisend Vollmachten hinterlassen, Möbel abstellen. Nach Abenteuern statt Karriere gieren, Geschichten sammeln statt Rentenpunkte. Viel verlangt es von den Eltern, fast schon Schizophrenes: Ziehen lassen und trotzdem begleiten. Ein mitschwingendes Fundament.
Der Abschied wirft uns aus der Bahn, die Nestwärme der letzten Tage fehlt, wie fremde Prothesen kurbeln die Beine. Es sind die Fürsorglichen der Warmshowers-Gemeinschaft, die uns aufheitern mit ihren Storys. Und der schönste Zeltplatz Kanadas. Wir klopfen an bei Tim und Gillian und dürfen auf ihrem privaten Bootsdeck kampieren, mit Robben und Seeottern als Gästen am Zelt. Waren wir im Wohnwagen abgeschottet wie im Panzer, mischen wir uns auf den Rädern wieder unter die Kanadier. Kaum ist die Familie abgereist, steckt uns der Erste 50 Dollar zu, der Zweite Telefonnummer und Anschrift, falls wir Hilfe bräuchten, der Dritte spendiert Kaffee und Nummer Vier, ein amerikanischer Tourist, 40 Dollar. Und jeder Daumen Hoch vorbeiziehender Autofahrer streichelt die heimwehgebeutelte Seele. Frisch motiviert schippern wir mit der Fähre erneut in die USA, der letzte Abschnitt Nordamerikas beginnt.
Reisebericht USA - Wyoming & Montana
USA – Wyoming & Montana
03. – 31. Mai 2018 | 1.710 km, 10.300 hm
Andrea Berg, Heino und Marianne Rosenberg hallen durch den Wald. Daniel jodelt den Giftmüll der deutschen Schlagerwelt so laut er kann und klatscht dazu in asynchroner Inbrunst, bis die Zapfen von den Tannen fallen. Es gibt romantischere Touren – aber kein effizienteres Mittel, Bären zu vergraulen. In Wyoming und Montana erwachen die Abgezehrten gerade aus dem Winterschlaf, Einheimische warnen: „Mit Schwarzbären könnt ihr es aufnehmen, aber nehmt euch in Acht vor den Grizzlys!” Mehrere hundert Kilo schwer werden die mächtigen Tiere und messen aufgerichtet drei schauerliche Meter. Launige Männchen und Mütter mit Jungen sind unberechenbar und ein einziger Hieb der fußballgroßen Pranken tödlich. 2017 kollidierte ein Radfahrer mit einem der Raubtiere, keine Chance für den Sportler. Unser Körper weiß bald nicht mehr, ob er sich stille schleichend oder auffällig laut verhalten soll, denn das Hirn sendet ihm widersprüchliche Signale: Unbedingt wollen wir Grizzlys beobachten, doch um Himmels Willen keinem einzigen begegnen…
Bären können besser riechen als Hunde und Essbares sogar durch das Blech einer geschlossenen Konservendose erschnuppern. Die Tiere sind Allesfresser und jetzt im Frühsommer im Kalorienrausch. Daher müssen wir alles, was duftet, in einem Baum hochziehen: Vorräte, Kocher und Geschirr, Medikamente, sämtliche Hygieneartikel, Handtuch, Waschlappen, bekleckerte Kleidung. Dabei ist es gar nicht so einfach, einen weit vom Zelt entfernten Baum zu finden, der an einem ausladenden Ast in großer Höhe die Last einer 15 Kilo schweren Radtasche trägt, aber nicht das Gewicht eines kletternden Schwarzbären. Auch die Windrichtung muss stimmen, der Duft soll schließlich nicht ans Zelt locken. Kochen und Waschen erledigen wir daher früher als sonst, denn bis zum Sonnenuntergang muss das Camp stehen und die Tasche hängen – und wenn etwas fehlt, alles wieder runter.
Um uns diese Mühsal zu ersparen, drängeln wir uns jedem Warmshowers-Gastgeber auf, der nicht schnell genug sein Profil sperrt. Ihr kennt die Gemeinschaft inzwischen, einheimische Helden, die kostenfrei Radreisende beherbergen. Peggy und Warren bereiten ein 10-Sterne-Dinner, mit am Tisch sitzt das Unerwartete, eine echte Exotin, ein Augenstern: Warrens Mutter. Die 93-jährige Louise ist die erste ältere Dame, gepflegt von ihrem Kind, der wir auf diesem Kontinent begegnen. Der Schlauch ihres Sauerstoffgeräts durchzieht das Erdgeschoss wie ein Telefonkabel. „Give me another glass of that wine“, fordert Louise Nachschlag vom deutschen Glühwein, den wir unterwegs angeln konnten. Fast schon entschuldigend hatten sie Grandma vor der Haustür flüsternd angekündigt: “Ihr müsst wissen, Warren pflegt seine Mutter …” In den USA leben die Familienmitglieder zumeist mehrere Flugstunden voneinander entfernt, in der Hoffnung, im Alter irgendwie zurechtzukommen. Auf der anderen Seite der Welt, noch in Kirgistan, hatte uns eine Studentin gescholten: „Wenn ihr eure Eltern ins Pflegeheim karrt, ist das nicht besser, als hätten sie euch ins Waisenhaus gesteckt.“
„Ich habe jahrelang gutes Geld im Bergbau verdient, bis es mir in Wyoming zu blöd wurde: Im Sommer drückend heiß, im Winter pervers kalt und immer windig!“, verflucht eine Davongeflohene den am dünnsten besiedelten Bundesstaat der USA, nach Alaska. 2 Seelen teilen sich hier einen Quadratkilometer, in Deutschland sind es 222 auf gleicher Fläche. Nach ein paar hundert Kilometern platten Landes gewinnt die Landschaft endlich an Profil und die ersten schneebedeckten Zacken am Horizont jagen Endorphine ins Blut: Wir haben die Rocky Mountains erreicht!
70 Prozent der Wähler Wyomings stimmten für Trump – nirgendwo fiel das republikanische Ergebnis besser aus, selbst in Texas waren es nur 52 Prozent. Im Gemischtwarenladen gibt’s Dünger, Bier, Waffen, Jagdlizenzen, was der Cowboy eben so braucht.
Doch in diesem konservativen Gruselkabinett liegt ein Ort, der das Reiseherz befeuert: Yellowstone! Der erste Nationalpark der Welt, 1872 gegründet. Anfang Mai sind wir früh dran, die Straßen noch von übermannshohen Schneewänden gesäumt und die meisten Zeltplätze geschlossen. Wir terrorisieren die Nationalparkverwaltung mit verzweifelten Anrufen – wo können wir nur kampieren? Bis plötzlich David durchklingelt, der Chef der Straßenwacht. Er gehört zu einer Handvoll Robusten, die selbst im tiefsten Winter hier ausharren und nur mit dem Schneemobil in Zivilisationsnähe gelangen. „Ihr könnt gerne bei mir übernachten!“, bietet er an, ohne uns zu kennen. Problem gelöst und gratis dazu gibt’s eine Lebensgeschichte, die schwindelig macht.
David überwinterte mehrere Jahre als Techniker am Südpol. „Ich bin eher schüchtern, deswegen haben sie mich ausgewählt. Die brauchen keine Lauten da unten.“ Die ewige Finsternis lockt selbst die Stillsten aus der Reserve, literweise floss der Alkohol, spontan gründeten sich Bands, die wilde Partys anheizten. „The time of my life“, zwinkert David. Er baute ein Haus auf Costa Rica, ein Earthship in Arizona und konnte beides nicht halten, weil das Geld für die Krebstherapie der Frau draufging. Um die Schuldenberge zu tilgen, buckelte er fünf Jahre in Irak und Afghanistan als Techniker. Nicht die Angst vor dem Tod zehrte an ihm, sondern das Nichts an Privatsphäre und Ruhe, das ständige Wachliegen in überfüllten Camps, die nächtlichen Mörserangriffe, immer im Alarmzustand. Der seelische Ruin für einen, der es gerne still um sich hat. Die Winter in Yellowstone erinnern ihn an den Südpol, „alles ist dann nur noch weiß, nichts reizt die Sinne.“ Ruhe heilt.
“Lust auf eine Safari?” Klar! David hat viel Erfahrung, leistungsstarke Ferngläser und als Chef der Straßenwacht Zugang zu all den gesperrten Straßen im Park, was uns einen exklusiven Tag beschert.
Das Herz des Nationalparks bildet ein geothermales Hochplateau, die Caldera des Yellowstone-Supervulkans. Dessen letzter großer Ausbruch vor 640.000 Jahren schleuderte Asche mit der Kraft von 1.000 Hiroshima-Bomben (pro Sekunde) bis hinunter nach New Mexiko und stürzte den Planeten in einen globalen Winter. Beim nächsten Ausbruch dieses Ausmaßes würde ein Siebtel der Menschheit eingeäschert, verhungern, erfrieren. Obwohl sich der Boden über Yellowstone um 15 cm jährlich hebt, ist die Wahrscheinlichkeit für einen baldigen Ausbruch gering: etwa eins zu 730.000 pro Jahr.
Die Anzeichen hoher vulkanischer Aktivität sind allgegenwärtig. Eine gewaltige Magmakammer nur wenige Kilometer unter der Erdoberfläche erhitzt versickertes Regenwasser, presst es durch enge Spalten wieder nach oben, und so zischt, blubbert und dampft es an über 10.000 verschiedenen Stellen im Park. In den lebensfeindlichen Quellen, kochend heiß und so sauer wie eine Autobatterie, formen Bakterien leuchtend bunte Kolonien.
Wir verlassen Yellowstone, aber die Wildnis endet nicht. Wachsam rollen wir durch dampfende Urwälder, permanent zirkuliert das Adrenalin. Einem Bären davonzufahren ist aussichtslos, die Tiere schaffen im Sprint 50 km/h. Plötzlich hält Daniel sachte und zeigt auf das Gebüsch gegenüber: Ein Grizzly trottet neben uns in die gleiche Richtung, lautlos und desinteressiert. Wir beobachten ihn einen Moment und machen uns dann zügig vom Acker …
Auf einem noch geschlossenen Zeltplatz liegen wir lange wach, ganz allein in den dunklen Nadelwäldern, und lauschen jedem Geräusch. Am nächsten Morgen trifft mich fast der Schlag, als zwei Elche vor mir stehen, groß wie Pferde. Wir frühstücken zu viert – und ich mache keinen Schritt mehr ohne eine gute Pulle Bärenspray!
Auf der anderen Seite der Caldera liegt Montana, „Land of the Big Sky“, das Land des Großen Himmels. Kleinere Pässe und weite Täler vermitteln ein unbegreifliches Gefühl von Weite, Schäfchenwolken lassen ihre Schatten über saftige grüne Wälder ziehen, durchsetzt von blühenden Wiesen und glasklaren Seen. Fisch- und Weißkopfseeadler, Eisvögel und Pelikane jagen in den Gewässern, Hirsche und Elche grasen im Unterholz. Melodramen wie “Der Pferdeflüsterer” wurden in Montana – wo auch sonst? – gedreht, oftmals stoppen wir und schauen uns beide an: Hier könnte man leben!
Ungewöhnliche Polizei patrouilliert vielerorts. Die „Indian Reservations“ sind Staaten im Staat, die Regierungsgebiete der Native Americans, inklusive eigener Polizei, Gesetzgebung und eigener Gerichte. Doch ob Weißgesicht oder Native: Keiner schert sich um die Trucker, die uns täglich von der Straße räumen. Auf dem Asphalt herrscht das Faustrecht. Zeigte man uns noch in Utah den gestreckten Daumen, ist es hier häufiger der Mittelfinger. Wir erwidern den Gruß, man will ja nicht unhöflich sein. „Roadkill“ nennen die Australier überfahrene Possums und Kängurus. Hier ist der Roadkill ebenso zahlreich, in keinem anderen Bundesstaat die Todesrate im Verkehr höher. Alle paar hundert Meter säumt den Straßenrand ein Kreuz mit Plastikblumen.
Als die ersten weißen Siedler vor 200 Jahren in den Prärien Nordamerikas aufkreuzten, ließ noch der Donner von 15 Millionen Bisons die Ebenen erzittern. Da die bulligen Tiere immer wieder Lokomotiven entgleisen ließen und zugleich die wichtigste Nahrungsgrundlage der verhassten “Indianer” darstellten, begann rasch eine erbarmungslose Jagd mit allem, was zur Verfügung stand. Von Maschinengewehren niedergemäht und Granaten in die Luft gesprengt überlebten nur 23 reinrassige Büffel das nur 15 Jahre währende Massaker. Heute haben sich die Bestände stabilisiert und streifen wieder einige große Herden durch verstreute Schutzgebiete.
Der Bericht soll mit einem Lebenskünstler enden, getroffen im Glacier Nationalpark an der kanadischen Grenze. Im Arbeitshemd und mit leuchtenden Augen kommt Dean auf uns zu: “Where are you from? I love foreigners!” Wo kommt ihr her? Ich liebe Ausländer! Dean, pensionierter Schuldirektor, genießt jedes Jahr mehrere Monate an seinem Lieblingsort. Die Ranger lassen ihn seiner (im Nationalpark verbotenen) Passion nachgehen, der Landschaftspflege. Der Wagen ist voll mit Gartenscheren, Sägen, Spaten, mit denen er Wanderwege trimmt oder Aussichtspunkte freikappt. Dean lädt uns zum Abendbrot ein, mehrfach, im Gegenzug giert er nach Geschichten und Ansichten. „Welche Unterschiede gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland? Wie war das Radfahren in Pakistan? Wie funktioniert das deutsche Schulsystem?“ Ein wandelndes Fragezeichen, und selbst wir sind erstaunt, wie viele Ranger, Touristen, Fremde Dean unterwegs „interviewt“, immer auf der Suche nach Antworten. Als Daniel 170 km weiter die Hinterradachse bricht, genügt ein Anruf und Engel Dean liefert Ersatz. Nicht nur wegen seiner Gastfreundschaft ist er uns ein großes Vorbild: Wer sich nicht alltagsmüde im eigenen Kleinklein abschottet, jeden anspricht, dem man Wissen abtrotzen kann, wer sich sein Leben lang geistig zu bequemen weigert und jede neue Erkenntnis als Glück und Hochgenuss empfindet – der zelebriert das Leben, wie es dem Leben gebührt.
Reisebericht USA - Kalifornien & Nevada
USA – Kalifornien & Nevada
28. Februar – 24. März 2018 | 1.580 km, 14.270 hm
Unsere Reise durch die USA beginnt in Kirgistan: Bereits vergangenen Sommer lädt die US-Botschaft in Bischkek zum Verhör, denn wir dürfen nicht bequem vom Zelt aus das übliche Online-Visum ordern. Wir könnten uns ja in Iran und Pakistan mit dem Terror-Virus infiziert haben. Nach einem halbstündigem Interview über Reiseroute und Einkünfte, und um 320 Dollar erleichtert, klebt das Touristenvisum im Pass. Erst Ende Februar machen wir davon Gebrauch und fliegen von Bangkok nach San Francisco. Dort aber hält uns der Heimatschutz am Flughafen fest. Vor allem Daniel macht einen merkwürdigen Eindruck: Als Arzt gekündigt, um durch muslimische Gruselstaaten mit dem Fahrrad zu fahren, mit 10 Kilo Fotoequipment? „Wieso arbeitest du nicht?“, fragt der Beamte. „Warum sollte ich?“, witzelt Daniel. Erst vier Stunden später dürfen wir passieren.
Knapp eine Woche wohnen wir kostenfrei bei Warmshowers-Gastgeberin Trudy in San Francisco. Kaufpreis ihres Häuschens in den 70ern: 160.000 Euro, Verkaufspreis heute: eine Million. Sie lebt im Stadtteil Mission, der besonders attraktiv für Mitarbeiter des nahen Silicon Valley ist, da hier die Shuttlebusse zu deren Büros abfahren. 16.000 aktive Start Ups gibt es in der Region, in Berlin dagegen „nur“ 2.400. Das Einstiegsgehalt bei Apple und Amazon liegt bei etwa 100.000 Euro pro Jahr, entsprechend teuer ist die Wohngegend.
Trudy wird Zeugin bizarrer Szenen: Wie wir mit Wasser aus dem Hahn anstoßen, endlich nicht mehr filtern! Unsere glühenden Augen, als sie ihren galaktisch großen Kühlschrank öffnet. Auch führt sie uns zum nahen Supermarkt – Gänsehaut pur. Wir irren und geistern durch dieses noch vor kurzem Lichtjahre entfernte Sonnensystem aus unendlich vielen Milch-, Joghurt-, Obst- und Chipssorten. Völlig überfordert bleibt der Korb jedoch erstaunlich leer.
Während wir uns an Käse und Brot laben, dienen die riesigen Einkaufswagen noch einem weiteren Zweck: Tausende schieben darin Schlafsack, Schuhe, Zelte und Radios durch die Straßen. Obdachlose hatten wir in den sogenannten „Entwicklungsländern“ Asiens keinen einzigen gesehen. Das familiäre Netzwerk ist dort noch so kompromisslos dicht, dass jeder Einzelne gestützt wird. Zudem kostet eine Zweizimmer-Wohnung in San Francisco im Schnitt knapp 3.000 € Miete monatlich. Und das ganzjährig milde Kalifornien zieht Wohnungslose an wie ein Magnet. Offiziell leben nicht mehr Obdachlose in San Francisco als in Berlin, aber sie fallen mehr auf. Nirgends haben wir so viele offensichtlich schwer psychisch kranke Menschen gesehen, die in Deutschland im Betreuten Wohnen leben würden, hier jedoch ihrem Schicksal überlassen bleiben.
Wir treffen Andy, der in seinem Laden kostenlos das Transportmittel der Unterschicht repariert: Fahrräder. Auch unsere bringt er umsonst auf Vordermann. Andy trägt Stadtgeschichte im Blut: er zählt zu den Schwulen, die sich während der großen AIDS-Epidemie in San Francisco mit dem HIV infizierten. 1981, als die Krankheit noch recht unbekannt war, starben in der Stadt neun Menschen im Jahr, 1992 waren es 30 pro Woche. Schon damals galt San Francisco als Mekka gleichgeschlechtlicher Liebe. Während des Zweiten Weltkrieges versuchte das Militär Homosexuelle loszuwerden und setzte sie in den großen Hafenstädten wie New York, Chicago und eben San Francisco einfach vor die Luke. Heute ist der Anteil von Menschen, die sich selbst der LGBTQ-Szene zurechnen, der höchste in allen amerikanischen Städten.
Wir radeln weiter am Pazifik entlang Richtung Süden und stürzen fast die Klippen hinunter, als wir Fontänen im Meer ausmachen. Unweit der Küste ziehen Grauwale mit ihren Kälbern vorbei! Fischotter tummeln sich in den Tangwäldern und Seeelefanten sonnen ihre fetten Leiber an den Stränden. Die Bucht vor Monterey zählt zu den artenreichsten Meeresgebieten der Welt, die kalten und nährstoffreichen Gewässer beherbergen über tausend verschiedene Spezies.
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten offeriert uns grenzenlose Gastfreundschaft. Nie hätten wir das erwartet! Es vergeht kein Tag, keine Pause, kein Einkauf, kein Käffchen, an dem wir nicht angesprochen, beschenkt oder eingeladen werden. Fragen wir abends nach ein paar Quadratmetern Rasen für unser Zelt, ziehen uns die Bewohner förmlich ins Gästezimmer. Ich frage mich, welcher Deutsche wildfremden Radreisenden spontan seine Dusche anbieten würde? Die Offenheit und Unkompliziertheit der Amerikaner ist sagenhaft und für uns absolut vorbildlich.
„Schau mal ein bisschen traurig und dumm“, ordere ich Daniel an, bevor ich mich im Supermarkt verlaufe. Es ist bereits dunkel und noch immer haben wir keinen Platz für unser Zelt. Er macht seinen Job glänzend. Jonathan lädt uns in das Haus seiner kürzlich verstorbenen Schwiegermutter ein, wir könnten so lange bleiben, wie wir wollten. Bier sei im Kühlschrank, das Bett frisch gemacht, beide Badezimmer mit heißer Dusche. Später wird er berichten, Jesus habe ihn zu uns geführt – oder uns zu ihm, je nachdem.
Wir verlassen die Küste und durchfahren die wohl langweiligste und zugleich wichtigste Ecke Kaliforniens: das Central Valley, den „Fruchtgarten“ der USA. Doch seit Jahren kämpfen die Farmer mit einer Rekorddürre nach der anderen, seit der Schnee in den angrenzenden Bergen ausbleibt und die Flüsse trockenfallen. Wir passieren unzählige verdorrte, herausgerissene Mandelbäume, deren künstliche Bewässerung sich nicht mehr lohnte – ein brutaler Anblick. Farmer Terry lädt uns ein, in seinem Appartement zu übernachten und erzählt von den Hunderttausenden, die er in tiefere Brunnen investiert. Und er ist nicht der Einzige: Überall wird nach Wasser gebohrt, jedes Jahr tiefer und der sinkende Grundwasserspiegel lässt den Boden um bis zu 5 cm pro Monat absacken. Im krassen Widerspruch dazu tropfen überall die Wasserhähne, spülen Toiletten nur im Vollmodus, werden Rasen gewässert und Pools gefüllt. Als gäbe es kein morgen, aber irgendwann ist übermorgen.
Vor uns liegt die Querung des Death Valley, dem heißesten Fleck der Erde und trockensten und tiefsten Punkt der Vereinigten Staaten (einen Golfplatz gibt es trotzdem!). Nicht umsonst galt das „Tal des Todes“ den frühen Goldgräbern auf der Suche nach einer Passage gen Kalifornien als Schreckensort. Auch wir müssen zwischen manchen Wasserstellen zwei Tagesetappen zurücklegen und bunkern einen halben Zentner Extrawasser – 65 Kilo wiegen unsere Lastesel nun. Doch ein kräftiger Rückenwind bläst uns mit bis zu 50 km/h durch die Einöde und wir schaffen trotz des Gewichts und einigen Anstiegen leicht 120 km am Tag. Es ist wie Harley fahren – zurücklehnen und den Film genießen, immer ein Lächeln ins Gesicht gemeißelt.
Im Hochsommer brennt die Sonne gnadenlos und lässt das Quecksilber fast aus dem Thermometer schießen. Eingekesselt von bis zu 3.400 m hohen Bergen zirkuliert die Luft wie in einem Backofen. Knapp 57 °C wurden schon gemessen, auf einem nackten Stein könnte man gar Eier kochen. Ein Mensch verliert bis zu acht Liter Wasser pro Tag – beim Nichtstun im Schatten. Auch uns macht das Wüstenklima zu schaffen und lässt die Fingerkuppen aufplatzen wie überreife Kirschen, trotz eines Rekordverbrauchs an Handcreme.
Die Sierra Nevada im Westen hält die feuchte Luft des Pazifik fern, nur die schwersten Stürme schicken ihre Ausläufer bis hierher – und tatsächlich, es regnet während unseres Besuchs! Im Frühjahr blüht die Wüste, Spuren im Sand verraten jeden Morgen die nächtliche Aktivität der Füchse, Schlangen und Echsen. Mit spitzen Fingern bauen wir unser Zelt ab, oft verbirgt sich darunter eine Überraschung, und immer schön die Schuhe ausklopfen!
Das Konglomerat amerikanischer Stereotype finden wir direkt im Anschluss in Pahrump, gelegen im konservativen Bundesstaat Nevada. Bereits am Ortseingang begrüßt ein waffennärrischer Politiker, hauptberuflich Zuhälter, jeden Besucher in martialischer Pose: „Ich werde für eure Waffen kämpfen!“ Ein Neugieriger spricht uns an, das Gespräch kommt auf Trump und wir können uns einen Witz nicht verkneifen. „Vorsicht, Trump ist mein Buddy!“ Die Kalifornier hatten sich noch vielfach für ihn entschuldigt.
Vorbei an allen Fastfoodketten dieser Welt führt der Weg zum Walmart, einer Art Aldi im XXL-Format. Daniel spielt Verstecken hinter einer Chipstüte, während ich rätsele, wie viele Pfannkuchen ich essen muss, um einen Zehn-Liter-Kanister Ahornsirup aufzubrauchen. Schokoladen-Brownies im Angebot, natürlich greifen wir zu – später werde sogar ich die Glasur abspachteln, die so fett und süß ist, dass sie selbst den hungrigsten Radlermagen verklebt. Dutzende Kunden stützen sich atemlos auf ihre Einkaufswagen, begleitet von Assistenten, die beim Tragen der unzähligen Plastikbeutel helfen – in Kalifornien sind Einwegtüten verboten. Andere rollen in Elektrowagen vorbei, unglaublich schwere Menschen, die kaum noch laufen können. Manche sind nicht älter als 30 und wir haben das Gefühl, ihnen beim Sterben zuzusehen, ganz langsam eben. Die Kassiererin begrüßt mich: „Ihr seht so sportlich aus, ihr seid nicht von hier, was?“
Vollgestopft mit Junkfood folgt ein Ausflug in besonders exotische Gefilde. Wir betreten den erstbesten Gunshop und Waffenhändler James nimmt sich ausgiebig Zeit. Offiziell besitzt knapp die Hälfte der Amerikaner mindestens ein Schießeisen, allein 2017 wurden hier etwa 10.000 Menschen mit Hilfe von Schusswaffen ermordet, Tendenz steigend. Doch James rattert andere Statistiken herunter: „Waffen werden 80 mal häufiger eingesetzt um Leben zu schützen als zu töten.“ So viele Tote würden verhindert, so viele potenzielle Diebe von Überfällen abgehalten. Er reicht mir ein halbautomatisches Sturmgewehr, das meistverkaufte überhaupt, drei Kilo Mordpotenzial. Für einen Achtzehnjährigen ist es in Nevada leichter, diese Wumme legal zu erstehen als eine Büchse Bier.
Eine Knarre im Wagen sei überlebenswichtig, wenn der mal liegen bliebe und falls Ganoven die Situation ausnützten. Es gibt viele „falls“ und „wenns“ in diesem Gespräch. Die Stadt sei zwar sicher, aber falls doch ein Moment der Unsicherheit einträfe, müsse man vorsorgen. „Meine Frau ist Jüdin“, meint James’ Kollege. „Sie traut sich ohne Pistole nicht aus dem Haus. Denkt nur an die ganzen Palästinenser!“ In Pahrump, umgeben von Wüste? Die Frau des Ladenbesitzers arbeitet als Lehrerin und hakt ein: „Zwei Drittel meiner Schüler haben Waffen.“ Man müsse unbedingt Lehrkräfte mit Pistolen ausstatten, pflichtet sie Trump und der NRA bei. In den letzten fünf Jahren gab es über 300 Schießereien an Schulen, selbst der Verkauf kugelsicherer Schulranzen steigt.
Wir sollten uns aber nicht sorgen, die Stadt sei absolut sicher. „Wegen der Leute oder der Waffen?“, will ich wissen. Alle drei antworten gleichzeitig, wie aus einer Pistole geschossen (…): „Na, wegen der Leute!“ Trotz der verqueren Logik sind wir dankbar: knapp eine Stunde haben wir viele Fragen gestellt und ausführliche Antworten erhalten. Auch wir sind über unseren Schatten gesprungen: Wann haben wir uns zuletzt in Deutschland so intensiv mit der politischen Gegenseite ausgetauscht? Jetzt müsste man sich nur noch an einen Tisch setzen und Kompromisse schließen.
Ebenjene Auseinandersetzungen werden uns weiter begleiten. „Steckt eure Nasen nicht in politische Angelegenheiten“, wurden wir gewarnt – doch warum eigentlich nicht? Tatsächlich war uns unwohl zumute bevor wir nach Trumpistan reisten, doch es sind immer wieder ausgesprochen herzliche und weltoffene Leute, die sich als seine Wähler outen. Wer das Gerücht verbreitet hat, die Amis seien oberflächlich, muss in einem UFO durch das Land gedüst sein. Tiefgründige Gespräche aller Art nehmen uns auf in die Mitte der Gesellschaft und geben uns das Gefühl, nicht mehr nur zu zweit unterwegs zu sein. „In Asien reist ihr, in den Staaten macht ihr Urlaub“, so hatte es ein Tourist Monate zuvor prophezeit, und er sollte Recht behalten. Neben der landschaftlichen Vielfalt genießen wir die westlichen Annehmlichkeiten, nur getoppt von der grenzenlosen Offenheit und Geselligkeit der Menschen. Und wie groß die Hilfsbereitschaft und Gastliebe sein kann, werden wir nur einige hundert Kilometer weiter in Arizona und Utah erleben… Fortsetzung folgt.
Reisebericht Thailand
Thailand
30. Januar – 27. Februar 2018 | 1.170 km, 3.850 hm
Pünktlich um 12 brummt der Magen. Garküchen gibt es in Thailand an jeder Straßenecke, aber diese ist besonders hübsch. Weiße Tischdecken, Blumenbouquets, dralle Köchinnen schmecken das Curry ab und winken uns zu. Keine Frage, hier wollen wir hin! Hungrig ordern wir allerlei Köstlichkeiten, Bananen, Cola, zwischendurch die kurze Frage nach dem Preis, aber der Kellner winkt ab: „No money, free.“ Umsonst, nein, dazu wären wir zu gierige Gäste. Bei der Menge wollen wir zahlen. Doch seine Antwort lässt uns schlucken: „Das ist kein Restaurant. Das ist die Beerdigung meiner Oma und ihr seid herzlich eingeladen!“ Mit rotem Kopf schauen wir uns an, dann um und erschrecken – den Sarg mit Foto direkt hinter dem Buffet hatten wir bei aller Hungerhast völlig übersehen. Eine Einladung zum Leichenschmaus – peinlich berührt nehmen wir an. Eine buddhistische Beerdigung in Thailand dauert mehrere Tage, das gesamte Umland kommt vorbei und die Angehörigen reichen Essen und verschenken sogar Geld. So soll es der Verstorbene, beseelt von einem möglichst gutem Karma, im nächsten Leben noch besser haben. Die Gastfreundschaft der Trauergemeinde manövriert unsere mürben Seelen vollends aus der Krise vergangener Wochen.
Die letzten Tage waren mies. Wieder einmal müssen wir mit einer Giardien-Infektion und Durchfall Distanzen schrubben, aller Schlappheit und der schwülen Hitze zum Trotz. Dann geben die Abgase Daniel den Rest: eine eitrige Luftröhrenentzündung mit Fieber und Schüttelfrost. „Ich bin reisemüde“, presst er heraus. Ein Satz mit Sprengwirkung. „Nein, du bist krank und asienmüde“, versuche ich das schwarze Loch zwischen uns zu füllen. Denn wenn einer nicht mehr weiter möchte, platzt die gesamte weitere Reise. Daniel ist so matt, dass wir aus lauter Angst vor Malaria und Dengue ein privates Krankenhaus aufsuchen. Hunderte Patienten warten in dessen Empfangshalle und ich rechne mit dem Schlimmsten. Doch letztlich funktioniert dieses Thai-Spital besser als ein deutsches Modell: dem Arztgespräch folgen umgehend Labortests, die Medikamente inklusive Wurmkur erhalten wir in der integrierten Apotheke und zahlen mit VISA-Karte. Nach nur drei Stunden sind wir fertig, weniger als 80 Euro kostete alles zusammen. Nicht umsonst sind Thailand, Indien und Singapur Top-Ziele für westliche Medizintouristen.
Knapp zwei Wochen genießen wir völlig steigungsfreies Fahren, Genussradeln pur. Mittags und abends erfrischen wir uns in den sanften Wellen des Thailändischen Golfes. Unser Budget reizen wir aus, denn das Zelt hat Pause. Stattdessen entspannen wir in klimatisierten Bungalows am Strand, mit Meeresrauschen als Soundkulisse. Bierchen, Sektchen, hier und da ein Fruchtshake. Wir verstehen es wieder zu leben!
Doch dem paradiesischem Anschein zum Trotz: Beim Schwimmen verheddere ich mich in Plastiktüten, bei Strandspaziergängen waten wir durch Müll. Steigender Lebensstandard und Massentourismus (also auch wir) führen im ganzen Land zu enormen Umweltproblemen. Knapp 40 Millionen Besucher urlaubten hier 2017, damit liegt Thailand auf Platz drei der umsatzstärksten Reiseziele weltweit, direkt hinter den USA und Spanien. Tendenz steigend. Ungeklärte Abwässer verwandeln ganze Buchten in Kloaken. Jährlich gelangen 700.000 Tonnen Plastikmüll ins Meer, denn Abfall wird schlicht im nächsten Bach entsorgt. Das kleine Land zählt zu den fünf größten Meeresverschmutzern überhaupt und alleine im Golf von Thailand finden sich mehrere Müllteppiche, mitunter nur 10 Kilometer entfernt vom Badestrand.
Doch trotz des touristischen Dauerbooms erfuhren wir seit Pakistan nicht mehr soviel Gastfreundschaft, und das in einem Land, das seiner zahllosen Gäste eigentlich überdrüssig sein dürfte? Ob Bananen, Wasser, Papayas oder Reis – täglich beschenkt man uns reichlich. Anders als in Laos zahlen wir oft weniger als das Preisschild angibt. Und ja, nicht nur einmal werden wir zum Leichenschmaus eingeladen.
Einige Nächte verbringen wir bei Gastgebern der Warmshowers-Gemeinschaft, einer Online-Plattform, bei der Einheimische kostenfrei Radreisende beherbergen. Zu Gast bei einem älteren Ehepaar stolpern wir in die nächste Peinlichkeit. Nur oberflächlich hatten wir uns über das Land informiert und fangen prompt an, sie über den neuen König auszuquetschen – der sich regelmäßig mit seinen Mätressen in Bayern herumtreibt. Lächeln und Schweigen verschwimmen in ihren Gesichtern. Erst Tage später erfahren wir: Wer schlecht über den König spricht, landet im Knast. Jeder kann dabei jeden denunzieren. Ein Schweizer Tourist verzierte einmal das Porträt des Herrschers mit Graffiti – und wurde wegen Majestätsbeleidigung zu zehn Jahren Haft verurteilt.
In Bangkok angekommen, bleiben nur wenige Tage, um die Räder zu verpacken und uns auf die nächste große Etappe vorzubereiten. In den kommenden Monaten wollen wir von San Francisco durch die amerikanischen Nationalparks und kanadischen Rockies bis nach Alaska radeln. Wir sind schon ganz hibbelig mit Blick auf die weiten Landschaften Nordamerikas, die saubere Luft, das westliche Essen. Ein kurzes Fazit unserer Asientour wollen wir dennoch ziehen und das geht am besten anhand von Fragen, die uns unterwegs immer wieder gestellt wurden.
Wie schafft ihr es, als Paar 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche zusammen zu sein?
Reden, reden, reden. Außer bei besonders anstrengenden Etappen – dann besser den Mund halten, sonst lassen wir den Frust am Partner aus. Letztlich betrachten wir es als großen Luxus, uns nicht wie zuhause nur kurz am Morgen und Abend zu sehen.
Was vermisst ihr am meisten neben Familie und Freunden?
Daniel: deutsches Brot, Pizza, Elektrorasierer, auf der eigenen Couch lümmeln. Claudia: Omas Rahmkuchen, Wasserkocher, ab und an Privatsphäre.
Was kosten die Räder? Wie könnt ihr euch diese Reise leisten?
Wir flunkern meist und behaupten, die Räder seien ein Geschenk unserer Eltern und wir wüssten den Preis nicht. Mit Erspartem, Sponsoren und Verzicht kann man einige Zeit mit Rad und Zelt unterwegs sein. Ein Auto inklusive Versicherung, Sprit und Reparaturkosten frisst vermutlich genauso viel Geld wie die gesamte Tour.
Ist es als Vegetarierin schwierig, unterwegs satt zu werden, Claudia?
Nein, ich brauche nur etwas mehr Geduld bei der Bestellung. Ich bitte immer die erste englisch sprechende Person in jedem neuen Land, mir schriftlich zu übersetzen: Kein Fleisch, kein Fisch und keine Fischsoße. Diesen Zettel zeige ich dann. Oder ich nutze Google Translate als Offline-Übersetzer auf dem Smartphone.
Daniel, wie fotografierst du die Menschen, wie euch beide auf dem Rad?
In den allermeisten Fällen bitte ich vorher um ein Foto und gebe mich auch mit einem „Nein“ zufrieden, was aber nur sehr selten der Fall ist. In manchen Gegenden sind die Menschen sehr scheu. Dann zeige ich ihnen ein Porträt irgendeiner anderen Person. Meist bricht dann das Eis und die Marktweiber stehen Schlange…
Für Fotos von uns beiden verwende ich ein Stativ, Fernauslöser oder die Zeitverzögerung. Ich reise mit zwei Kameras und mehreren Objektiven sowie allerhand Zubehör, insgesamt kommen 10 kg zusammen.
Was waren die wichtigsten Erkenntnisse während der Zeit in Asien?
Der familiäre und soziale Zusammenhalt hat uns stark beeindruckt. Es gibt keine Diskussion über zu wenige Pflegeheime, denn die Angehörigen kümmern sich selbstverständlich um die Älteren in ihrem Kreis. Kinder wachsen mit den Großeltern auf. Vereinsamung ist kein Thema.
Wo immer wir anklopften, haben wir uns selten als Fremde denn viel mehr geladene Gäste gefühlt, so selbstverständlich wurden wir beschenkt und beherbergt. Oft brachten uns Einheimische Früchte oder Wasser ans Zelt. Diese bedingungslose Gastfreundschaft hat uns sehr berührt. Nur in den wohlhabendsten Ländern der Welt, Deutschland und Schweiz, wurde uns bisher Trinkwasser verweigert („Wenn mich jeder danach fragte, wäre ich ja arm.“), was uns bis heute schockiert. Einfach unvorstellbar in Asien, wo selbst jene, die nichts hatten, doch alles teilten. Nicht jeder kann oder will reisend natürliche Ängste und Vorurteile abbauen. Wir haben uns deshalb entschieden, die Amadeu Antonio Stiftung zu unterstützen, die innerhalb Deutschlands Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit fördert und Opfern rassistischer Gewalt schnelle Hilfe bietet.
Reisebericht Laos
Laos
03. – 30. Januar 2018 | 1.030 km, 13.180 hm
Feuerspeiende Vulkane, berstendblaue Gletscher, nach jeder Wendung neue Exotik – all das gibt es in Laos nicht. Dennoch prickelt das Blut in meinen Adern, als unsere Räder laotischen Boden berühren. Denn hier krachte 2014 ein Schweizer Radelpaar in unser Leben. So stark war der Drang, es ihnen gleichzutun. Mit dem Fahrrad die Welt bereisen, in ihre Privatsphäre eindringen. Losradeln und anhalten, wann immer es uns passt! Wenn eine einzige Begegnung gutbürgerliche Pläne in die Tonne katapultiert, dann war es diese.
Laos, eines der ärmsten Länder der Erde, wird seit über 40 Jahren von ein und derselben sozialistischen Partei geschunden. Vom Rest der Welt kaum wahrgenommen, zählt das Land jedoch zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften, es ist reich an Ressourcen wie Mineralien, Edelmetallen, Wasserkraft und Wäldern. Im krassen Widerspruch dazu müssen 75 Prozent der Einwohner ihr Leben nach wie vor mit weniger als 2 € am Tag „gestalten“. Schuld daran sind unter anderem Korruption, ein desolates Verkehrsnetz und ausländische Firmen, die ihre eigenen Arbeiter mitbringen. Vor allem China und Thailand investieren Unsummen in Infrastrukturprojekte wie Wasserkraftwerke und Schienennetze – hauptsächlich jedoch, um die „Batterie Asiens“ anzuzapfen und Absatzmärkte für Exportgüter zu gewinnen. Den Menschen vor Ort bringt diese Expansionspolitik kaum etwas, außer immenser Umweltzerstörung, Verkehrslärm und noch mehr Müll.
Die Armut zeigt sich zunächst von ihrer zuckersüßen Seite. Haben wir im schülerdrillenden China allerhöchstens Babys zu Gesicht bekommen, flitzen uns unweit der laotischen Grenze bereits hunderte Kinder entgegen und rufen mit fiepsigen Stimmchen „Sabaidee,, Sabaidee“, „Hallo, Hallo!“. Ein Drittel der Laoten sind Kinder unter 14 Jahren. Viele verlassen bereits nach fünf Jahren die Schule, ab 12 darf man per Gesetz Vollzeit arbeiten. Laut Unicef erreichen etwa 64 von 1.000 Kindern ihren fünften Geburtstag nicht, in Deutschland sind es vier. Rotznasen, schmutzige Kleidchen, keine Schuhe. Die offensichtliche Armut verleitet manch einen zu seltsamen Gesten der Hilfsbereitschaft: Wir erleben einen Touristen, der die Kinder wie im Sportunterricht einreihen lässt, um ihnen dann druckfrische Dollarscheine zu schenken (sofern sie sich auch brav melden). So erzieht man also Bettler.
Unweigerlich werden wir zu Voyeuren, denn in den fensterlosen Bambushütten schläft man höchstens, gelebt wird draußen! Intimsphäre und Öffentlichkeit verschmelzen am Straßenrand. Überall lodern kleine Feuer, Sammelpunkt für Familien und Klatschtanten. Schon auf den ersten Radkilometern hasten unsere Augen hin und her. Stürmen von Schlachtungen fetter Säue, denen das Blut aus der Gurgel sprudelt, weiter zu Hahnenkämpfen und Glücksspielen. Staunen über nackte Männer, Frauen, Kinder, die ihre Leiber an zentralen Wasserstellen schrubben. Tanzen mit ganzen Dörfern ins Wochenende und stoßen an mit viel Lao-Schnaps, der selbst den kargsten Ort immer freitags in kirmesähnliche Zustände berauscht.
Und wir entwickeln lebhafte Mordfantasien gegenüber laotischen Straßenbauern, denn die haben die Serpentinen vergessen. Stattdessen schneiden die Straßen Berge und Täler in gnadenloser Konsequenz: 15 oder gar 20 Prozent Steigung sind keine Seltenheit. Zu oft jedenfalls zu steil für uns, wir steigen ab und schieben. In der tropischen Mittagshitze rinnt der Schweiß vom Bauch durch den Schritt und regnet von den Füßen – aber es geht, ich hätte nicht gedacht, dass man über Kilometer hinweg ein voll beladenes Reiserad eine Art Skateboard-Rampe hinauf schieben kann. Hinten sausen wir wieder hinunter, bis die Bremsscheiben glühen. Ein kräftezehrendes und brutales Fahren, nach ein paar Tagen ist mein Tretlager locker.
Doch der eigentliche Nervenkitzel kommt am Abend, dann beginnt die Zeltplatzsuche. Manche Gebiete, vor allem im Osten des Landes, sind mit etwa 80 Millionen Minen und Blindgängern verseucht. Laos ist das am meisten bombardierte Land der Welt, gemessen an seiner Einwohnerzahl. Die Amerikaner ließen im „Vietnamkrieg“ 270 Millionen Streubomben regnen, um den Ho-Chi-Minh-Pfad zu zerstören, die Hauptversorgungsroute der Nordvietnamesen. Noch heute sind 30 Prozent davon tickende Zeitbomben. Wir vermeiden es daher tunlichst, ausgetretene Wege zu verlassen. Anderswo patrouillieren Rebellen mit Kalaschnikows. Nachts knallt es oft in den Wäldern und passieren bewaffnete Wilderer unser Zelt, die schlafende Vögel und nachtaktive Nager von den Bäumen ballern. Mehrmals brechen Wasserbüffel aus der Dunkelheit und bahnen sich, schnaubend wie eine Dampflok, ihren Weg am Zelt vorbei. Nicht auszumalen, würde sich eines der massigen Tiere in den Leinen verheddern. Längst haben wir uns an die pflaumengroßen Taranteln, halbmeterlangen Regenwürmer, Moskitoschwärme und Mäuse gewöhnt. Nur eine papierdünne Membran trennt uns von all diesen realen Unheimlichkeiten und meist trage ich Ohrenstöpsel, nach dem Motto: was ich nicht höre, gibt’s auch nicht.
Das größte Problem jedoch sind die allgegenwärtigen Ameisen. Mit einem durchlöcherten Zeltboden und dem Gesicht voller bissiger Krabbeltiere aufzuwachen, wie es anderen schon passiert ist (!), wäre unser persönlicher Albtraum. Peinlich genau untersuchen wir daher einen potentiellen Lagerplatz auf Ameisenstraßen, markieren No-Go-Areas und inspizieren jedes Erdloch auf seine Untermieter.
„Da klopft was!“ Claudia ist hellwach. Tatsächlich, es klingt, als würden unzählige Finger rhythmisch und koordiniert von unten gegen die Isomatten klopfen. Heute haben wir scheinbar einen Termitenbau übersehen, dessen Bewohner die feindliche Besatzung spät in der Nacht bemerkt haben und auf der Zeltplane nun buchstäblich Verstärkung zusammentrommeln. Wir liegen regungslos und hoffen auf Frieden, doch es hilft nichts: das erste von insgesamt drei Mal in dieser Nacht müssen wir einpacken und das Zelt ein paar Meter weiter erneut aufbauen.
Immer häufiger steuern wir abends buddhistische Klosteranlagen an, deren Mönche uns stets willkommen heißen und als Highlight des Tages ihre Eimerdusche überlassen. Sichere Refugien mit samtweichen Rasen, ohne Büffel, ohne Wilderer, ohne Schüsse. Fast jeder junge Mann verbringt zumindest ein paar Wochen seines Lebens im Kloster und gilt erst danach als „reif“, die Zeiten der Enthaltsamkeit sind also nur vorübergehend. So wundert es nicht, dass die jungen Novizen genauso den weltlichen Genüssen erliegen wie wir auch: Smartphones, Zigaretten, Beer Lao. Die hochangesehen Mönche werden von der Dorfgemeinschaft am frühen Morgen mit allerlei Gaben versorgt. Wir beobachten das Kommen und Gehen der Dorfbewohner aus dem Zelt heraus – und werden im Gegenzug genauso aufmerksam beäugt. Die Klöster sind häufig zentral im Dorf gelegenen, sodass Horden neugieriger Kinder jeden unserer Handgriffe beobachten. Auch die Eltern kommen gerne kucken. Manche verfolgen uns sogar bis ins „Badezimmer“, wann lässt sich denn sonst ein nacktes Bleichgesicht aus der Nähe inspizieren? „Falang, Falang“, tuschelt es um uns herum: „Weißgesichter“. Die Türe hinter sich zumachen können, Füße hoch auf die eigene Couch. Ein ferner Luxus.
Obwohl uns ein Mönch zum Abschied segnete… kurz vor Luang Prabang passiert es. Ich trinke zu wenig, da am Boden der Plastikflasche schon wieder Algen wachsen. „Heute Abend wird die ausgekocht!“, nehme ich mir vor. Etwas schwummrig vor den Augen rutsche ich in einer Schottergrube aus und bremse mit dem Knie. Sofort blitzt die Frage auf: Ist etwas gebrochen? Nein, ich kann aufstehen. Blut rinnt mein Bein hinunter. Ich bin eine Memme, heule, kann mein Blut nicht sehen. Ich wünschte, ich könnte in Ohnmacht fallen und das Bewusstsein erst wieder anknipsen, nachdem der Kies aus der Wunde gespült ist und der Verband sitzt. Doch das Radlerleben ist kein Ponyhof. Und uns ist beiden klar: Diese Reise kann eher früher als später vorbei sein.
Ein ganz besonderer Krankenbesuch erwartet uns in Luang Prabang: unser Leipziger Freund Marci fliegt ein und schon wieder kullern die Tränen, dieses Mal aber vor Freude. Nach neun Monaten „einsam zu zweit“ lechzen wir nach Kontakt zu unseren Freunden. Marci, selbst viel in der Welt und auf dem Rad unterwegs, ist die lang ersehnte Linderung unseres Heimwehs.
Gemeinsam futtern wir uns durch Baguette-Stände und Nachtmärkte und streifen durch die wohl charmanteste Stadt Südostasiens. Dutzende reich verzierte Tempelanlagen bestimmen das Bild des am Mekong gelegenen Weltkulturerbes. Noch vor 30 Jahren von der Außenwelt nahezu abgeschottet, prallen in Luang Prabang seit dem Unesco-Label buddhistische Hochkultur und Massentourismus in rasender Geschwindigkeit aufeinander.
Damit sich mein verbeultes Knie noch ein paar Tage schonen kann, schippern wir auf dem Mekong Richtung Thailand. Laos hinterlässt gemischte Gefühle. Es gibt Streckenabschnitte, da jubelt man uns zu wie den Langstreckenläufern beim Leipziger Stadtmarathon, ein einzigartiger Ansporn, der alle Strapazen wieder wett macht. Andernorts winken noch nicht einmal die Kinder und fühlen wir uns wie wandelnde Geldbeutel. Weshalb die Gastfreundschaft der Laoten so variiert, können wir uns nicht erklären. Und wir merken, dass uns etwas fehlt: weite Landschaften, mehr Privatsphäre und Nächte ohne Ohrenstöpsel. Dennoch sind wir dankbar, das Land noch einmal auf den Rädern erkundet zu haben – so viel mehr haben wir erlebt, soviel unabhängiger konnten wir reisen!
Reisebericht China - Yunnan
China - Yunnan
08. November 2017 – 03. Januar 2018 | 2.140 km, 26.920 hm
Ich sitze am Straßenrand und schluchze, Tränen vermischen sich mit Schweiß und Dreck. Wieder einmal haben wir uns in einer Endlosbaustelle Chinas verfranst, krachen Kolonnen aus Schwerlasttransportern, Sattelschleppern und Traktoren vorbei. Offene Zweitaktmotoren ohne Schalldämpfer, die an den steilen Hängen dröhnen wie startende Düsenjets. Selbst durch die Ohrenstöpsel wummert es. Bergauf „atme“ ich inzwischen durch die Nase, unablässig ballert uns der Gegenwind Abgase und Zement ins Gesicht. Wir werden beständig von der Bahn gehupt, weil Zeit = Geld und Geld ist wichtiger als Zeit. Nicht nur wir stehen dem Wachstum im Wege, ganze Dörfer verschwinden im Staub. Doch außer uns scheint das niemanden zu stören. Denn der Bausand von heute bildet das Fundament für die Zukunft und der Lärm der Motoren ist der Sound von Fortschritt und Moderne.
In den vergangenen zehn Jahren installierte China 80.000 km Autobahn, das längste Netz für Hochgeschwindigkeitszüge, die längste Brücke (164 km) und selbstverständlich auch das größte Einkaufszentrum der Welt – mit 1.500 Geschäften. Innerhalb von drei Jahren fraß der Bauwahn mehr Beton als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Die Kommunistische Partei braucht Superlative, um die Spannungen zwischen Bettelarmen und Superreichen, Bauern und Großstädtern zu glätten und den Unmut gegen Korruption, horrende Mieten und vergiftete Babynahrung zu besänftigen.
Präsident Xi Jinping will mit Nationalstolz den gesellschaftlichen Flickenteppich noch enger knüpfen. Er kreierte den markigen Slogan vom „Chinesischen Traum, dem Wiederaufstieg der chinesischen Nation“, der nun von Kashgar bis Peking das Volk auf monumentalen Plakaten antreibt. Bis 2049, dem 100-jährigen Geburtstag der Volksrepublik, soll China die geopolitische, wissenschaftliche, militärische und natürlich wirtschaftliche Weltmacht sein.
Diesen feuchten chinesischen Traum baden wir nun also aus. Im Rahmen seiner „Go West“-Strategie werden die Handelsrouten der ehemaligen Seidenstraße fit gemacht für die Exportkolonnen in Richtung Europa. Der Karakorum-Highway wird in ein paar Jahren eine LKW-Hölle sein, ebenso die maigrünen Hügel Kirgistans, all die wunderschönen Länder, durch die wir in den vergangenen Monaten reisten. Das Gefühl von Ohnmacht hängt wie Blei an uns und den Rädern. Wir denken zurück an die geselligen Runden im Kreise zentralasiatischer Familien. Das Abendessen stammte fast vollständig aus dem heimischen Garten und wurde restlos verputzt, denn Nahrung wurde als das angesehen, was es ist: eine wertvolle Ressource. Müll entstand, wenn überhaupt, nur in geringen Mengen, Strom und Netzempfang gab es meist nur sporadisch. Wir plauderten, bis uns die Augen zufielen, das Smartphone erfüllte nur den Zweck der Übersetzungshilfe. Aber: es fehlte uns an nichts.
Ankunft im chinesischen Kunming: unser Abendessen verschwindet fast in dessen Verpackungsmüll, am Nachbartisch bleiben ganze Menüs unangetastet zurück, genauso halbvolle Kippenschachteln – Verschwendung gilt als Statussymbol. Ein Konsumtempel reiht sich an den nächsten, Werbung prasselt unablässig auf die Passanten ein, die vertieft in ihre digitalen Begleiter unfreiwillig zusammenstoßen. Die SUV blitzen und blinken und wenn sich die Türen öffnen, entsteigt zunächst das Smartphone, dann der Selfie-Stick, zuletzt der Fahrer.
Hinzu kommt die unüberwindbare Sprachbarriere, die uns kaum tieferes Verständnis entwickeln lässt. Ich kann mich selbst nach Wochen nur schwer an die animalischen Tischmanieren gewöhnen, das Schmatzen und Schlürfen, das geräuschvolle Spucken, als ob sich jemand erbricht, das aber der inneren Reinigung dient. Claudia stört vor allem, dass immer und überall gequalmt wird, selbst während des Essens. Mütter animieren ihre Kinder, in Mülleimer oder den Eingang des Restaurants zu pinkeln, direkt neben uns. Manch einer popelt, dass ich Angst um sein Riechzentrum habe. Es sind diese Eigenarten, die uns immer wieder erschaudern lassen, wir können nicht anders, und das ist nicht fair.
Denn entgegen unserer Erwartungen sind die Chinesen nett, sehr sogar, hilfsbereit und angenehm distanziert. Die Provinz Yunnan ist etwas größer als Deutschland, aber deutlich weniger dicht besiedelt und die zweitärmste der Volksrepublik. Allein hier leben 36 Minderheiten, in ihren bunten Kostümen angenehme Farbtupfer im Einheitsgrau urbaner Betonlandschaften.
Einer der großen Gastgeber des Landes sitzt auf einem Plastikhocker und ist der leibhaftige Strich in der Landschaft. Nach einem Deutschkurs gab er sich den Kosenamen „Ferne“. Ein paar Tage dürfen wir kostenfrei unser Zelt auf seiner Dachterrasse in Dali aufstellen. Ferne spricht fließend Englisch, diskutiert leidenschaftlich über Politik und ist damit wohl genauso ein Exot hier wie wir Weißgesichter.
Bei einem Gläschen frage ich ihn, was er von dem neuen Punktesystem hält, doch er ist völlig ahnungslos, was uns wiederum schockiert. Denn schon 2020 will Peking ein reichlich perverses Rating einführen, das jeden der 1,3 Milliarden Chinesen nach dem Grad seiner Staatskonformität bewertet. Als Datenquellen dienen Kranken- und Gerichtsakten, Finanztransaktionen, aber auch Online-Suchanfragen und -Einkäufe, Einträge in sozialen Netzwerken, Fitness- und Bezahl-Apps. Ein gewaltiger Datenschatz, Pilotprojekte laufen bereits.
Bist du der perfekte Staatsbürger? Dann treibst du Sport, engagierst dich ehrenamtlich und liest die Parteizeitung. Dir winken hohe Sozialleistungen, Beförderungen, Vorteile bei der Kreditvergabe und erleichterte Reisegenehmigungen. Äußerst du dich kritisch im Netz, rast wie ein Formel 1-Pilot, magst Pornos und Pommes? Dann drohen Minuspunkte und somit erschwerte Versicherungs- und Kreditbedingungen oder gar der Jobverlust. Kein Witz, sondern Wirklichkeit! Die individuelle Punktzahl ist auch in sozialen Netzwerken öffentlich einsehbar und wird schon jetzt von Heiratsagenturen als Statussymbol genutzt. Wir fragen uns, wann Peking „Gedankenverbrechen“ ahndet und „Doppeldenk“ verordnet? „Am besten, du wirfst dein Handy ins Klo“, raten wir unserem Gastgeber Ferne. Er verstummt eine Weile, bevor er kommentiert. „Ich habe inzwischen gelernt, Dinge auszuhalten.“ Widerstand zu leisten bleibt in China eine Überlebensfrage.
Wieder auf den Rädern, ziehen die Tage ereignislos vorüber wie die Schäfchenwolken am Horizont. Nachdem uns die Polizei bei Kashgar aus dem Zelt jagte, sind wir immer noch arg verunsichert, was das wilde Kampieren anbelangt. An den steilen Bergflanken finden sich zudem kaum Zeltmöglichkeiten und flaches Terrain wird vollständig landwirtschaftlich genutzt. Wir quetschen uns zwischen Gewächshäuser und Plantagen für Kaffee, Bananen und Zuckerrohr, zelten versteckt auf Trampelpfaden inmitten des Regenwaldes. Anfangs ist die Unsicherheit, wieder gemeldet und abgeführt zu werden, ein lästiger Begleiter. Wir schlafen unruhig und erwachen, wenn es im Gebüsch knackt oder ein Scheinwerfer unseren Palast streift. Doch die Sorgen sind unbegründet, die passierenden Bauern sind entweder erstaunt oder erstaunlich desinteressiert.
Obwohl wir die Subtropen während der Trockenzeit besuchen, fallen die Temperaturen manchmal unter den Gefrierpunkt. Nicht selten starten wir morgens im dampfenden Tiefland, queren die Wolkendecke in dichtestem Nebel und bibbern in eisigen Winden auf der Passhöhe. Das größere Ungemach jedoch bringt die manchmal extrem hohe Luftfeuchtigkeit von knapp 100 Prozent. Am Morgen ist unser Hab und Gut pitschnass und wir haben Mühe, die Utensilien im Laufe des Tages wieder zu trocknen.
Das Höhenprofil in Yunnan ähnelt mitunter der Kauleiste eines Krokodils. An- und Abstiege von 30, 40 Kilometern sind an der Tagesordnung, vor allem auf dem Weg zu den Reisterrassen der Hani. Je näher wir ihnen kommen, desto nervöser zucken Daniels Finger und desto lauter schnurrt und surrt die Kamera. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte haben die Hani-Bauern ein kunstvolles Mosaik angelegt, das wie eine Leiter gen Himmel steigt – die einzige Möglichkeit, in dem unwegsamen Terrain Landwirtschaft zu betreiben. Der Regen der Berge wässert die Felder über ein komplexes System aus Bambusrohren. Um die Monokultur zu düngen, setzen die Hani Aale, Krabben und Enten in die gefluteten Felder, Wasserschnecken futtern die Schädlinge. Dieses ausgeklügelte wie nachhaltige System extensiver Landwirtschaft bewog die UNESCO 2013 dazu, das Gebiet in die Liste der Weltkulturerbe aufzunehmen.
Wir nähern uns der laotischen Grenze und freunden uns mehr und mehr mit der Umgebung an. Der Regenwald wird dichter, die Menschen ärmer. Und so zynisch es auch klingt: für uns Radtouristen ist Armut spannender als Reichtum. Denn das Leben spielt sich direkt am Straßenrand ab: die Menschen spielen Karten, waschen sich, schlachten Hühner. Und sie grüßen uns öfter.
Nach zwei Monaten verlassen wir China letztlich erleichtert. Wir fragen uns, wie man inmitten all des Staubs und Geräusch-Terrors leben kann. Ich bedauere, dass der Westen dem Osten kein alternatives Fortschrittsmodell anbieten konnte, im Gegenteil, China treibt unseres noch auf die Spitze. Wohlstand und Fortschritt versprechen viel, meinen jedoch in ihrer jetzigen Ausformung nur das Gleiche wie Zerstörung und Desozialisierung. Natürlich wussten wir das irgendwie verschwommen im Voraus, aber durch dieses „Wirtschaftswunder“ mit dem Fahrrad zu fahren und am eigenem Leibe zu spüren, wie die Moderne alles niederwalzt, bringt uns völlig aus der Fassung. Uns schwant, dass auch die erneuerbaren Energien keine „Heilsbringer“ sind, denn um Gemeinsinn und Umwelt zu erhalten, braucht es von allem weniger: weniger Wachstum, weniger Konsum, weniger Verschwendung. Bescheidenheit und die Frage, was wirklich notwendig, was wirklich wichtig ist – das müssen Leitgedanken eines Lebensstils sein, der zukunftsfähig ist. Und wer braucht eigentlich Selfie-Sticks?
Reisebericht Pakistan
Pakistan
27. September – 08. November 2017 | 1.470 km, 18.850 hm
Es gibt ein Ereignis, von dem wir alle haargenau wissen, wo und wie wir es erfuhren. Selbst wir als Kinder kannten plötzlich die Taliban. „Seit 9/11 kommen deutlich weniger Touristen zu uns nach Pakistan“, seufzt unser Gastgeber Imran und schenkt dampfenden Pakistani Tee ein. Starker Schwarztee mit sahniger Milch und viel Zucker. Er reicht einen Kristall aus Salz und ermuntert uns, ihn darin einzutunken. Das salzigsüße Getränk wird uns später vorkommen wie sein Land selbst: ein einziger Widerspruch.
Eigentlich hatten wir nicht vor, ein Rad über die pakistanische Grenze zu setzen. Hier fassten die Amerikaner Osama bin Laden und die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beruhigen auch nicht gerade. Bombenexplosionen und Terroranschläge, drei Radreisende wurden zuletzt entführt, ein Dutzend Bergsteiger erschossen und alleine im vergangenen Jahr 700 Mal der Ehre wegen gemordet. In der Islamischen Republik richten Militär und Scharia-Gerichte und verhängen Todesurteile gegen Minderjährige. Doch in dieses vermeintliche Moloch aus Gewalt und Extremismus führt eine der höchsten, spektakulärsten Fernstraßen der Welt: der Karakorum-Highway.
Beginnend im chinesischen Kashgar, quert der Highway das schroffe Karakorum-Gebirge, umzirkelt den Nanga Parbat und endet in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Bis vor Kurzem noch ein einspuriges Schotter-Abenteuer, baute China die Fernstraße zu einer modernen Schnellstraße aus und ergänzte sie gar um einen eigenen Hafen in Karachi, um sich so einen effizienten Zugang zum Indischen Ozean zu verschaffen. Noch ist das 400-Millionen-Dollar-Projekt nicht fertig, ein Glück für uns, denn nur wenige rußende Trucks stottern vorbei. Flüsterasphalt, geringe Steigungen, kaum Verkehr – ein Radlertraum!
Als wir das erste Städtchen erreichen, wähne ich mich in Kabul, sind wir hier wirklich richtig? Uns erwarten ausnahmslos Männer in traditioneller Kleidung, weiten Pluderhosen, mit brustlangen Bärten, mancher mit dunkel geschminkten Augen. Vor unserem Hotelzimmer patrouilliert ein Polizist mit Kalaschnikow. Einer kommt auf mich zu, ein finsterer Blick, dann ein Lächeln. „Es ist so toll, dass ihr hier seid. Lasst uns Tee trinken!“ Er umarmt mich, und fragt auch Claudia: „Darf ich dich mal drücken?“
„Ihr müsst einen Tag pausieren“, warnen uns Imran und seine Schwester. Weiter unten würden die Schiiten eine Prozession abhalten, die Straßen seien deshalb gesperrt. Einen Tag verbringen wir daher in Imrans abgelegenen Bergdorf, das mich völlig überraschend in mein Leipziger Studentenleben zurückbeamt. Wir treffen uns mit Freunden, allesamt Philosophie-Studenten, auf dem Tisch stapeln sich Kant, Rousseau, Foucault. Im fließenden Englisch lästern sie über das Militär und reagieren wie jeder Nicht-Ossi, dem wir vom Nacktbaden am Cospudener See erzählen: „Da müssen wir hin!“ Das Dorf ist blitzblank geputzt, die Frauen tragen ihr Kopftuch lässig oder gar nicht. Wir sind bei den Ismaeliten im nördlichen Hunza-Tal. Eine muslimische Gruppe, deren Führer Aga Khan vor allem in Schulen und Universitäten investiert. „Bleibt bei uns in Hunza,“ raten sie zum Abschied und wir fragen uns, weshalb?
Nur einige Dörfchen weiter verändert sich die Atmosphäre, wir erreichen konservative, schiitische und sunnitische Gebiete. Die Menschen sind weiter freundlich, ohne Frage, wir erhalten Hilfe wann immer notwendig. Doch deutlich weniger winken uns zu, sie starren statt zu grüßen und uns anzusprechen. Es fällt uns schwer, höflich zu bleiben bei all den staubigen Männern, die Milchtee trinken, Haschisch rauchen, lethargisch die Straßen säumen, umgeben von Unrat. Ganze Dörfer erinnern an langjährige Männer-WGs.
“Wo sind all eure Frauen? Ich fühle mich einsam“, frage ich in Englisch sprechenden Runden. Einer verweist auf deren separate Straßen, als sei es das Normalste der Welt. „Wir machen Business, die Frauen sind Zuhause.“ Geschäftstüchtigkeit ist hier ein dehnbarer Begriff. Ein anderer bringt es auf den Punkt: „Unsere Frauen erledigen die Drecksarbeit.“ Die wenigen Muslima, die wir hier von Nahem sehen dürfen, haben Hände wir Steinbrucharbeiter. Von Kopf bis Fuß verschleiert ackern sie auf den Feldern und ersetzen mit ihren Rücken Esel und Pferde um die Erträge fortzuschaffen.
Im Global Gender Gap Report belegt Pakistan den vorletzten Platz, nur im Jemen ist die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern größer. Weniger als die Hälfte der Frauen können lesen und schreiben, bei den Männern sind es immerhin 70%. Es gibt noch Stammesgebiete, in denen Mädchen ihre Vergewaltiger heiraten müssen, um den Frieden zwischen den Clans zu wahren. Anderswo kontrolliert die Schwiegermutter das Bettlaken nach der Hochzeitsnacht auf Blut hin, um sicherzugehen, dass die Braut unbefleckt war. Ein Hauptstädter zeigt sich unglücklich mit seiner jungen Frau, krank sei sie geworden nach der Geburt des vierten Kindes. Nun werde er sich eine zweite Gattin suchen, die den Haushalt führt.
Doch fassungslos und tieftraurig macht uns vor allem eine Sache: erstmals verhüllen junge Mädchen ihr Gesicht, sobald sie uns entdecken, Frauen schnappen ihre Kinder und rennen fort. „Schüchtern“ seien die Damen, grinsen die Männer. Ein schöner Euphemismus für indoktrinierte Scheu und Unterwürfigkeit. Von einer Lehrerin erfahren wir: „Mein Mann erlaubt es nicht, dass ihr mich fotografiert. Eigentlich dürft ihr mich gar nicht sehen. Es geht um meine Ehre.“ Eine unerträgliche Doppelmoral – ich werde nämlich meist ungefragt von deren Ehemännern geknipst. Manchmal staut sich soviel Frust darüber an, dass ich verlange, die Bilder zu löschen.
Wir verlassen den Highway und zweigen ab ins Skardu-Tal. Eine abenteuerliche Straße folgt dem Oberlauf des Indus, der in Tibet entspringt und auf seinem Weg schon über 1.000 km zurückgelegt hat. Seine schmutzig-sandigen Fluten haben im Laufe der Zeit schwindelerregende Schluchten in den Fels geschmirgelt. Die Straße schmiegt sich in engen Serpentinen an die steilen Hänge, manchmal kaum breit genug für ein einzelnes Fahrzeug.
Der Karakorum gilt als höchstes Gebirge der Welt, denn er beheimatet fünf Achttausender, mehr Sechs- und Siebentausender als Nepal und mehr als die Hälfte seiner Fläche überragt 5.000 Höhenmeter. Noch immer drückt der indische Subkontinent gegen die asiatische Landmasse und faltet das Gebirge auf. Und während Geologen über dessen Zugehörigkeit zum Himalaya streiten, wachsen seine Gipfel um bis zu einen Zentimeter pro Jahr. Die eisigen Höhen beherbergen einige der größten Gletscher außerhalb der Polarregionen, die entgegen des weltweiten Trends ihre Größe bewahren oder sich gar ausdehnen. Gewaltige Eiswalzen verschieben Unmengen Geröll, schaffen tiefe Täler und zahlreiche Seen.
Doch der Karakorum, das „Schwarze Geröll“, ist bröckelig und instabil. Wind und starke Niederschläge zersetzen den blanken Fels wie einen Haufen Sand im Regen. Zahlreiche Felsstürze und Gerölllawinen sind die Folge. Wir bekommen eine Gänsehaut, als wir halb verschüttete Dörfchen passieren. Und erschrecken, wenn sich weit oben Steine lösen und wie Geschosse auf die Straße knallen.
In Skardu begegnen wir einem Professor der örtlichen Uni und genießen aufklärende Gespräche. Kopfschüttelnd erläutert er den zentralen Grund für die patriarchalischen Strukturen und Lethargie auf den Straßen: die unterirdische Bildung. Nur 1 Prozent des BIP fließt in die Ausbildung (in Deutschland 5) – doch sind mehr als die Hälfte der 200 Millionen Pakistani unter 25 Jahre jung. Häufig stellt die Regierung nur Schulen für Jungen zur Verfügung. Die Armen besuchen Madrassas, Religionsschulen, die neben dem Unterricht auch kostenfreies Mittagessen ausgeben und die Gehirne mit Stumpfsinn füttern. „Manche Lehrkräfte müssen 2 bis 3 Stunden laufen, ehe sie ihre Schule erreichen. Im Winter fällt der Unterricht oft aus“, erklärt der Professor. Ich muss an die deutsche Phrase denken: „Die Schlauen sollen in ihrem Land bleiben und es aufbauen.“ Wie platt und leer sie mir vorkommt, wenn ich ihm zuhöre. Mit seinem wachen und kritischen Verstand wirkt er mitunter völlig deplatziert.
Der direkte Weg in das benachbarte Astore-Tal führt über die Deosai Plains, das zweithöchste Plateau der Erde – nur Tibet liegt höher. Auf über 4.000 m ist der Winter angekommen, bis auf -10 °C fällt das Thermometer über Nacht. Auf den Schlafsäcken bildet sich eine Eisdecke aus Kondenswasser, während wir unter dem Kilo Daunen schwitzen. Am nächsten Morgen sind die Wasserflaschen durchgefroren, ebenso die Bananen und Handcreme.
Als wir Tage später den Highway erneut erreichen, steht er plötzlich da, ganz unerwartet und einfach so: der Nanga Parbat (8.125 m). Wir befinden uns auf nur 1.500 m und der Achttausender wirkt, als hätte ein Riese diesen weißen Klotz inmitten der relativ flachen Umgebung fallen gelassen. Nicht umsonst gilt der Nanga Parbat als höchste freistehende Erhebung der Erde – es sind diese unbegreiflichen Extreme, die den Karakorum-Highway so einzigartig machen.
Die Räder streifen das Nichts, Steine bröckeln in die endlose Tiefe. Wir haben jenen Jeep-Fahrer gewählt, der am wenigsten bekifft aussieht, trotzdem wird es totenstill im Wagen. Eine Piste für Lebensmüde führt zu den „Märchenwiesen“, einer mit Kiefern gesäumten Alm und Ausgangspunkt zum Gipfel des Nanga Parbat. In einer spektakulären, fast schon unwirklichen Tagestour wandern wir zum Basislager des neunthöchsten Berges der Welt. Die Stille wird nur durchbrochen vom Knacken des Gletschers, der im warmen Herbstlicht ächzt und stöhnt wie ein erwachendes Ungeheuer. Fließt das Eis über unebenen Fels, bilden sich haushohe Eistürme, die wie Zacken einer Krone gen Himmel ragen.
In der Nähe ermordeten Terroristen 2013 ein knappes Dutzend ausländischer Bergsteiger. Obwohl sich die Taliban umgehend bekannten, machen Verschwörungstheorien die Runde. Indien, USA, die Saudis, Afghanistan – die Sponsoren der Attentäter variieren je nach Gesprächspartner. Seitdem eskortieren Polizisten hier jeden Touristen und notieren in der gesamten Region mehrfach täglich unsere Passdaten. Manchmal brauchen wir uns gar nicht vorzustellen, denn die Beamten kennen bereits unsere Namen. Als wir ein Dörfchen erreichen, tuschelt ein Passant „Germany…“ in sein Telefon, nur wenige Minuten später sitzt ein Polizist im Restaurant. Tatsächlich war jener Nanga-Parbat-Anschlag der einzige in der von uns besuchten Provinz Gilgit-Baltistan. Immer wieder versichern uns Einheimische „Macht euch keine Sorgen“, und wir finden es unfair, dass ihnen eine Handvoll Hirnverbrannter den Tourismus als Einnahmequelle raubten.
Pakistans Widersprüche fordern uns wie die Gipfel des Karakorums einen Bergsteiger. Die Landschaft raubt uns den Atem aufgrund ihrer Schönheit, die Städte wegen der unerträglichen Luft. Manchmal fährt unsere Stimmung innerhalb eines einzigen Dorfes Achterbahn. Etwa wenn wir inmitten der Lethargie und Rückständigkeit ganz unerwartet in ein spannendes Gespräch verwickelt werden, uns selbstbewusste Mädchen Äpfel schenken oder einheimische Studenten wie Berliner Hipster daherkommen. Wahnsinnig spannend, wie sich im langsamen Radreisetempo gravierende Unterschiede spüren lassen, von Dorf zu Dorf und Tal zu Tal. Insofern haben wir von den bildungsaffinen Ismaeliten des Hunzatals zu den konservativeren Örtchen mit ihren verkrusteten Strukturen ganze Universen durchradelt. Einmal mehr wird uns besonders anschaulich bewusst, dass nur eine Bildung, die auf wache und kritische Geister abzielt, die Basis einer gesunden und offenen Gesellschaft ist. Nichtsdestotrotz: Wann immer wir bei Familien nächtigen, werden wir umsorgt und gemästet als sei es Heilig Abend, und sicher fühlen wir uns überall.
Letztlich ähnelt Pakistan einer Droge: Eine aufputschende, faszinierende Welt, von der wir kaum genug bekommen, die aber auch plötzliche Tiefschläge und Magenschmerzen versetzt. Süchtig sind wir allemal und verbringen statt geplanter 2 mehr als 6 Wochen im Land. Einzig die Ausreise ermöglicht den Entzug – erneut geht es für uns nach China.
Reisebericht China - Kashgar
China – Kashgar
26. August – 28. September 2017 | 610 km, 6.830 hm
Neun Polizisten führen uns ab, schaffen uns und die Räder mit Blaulicht ins Unbekannte. Es ist Mitternacht und China grüßt uns herzlich willkommen. Obwohl wir im Innenhof einer Familie privat zelten, muss uns jemand verpfiffen haben, vielleicht die Gastgeber selbst. Wir sind hundemüde, aber unsere Nerven gespannt wie Gitarrensaiten. Die Beamten handeln unerbittlich nach stumpfsinnigen Befehlen. Wir müssen alles einpacken, dann karren sie uns stundenlang auf der Suche nach einem Hotel mit Lizenz für Ausländer durch die Nacht, bis sie endlich fündig werden. Zur Strafe spielen wir ihnen einen Streich und behaupten, noch gar keine lokale Währung zu besitzen – bis sie die Hotelkosten entnervt selbst übernehmen um die sperrigen Ausländer endlich loszuwerden. Nicht nur in dieser Nacht lässt uns die chinesische Polizei kopfschüttelnd zurück, doch dazu später mehr …
Zunächst zurück nach Kirgistan. Drei Wochen warten wir in der Hauptstadt Bischkek auf einen ganz besonderen Besuch: Claudias Nabendynamo hat den Dienst eingestellt, ein neuer müsste eingespeicht werden. Eine Aufgabe, die wir unmöglich selbst lösen könnten. Zufällig urlaubt unser Leipziger Radmechaniker Matthias in Kirgistan und meistert die Herausforderung mühelos. Welch ein Service! Zudem empfangen wir überglücklich unsere Zweitpässe mit den Visa für China und Pakistan, die unsere Visaagentur zuvor an die hiesige Deutsche Botschaft geschickt hatte. Es kann also weitergehen!
Von Bischkek aus fahren wir auf der Hinterbank eines LKW bequem die bereits geradelte Strecke zurück in den Süden des Landes. Und dann erwischt es uns: Fieber, Schüttelfrost, Durchfall… wir müssen uns einen Parasiten eingefangen haben. Mit dem neuen Haustier im Darm schleppen wir uns auf dem Rad noch über den letzten Pass. Der Schmarotzer gängelt, es riecht nach Schnee, Eisregen setzt ein. In einer kleinen Unterkunft finden wir Schutz und werden von einem 72-jährigen Weltenbummler mit Storys überladen. Ein Leben um zu reisen, jedes Land der Erde. Keine Familie erwartet ihn zuhause, niemand schmeißt eine Party nach seiner Rückkehr. Wir empfinden Mitleid, ein deutliches Zeichen, dass uns ein solch dauerhaftes Nomadendasein widerstrebt.
Als es aufklart, verblüffen sie uns erneut: die Riesen des Pamir. Am Ende des weiten Graslands ragen seine Siebentausender empor und bilden eine schier unüberwindbare, weiße Mauer, darüber hängen Wolken wie Zuckerwatte. Die Straße nach China führt direkt durch den Schnee der Berge, wir können ihre Gletscher fast streicheln.
So frei wir in Zentralasien reisen durften, so befangen fühlen wir uns bereits an der chinesischen Grenze. Irisscan, Spracherkennung, Ganzkörperröntgen. Sämtliche Daten werden genauestens gecheckt, alle Ausrüstungsgegenstände akribisch kontrolliert – zweimal. Der Grenzübertritt dauert den gesamten Tag. Auch, weil wir auf ein ausreichend großes Taxi warten müssen, das uns die ersten 150 km zur nächsten Stadt eskortiert. Selbst fahren ist verboten, wild zelten sowieso. Selbst kleinere Straßenabzweigungen inmitten der Steppe werden videoüberwacht. Der Teufelskreis schließt sich, weil kaum bis keine Hotels Ausländer beherbergen dürfen. Und nachdem uns die Polizei selbst auf privatem Grund abführte, wissen wir: auch Übernachtungen bei Familien sind tabu. „Wo sollen wir dann schlafen?“, frage ich patzig. Schulterzucken, dumpfe Gesichter. Ohne Ansage von Oben verlieren diese Teenager in Uniform scheinbar ihre Sprache. „This special place“, meint der Chef der Truppe. Und verweist auf eines der rebellischsten Gebiete des Landes, die Provinz Xinjiang.
Wir sind auf dem Weg nach Kashgar und radeln auf besonders heißem Pflaster. Hier leben die Uiguren, ein Turkvolk und die muslimische Minderheit Chinas. Doch auch die Jahrhunderte alte Seidenstraße führt hier hindurch, die Peking derzeit mittels milliardenschweren Investitionen aufleben lässt. Um das Projekt erfolgreich voranzubringen, müssen die Uiguren mit allen Mitteln „auf Linie“ gebracht werden. Niemand kann Unruhestifter gebrauchen, wenn es um sichere Handelswege geht. Han-Chinesen wurden in der Provinz angesiedelt, um zentrale Posten zu übernehmen und die Uiguren zu verdrängen. Letztere erhalten selbst bei gleicher Anstellung weniger Lohn. Die Zentralregierung in Peking schränkte zudem das Fasten an Ramadan ein, verbot den Männern lange Bärte und den Muslima die völlige Verschleierung. Einige wehren sich mit Anschlägen, manche lassen sich von Taliban im benachbarten Pakistan zu Kämpfern ausbilden. Um weitere Gewaltausbrüche zu verhindern, stockte die kommunistische Führung Polizei und Armee massiv auf. An jeder Ecke patrouillieren Grüppchen schwer bewaffneter Halbstarker mit Maschinengewehren und Splitterschutzkleidung. Überwachungskameras spähen überall. Jeder Gemüseladen, Späti und jedes Restaurant muss seine Ladentür mit vergitterten Schleusen verriegeln – Uiguren sperren Uiguren aus.
Seitdem Terroristen mit LKWs in die Menge rasten, sichern Panzersperren alle öffentlichen Gebäude und Bürgersteige. Ein kreischender Alarm scheucht die Einwohner allmorgendlich auf die Straße zu Knüppelübungen. Uiguren trainieren, wie sie ihresgleichen bekämpfen – wir wissen nicht, ob wir in Anbetracht dieses jämmerlichen Bildes lachen oder weinen sollen. Nur schwer kommen wir an Sprit für den Kocher heran, denn selbst Tankstellen sind besser abgeriegelt als Fort Knox. Und als wäre das nicht genug, kurven unzählige Polizeiwagen den ganzen Tag mit heulenden Sirenen im Schritttempo durch die Stadt, um die Leute zu schikanieren und Präsenz zu zeigen. Hier wird eine ganze Bevölkerungsgruppe zu Terroristen degradiert, um die Macht über das wirtschaftlich wichtige Xinjiang zu gewinnen. Ein beispielloser Überwachungsapparat, der uns fassungslos macht. Jeder, der sich in Deutschland – insbesondere nach terroristischen Anschlägen – mehr Polizei und Sicherheitstechnik wünscht, sollte diese Region besuchen, er würde seine Meinung ändern.
2009 rückten Bulldozer an und walzten den Großteil der historischen Altstadt mit ihrem Labyrinth aus Lehmhäusern platt. Über 200.000 Uiguren wurden in schmucklose Betonbauten umgesiedelt, die laut der „besorgten“ Regierung erdbebensicherer seien. Heute schlendern Touristen durch mehr oder weniger authentisch nachgebaute „Show“-Gassen, kaum verwinkelt, sondern auffällig breit gezogen – so können Kameras und Polizisten effizienter arbeiten. Auf Pekings Zwangsmodernisierung folgte heftige internationale Kritik. Allerdings machen die wenigen erhaltenen Lehmhütten einen erbärmlich-zerfallenen Eindruck. Der Abriss der Altstadt war zweifelsohne ein Frevel, der Umzug in moderne Wohnungen brachte aber sicher auch eine Verbesserung der Lebensqualität?
Da wir nicht bei Einheimischen übernachten dürfen und sowohl die uigurische als auch chinesische Sprache unüberwindbaren Barrieren gleichen, erfahren wir nur oberflächlichen Kontakt zu den Uiguren. Was die Menschen über all die Entwicklungen in ihrer Stadt denken, bleibt somit ärgerlicherweise offen. Auch den Draht zur Außenwelt reguliert und blockiert Peking. Um Google, Whatsapp und Facebook zu nutzen, haben wir uns bereits in Kirgistan eine VPN-App installiert und umgehen so die Zensur mittels ausländischer Serverstandorte. Dennoch verschlüsseln wir erste Blog-Entwürfe und achten darauf, nicht gerade an heiklen Orten zu fotografieren.
„Ich bin TOUrist, kein TERRORist!“, wettert Daniel, als wir einige Tage später China in Richtung Pakistan verlassen. Feuerzeuge, Taschenmesser und scharfe Werkzeuge müssen wir abgeben. Eine Logik, die wir wohl nie durchschauen, schließlich reisen wir aus und nicht ein. Fein säuberlich aufgereiht und von schwer bewaffneten Beamten flankiert besteigen wir den Eskortbus. Einmal mehr nimmt es den gesamten Tag in Anspruch, die chinesische Grenze zu passieren. Selbst die Pakistani spotten über so ein närrisches Prozedere. Als wir endlich ihr Land erreichen, rufen sie: „Welcome to Pakistan, welcome to freedom!“ Willkommen im freien Pakistan? Guter Witz. Erst müssen wir lachen – bis wir realisieren, wie recht sie doch haben.