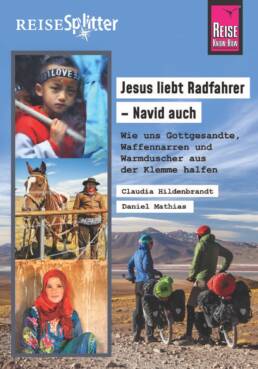Nepal
01. Oktober – 19. November 2013
Auch während unseres Fluges von Delhi nach Kathmandu verfolgt uns das Pech: der geplante Flieger wurde hoffnungslos mit gestrandeten Passagieren vom Vortag überbucht, ohne eine Ersatzmaschine bereitzustellen – über eine derartige Planlosigkeit wundern wir uns allerdings kaum noch. Ein bekleckerter Typ, der aussieht wie der Pförtner, sich aber als Manager vorstellt, erklärt kurz: „No possible!” Wir verbringen eine feuchte Nacht in einem Hotel, das auf den Namen ‚Wasserschaden’ hört, bevor wir am nächsten Tag in Kathmandu landen.
Nepals Hauptstadt wirkt, zumindest im Vergleich zu Indiens Megacities, recht sauber und aufgeräumt, die Menschen viel zurückhaltender und weniger nervtötend. Sogar richtige Stadtbummel sind möglich, ohne ununterbrochen angequatscht/-fasst/-hupt oder fotografiert zu werden. Wir sind begeistert! Und besorgen dennoch rasch sämtliche Trekkingpermits (irgendwie müssen ja die Devisen ins Land kommen) und die Bustickets nach Jiri (s. Karte). Unser Plan sieht vor, von Jiri aus in 7 Tagen nach Namche Bazar zu laufen, um für die anstehenden Aufstiege ausreichend trainiert zu sein. Für das richtige Feeling bringen wir Zelt und Kochgeschirr mit. Von Namche aus wollen wir die Gokyo-Seen erreichen und über den Cho la-Pass (Thagnag Kharka) schließlich nach Gorak Shep. Von dort ist es nicht mehr weit zum Basislager des Mount Everest sowie zum 5545m hohen Gipfel des Kala Pattar mit bester Sicht auf das Everest-Massiv. Insgesamt planen wir, etwa 25 Tage zu trekken und bringen 10 Puffer- und Akklimatisationstage mit. Doch es wird anders kommen …
Die ersten Tage sind, wie befürchtet, knüppelhart. Die unbefestigten Pfade folgen zumeist Bachläufen oder Viehwegen und verwandeln sich bei Regen in schlammige, rutschige Pisten. Die Route schneidet Täler und Pässe – an manchen Tagen können wir das Ziel des Abends schon morgens sehen, leider auf der anderen Seite der Schlucht. So steigen wir täglich 1000 m ab und anschließend wieder auf – bis Namche werden wir etwa so viele Höhenmeter zurücklegen, wie der Mount Everest hoch ist.
Wir beginnen zumeist im Morgengrauen, erreichen die Unterkunft am frühen Abend, stopfen Unmengen Kohlenhydrate in unsere Mägen und fallen wie die Steine ins Bett. Ich keuche und schwitze, verfluche jedes einzelne meiner 20 Kilo Gepäck und an den steilen Hängen des subtropischen Regenwaldes ist an Zelten nicht mal zu denken. Meine blasigen Füße schmerzen und ich habe das Gefühl, als brächen meine Schultern – ich glaube, noch nie in meinem Leben soviel gearbeitet zu haben. Auch der Monsun hält sich nicht an die Absprache, denn es regnet viel, manchmal sogar tagelang. Die schlechten Wege verwandeln sich in noch schlechtere, und wo wir mit Trekkingstöcken und Stiefeln bewaffnet ängstlich über die Felsen klettern, überhohlen uns Sherpa mit 40-80 Kilo. In Flip Flops. Nach vier Tagen sind wir ziemlich fertig, demotiviert, demoralisiert. Claudia verdrischt ihren Rucksack.
Die Unterkünfte reichen von zugigen, mit ein paar Pritschen und Spinnen versehenen Dachstuben bis hin zu einfachen Hotels. Gekocht wird meist über dem offenen, mit Holz oder Yakmist beheizten Feuer. Gesund ist das nicht: wir sehen viele Nepali mit chronisch geröteten Augen, Kinder mit Husten und Rotznasen.
Die Menschen hier sind wettergegerbt und zäh wie Yakleder. Schon die Kleinen laufen barfuß im Schnee und spielen mit Messern, die Älteren holen glühende Kohlen mit spitzen, aber bloßen Fingern aus dem Feuer. Sie sind uns gegenüber aufgeschlossen und gastfreundlich; ohne Zweifel arm, wirken aber glücklich und zufrieden mit dem, was sie ihr Hab und Gut nennen dürfen. Wir begegnen einem Stückchen des ‚echten‘ Nepals.
Das ändert sich schlagartig, als wir Namche erreichen: ausgebaute Wege, teure Lodges und viel Kommerz. Jährlich besuchen etwa 30.000 Menschen den Sagarmatha-Nationalpark, der überwiegende Teil wählt den bequemen Luftweg über Lukla. Uns begleiten Karawanen lärmender Amerikaner, vermummter Japaner (vielleicht ist die Luft zu gut?), Abenteuersuchende jeglicher Trainings-, Gewichts- und Altersklassen. „Bei manchen fragt man sich, ob sie nicht versehentlich in den falschen Flieger gesetzt wurden“, scherzt einer.
Die allermeisten heuern Träger an, die für wenig Geld das Gepäck schleppen. Die Porter sind zumeist arme Schlucker aus dem Kathmandutal, oft in Sandalen unterwegs und keineswegs an die Höhe gewöhnt. Manche schlafen in Viehställen, Höhlen oder im Freien und jährlich bleiben einige, von Hunger und Kälte geschwächt, auf der sprichwörtlichen Strecke. Wer nicht mehr arbeiten kann, wird heimgeschickt, sich selbst überlassen.
Wir merken wir schnell: die Plackerei von Jiri hat sich gelohnt! Wir sind topfit und nachdem wir ein paar Kilo überflüssigen Gepäcks zurück gelassen haben, fällt uns das Laufen nochmal leichter. In Namche Bazar decken wir uns mit Wochenvorräten an Yakkäse, Brot, Schokolade und Keksen ein (die soeben gewonnene Leichtigkeit ist natürlich gleich wieder dahin). Weiter oben wird alles teurer, mitunter unverschämt… heiß duschen: 3 €, 1 Rolle Klopapier: 4 €, Akku laden: 10 €.
Von nun an gewinnen wir rasch an Höhe. Da wir im Sinne einer entsprechenden Akklimatisation nicht mehr als 300m am Tag aufsteigen dürfen, ist das Tagesziel häufig schon gegen Mittag erreicht. Unsere Vorsicht zahlt sich aus: bis auf etwas Husten und leichte Schlafapnoe werden wir während des gesamten Treks keine ernsthaften Höhensymptome verspüren.
Doch bereits in Dole beginnt es wieder zu regnen. Weiter oben wird der Regen zu Schnee, viel Schnee, Unmengen davon, und immer häufiger tönt dumpfes Grollen von den Hängen. Als schließlich einige Sherpa und Yaks nicht weit von uns von einer Lawine in den nahen Fluss gespült werden, brechen wir in Machermo ab und verbringen die Nacht in bezeichnender Umgebung.
Schnell spricht sich herum: sämtliche Pässe werden für mindestens eine Woche unpassierbar sein, die Stimmung ist gedrückt. Wir treffen auch hier alte Bekannte wieder und tragens mit Fassung. Was solls, ein paar malerische, azurblaue Seen auf 5500 m sind sicher sowieso langweilig… Am nächsten Morgen bricht die Sonne allmählich hervor, wird der Schnee nass und schwer, überall gehen Lawinen und Erdrutsche nieder – Wahnsinn! Wir steigen rasch ab, schaffen drei Tagesetappen mit einmal und sind froh, in Phortse unterhalb der Schneegrenze zu sein.
Die östliche Route über Pheriche, Dughla und Lobuche bringt uns rasch nach Gorak Shep (5170 m). Spätestens hier sind die unzähligen Höhenkranken, die zu schnell zu hoch aufgestiegen sind, in völliger Unkenntnis und von geldgierigen Agenturen in zu enge Zeitpläne gepresst, nicht mehr zu übersehen. Manche Wegabschnitte sind förmlich rot markiert (Bluthusten). Wir stapfen durch tiefen Schnee in unglaublich gleißendem Licht und verbrennen uns die Nase von unten! Die Temperaturen pendeln zwischen Extremen: eigentlich müsste es schon aufgrund der Höhe stets knackig kalt sein, aber die äquatornahe Sonne brennt sich mühelos durch die dünne, knochentrockene Luft. So halten wir es zur Mittagszeit im T-Shirt aus, während das Thermometer nachts auf -15 °C fällt und die Fenster der unbeheizten Lodges innen dick mit Eis überzogen sind. Spätestens hier, in dieser unwirklichen und unwirtlichen Natur komme ich mir völlig deplatziert vor, als Gast willkommen, aber unfähig, auch nur eine einzige Nacht im Freien zu überleben.
Wir beschließen, den Kala Pattar noch am Nachmittag zu besteigen. In den nächsten Tagen sollen Basislager, Cho la-Pass und die (sowieso langweiligen) Gokyo-Seen folgen. Auf halber Strecke, in ca. 5400 m Höhe, genießen wir einen fantastischen Blick auf Everest, Nuptse und Lothse. Fantastisch, nicht von dieser Welt – ich denke, das triffts. Ich versuche, die Dimensionen zu begreifen: wir laufen in einer Höhe, höher als der höchste Punkt Europas und vor uns türmen sich noch einmal 3 Kilometer schierer Fels und Eis. Just hier beginnt auch die „deterioration zone“ (wörtlich Verfallzone), in der kein anhaltendes Leben ohne künstlichen Sauerstoff mehr möglich ist. Keine Siedlung der Welt liegt höher und auch das Base Camp, selbst Tibet, ist nur einen Steinwurf entfernt. Dann verhüllen Wolken die Sicht und wir müssen umkehren.
Trotz tiefer Müdigkeit winde ich mich hellwach; obgleich eisiger Kälte schwitze ich vor Angst. Der Abszess am linken Fußknöchel, mit dem ich mich bis hier hinauf nach Gorak Shep auf knapp gequält habe, pocht und pulsiert gnadenlos. Ich halte den Fuß aus meinen warmen Daunenschlafsack, doch bewirkt dies nur taube Zehen. Schon in zwei bis drei Stunden, gleich nach Sonnenaufgang, wollen wir endlich zu den Hauptzielen unseres Bergtrekkings aufbrechen – der erneute Aufstieg zum Kala Pattar und der Besuch des Everest-Basislager bedeuten einen insgesamt achtstündigen Marsch. Doch so nah am Ziel wissen mein Herz und meine Vernunft nur einen richtigen Weg: zurück nach unten – und zwar so schnell wie möglich! Blasenentzündung, Erkältung, rissige Hände und Füße, stark verbrannte Lippen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ein Abszess an der Ferse und nun ein walnussgroßer Abszess am Knöchel, den Daniel mehrfach mit einer Schere aufschneidet und zu reinigen versucht. Noch nie zuvor habe ich meine physischen Grenzen derart überschreiten müssen. Jetzt aber sagt mein Körper entgültig „Stopp“. Ich bin beruhigt, als Daniel verständnisvoll gemeinsam mit mir absteigt, gleichzeitig weiß ich aber um den schier endlos langen Halbtagesmarsch, den es bis in das Krankenhaus nach Pheriche (4240m) bedarf. Wie ich es bis dahin – Eis, Matsch und Flüsse überquerend – geschafft habe, keine Ahnung. Weiterreichende Details zum operativen Eingriff lasse ich an dieser Stelle aus. Ich weiß, dass meine Schreie in ganz Pheriche hörbar sind. Praktischerweise trägt Daniel seine wasserabweisende Regenjacke – meine Tränen prallen an ihr ab.
Einen Tag später gibt es auch für Daniel kein Entrinnen mehr, ein Leistenabszess hat für eine kurze Nacht gesorgt. Während ich mein bandagiertes Füßchen hochlege, stattet er der freundlichen Ärztecrew einen erneuten Besuch ab – er war schließlich schon länger nicht mehr im Krankenhaus! Dann kurieren wir beide uns und unsere Wunden erst einmal zwei Tage in Pheriche aus.
Am Abend gibt es dann für mich kein Halten mehr, die Nacht ist so klar und dunkel wie seit sechs Wochen nicht mehr. Ich steige nachts noch mal 200m auf, mogele mich durch Yaks und Hunde. Über mir schimmert der Sternenhimmel und als der Mond aufgeht, leuchten die schneebedeckten Bergspitzen in hellem Gold.
So allein im Dunkeln bin ich über die Entscheidung abzusteigen ziemlich glücklich. Die Strapazen der letzten Wochen, die eingeschränkten hygienischen (Un)möglichkeiten, das eintönige Essen und nicht zuletzt die dünne, eisige Luft haben uns mehr zugesetzt als erwartet. Wir waren fix und fertig, mit blank liegenden Nerven. Es ist seltsam: wir haben keines unserer Ziele erreicht, aber das Gefühl, es aus eigenem Antrieb bis hierher geschafft zu haben, ist ein ausreichend schönes.
Der mehrtägige Abstieg nach Lukla bringt wärmere Temperaturen, wir stärken uns mit Apfelkuchen, echtem Bohnenkaffee mit echter Milch ohne Milchpulver und frischem Obst. Der „gefährlichste Flughafen der Welt“, von dem auch wir nach Kathmandu zurück fliegen wollen, liegt zwischen German Bakery und Nepal Investment Bank. Die Landebahn ist etwa 200m kurz, abschüssig und endet vor einer Betonmauer, auf der „Welcome“ steht. Die Verhältnisse erinnern an jene auf einem Flugzeugträger, nur ohne Fangseil. Ein weiteres Problem: die kleinen Propellermaschinen fliegen nur auf Sicht, sodass bei wolkenverhangenem Himmel niemand mehr aus Lukla heraus- oder von Kathmandu hereinkommmt. Einige haben bereits bei der Ticketbuchung Schmiergeld gezahlt, um einen extra frühen Flug zu ergattern – wohlwissend, dass morgens zumeist die tagesbesten Wetterbedingungen herrschen. Wird der Flieger gecancelt, landet man auf einer Warteliste (die keiner erkennbaren Ordnung folgt) und fällt dabei sogar hinter all jene zurück, die an den Tagen zuvor keinen Flug bekommen haben. Daniel schimpft wutentbrannt mit einem Airport-Mitarbeiter, der einen Batzen Geld von einem nepalesischen Guide einsteckt. Tage später werden Prügeleien um die begehrten Plätze in einem der Helikopter ausbrechen, bis die Polizei einschreitet.
Solange bleiben wir nicht und steigen gleich für weitere drei Tage in das Bergdorf Salleri ab. Von hier aus sollen regelmäßig Jeeps in 16 Stunden nach Kathmandu fahren. Leider nicht als wir eintreffen. Aufgrund mehrtägiger nepalesischer Feiertage liegt auch in Salleri der Verkehr lahm – bis auf eine Handvoll massiv überteuerter Jeeps. Wir überlegen nach Jiri, zum Ausgangspunkt unseres Himalayatreks, zurückzulaufen. Doch mein lädierter Fuß, durch das Laufen in Sandalen nach der Operation arg gestaucht, nimmt uns die Entscheidung ab. Daniel dagegen hat seine letzten Reserven verloren und muss den sprichwörtlichen Gürtel so eng schnallen, dass ihm nach ein paar Kilometern die Beine einschlafen.
Wir zahlen den 9-Mann Jeep, in dem neben uns noch 17 Einheimische „Platz“ finden, und rumpeln insgesamt 36 Stunden über felsige Wege, Schlammgruben und durch reißende Flüsse. Drei Mädels übergeben sich in regelmäßigen Abständen bei voller Fahrt (10 km/h) aus dem Wagenfenster. Wir erleben zwei Reifenplatzer, die Suche nach dem Wagenheber und checken schließlich über Nacht in einem Minus-6-Sterne-Hotel ein. Am nächsten Morgen bricht die Vorderachse …
Endlich zurück in Kathmandu bedarf es zweimaligen Duschens (erst die grobe, dann die feine Reinigung), zwölf Stunden Schlafes und eines üppigen Abendbrotes mit Salat, Riesenpizza und Everest-Bier, bis wir uns wieder wie menschliche Wesen fühlen. Ich schreibe Postkarten und stelle fest, dass ich noch gar nicht erfassen kann, was wir in den vergangenen fünf Wochen alles erlebt und vor allem bewältigt haben. Der tägliche Marsch in der rauhen Natur, die Nähe zu den höchsten Bergen der Welt, das Schlafen und Essen in den Hütten nepalesischer Familien – intensiver kann Leben nicht sein.