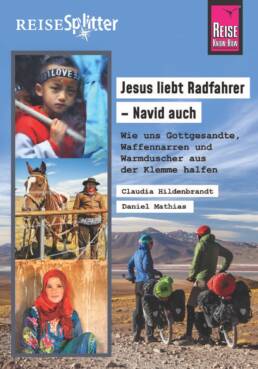Myanmar
19. November – 15. Dezember 2013
Schokocroissants, Laundryservice, der Besuch des örtlichen Friseurs: noch einige Tage tiefenentspannen wir in Kathmandu. Dann fliegen wir nach Kuala Lumpur. Die US-amerikanisch anmutende Hauptstadt Malaysias verpasst mir einen zermürbenden Kulturschock. Ich bin froh, die Metropole mitsamt ihren Fastfoodriesen, Mercedes-Filialien und futuristischen Petronas-Towers schnell hinter mir zu lassen.
Vor uns liegt Myanmar. Ein Land, dass vor allem aufgrund seiner verheerenden politischen Situation und der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in den westlichen Medien Erwähnung findet. Der Reiseführer warnt: hier gebe es keine Geldautomaten, nur makellose Dollarscheine würden akzeptiert, Touristen von der burmesischen „Stasi“ bespitzelt und niemals solle man selbst politische oder religiöse Themen ansprechen!
Doch mit dem scheinbaren Ende der Militärdiktatur 2011 und der stetigen Öffnung des Landes nach außen wächst der Tourismussektor mit Lichtgeschwindigkeit. Der staatlich forcierte Boom stützt sich auf ein funktionierendes Fernbusnetz, zahlreiche neue Hotels und Geldautomaten, die VISA akzeptieren. Einige der ATMs wurden pfiffigerweise direkt in der Shwedagon Paya in Yangon installiert, der bedeutsamsten buddhistischen Stupa des Landes.
Von dieseliger Großstadtluft gesättigt, nehmen wir den Nachtbus zum Chaungtha Beach. An die Strände im Südwesten des Landes lockt es weniger ausländische Touristen, viel mehr dienen sie der Mittelschicht Yangons als kurzweiliges Wochenendparadies. Wir entfliehen den Menschenmassen, Hunden, Mopedfahrern, Jetskibooten, Müllbergen, Fisch- und Schmuckverkäufern und fahren auf einer Vollcross (die uns besser im Griff hat als umgekehrt) entlang eines kilometerlangen menschenleeren Palmenstrandes.
„Warmly welcome and assist tourists“, heißt es auf einem Hinweisschild inmitten eines Ortes. Ich glaube, die Einheimischen haben es internalisiert. Sie begegnen uns Fremden mit einer derartigen Wärme und aufrichtigen Freundlichkeit, die ich als kühle Deutsche schlicht unfähig bin zurückzugeben. So sehr ich auch will. Wir werden stets angelächelt, neugierig beäugt. Vor allem junge Mädchen fragen mich schüchtern nach einem gemeinsamen Foto. Ein Restaurantbesitzer schenkt Daniel Zigarren, seine Frau mir derweil einen hölzernen Armreif. Wir, aus dem fernen Westen, haben plötzlich VIP-Status.
Einige ‘blaue Stunden’ später nutzen wir die günstige Anbindung zu einem weiteren Highlight, dem Inle Lake. In einem Boot erkunden wir die weite, sumpfige Marschlandschaft mit fließendem Übergang zum See. Lautlos gleiten wir entlang der Wasserstraßen kleiner Ortschaften, deren streichhölzerne Bambushütten sich auf wackeligen Stelzen halten. Lila Wasserhyazinthen bilden hübsche Vorgärten. Bauern ernten Tomaten, bauen Gurken und Bohnen auf ihren schwimmenden Feldern an. Kiosk, Schweinestall, Schule, Wochenmarkt und Post – alles Alltagsleben geschieht hier auf dem Wasser.
Doch das Bild des idyllischen Myanmars trügt. Viele Gebiete des Landes sind aufgrund politischer und religiöser Unruhen gesperrt, darunter leider auch der Norden mit den Ausläufern des Himalaya. Somit konzentrieren sich die Besucher auf wenige zentral-gelegene Routen. Um dem staatlich gelenkten Touristenstrom zumindest etwas zu umgehen, reisen wir in das Städtchen Hsipaw im nördlichen Shan-Staat. Eine mehrtägige Wanderung soll uns durch die Dörfer der Palaung führen, eines der ca. 70 Völkchen dieses multikulturellen Landes. Es gibt keine Karten der Gegend, auch Google maps zeigt nur weiße Flächen, und auf einen Guide wollen wir verzichten. Wir sprechen kein burmesisch und die Menschen hier kein englisch – doch das ist nicht weiter tragisch, denn die Palaung kennen eine gänzlich andere (Schrift)sprache. Ein Einheimischer notiert und übersetzt die Namen der Dörfchen in unleserliche Kringel und rät noch vom Zelten ab: zu viel Miliz, Wildschweine, handtellergroße Spinnen und Schlangen, nicht zuletzt sei es verboten.
Wir verbringen einen feuchtfröhlichen Abend mit einer Runde Briten, reichlich chinesischem Bier und übernachten in der Bambushütte eines Gasthauses. Ich erwache spät nachts, da sich mein Rucksack bewegt, struppig anfühlt und schließlich im Halbdunkel die Form eines verlausten Straßenhundes annimmt. Es dauert eine ganze Weile, das Tier nach draußen zu bugsieren. Claudia kämpft derweil gegen eine böse Magenverstimmung und verbringt die halbe Nacht auf dem Plumpsklo im Freien. „Das ist bestimmt eine Reisvergiftung!“, schimpft sie und vermutlich hat sie recht. Das burmesische Essen ist zwar prinzipiell lecker, aber meist ziemlich ölig und auf Dauer recht eintönig. Es gibt Reis mit Gemüse, frittiert, gebraten oder gedünstet, fettige Reiscracker oder Reisnudeln. Claudia versalzt manchmal absichtlich ihr Essen, um Abwechslung reinzubringen. Was würden wir geben für ein Stück Graubrot mit Käse? Noch schöner wäre Döner, Bratwürstchenpizza oder Freddy Freshs „Grüner Garten“… Ein Bauer bringt Claudia am nächsten Morgen auf dem Moped zurück nach Hsipaw, während ich zu Fuß folge.
Den strapazierten Magen stellen wir arg auf die Probe und nehmen den Zug in die ehemalige britische Kolonialstadt Pyin Oo Lwin. Wir buchen „Upper class“… und bekommen den dreckigsten Mäuse-Waggon, den wir je gesehen haben. Die Strecke führt über völlig versandete und wellige, mitunter auch unterhöhlte Gleise – ich wusste gar nicht, dass ein Zug so hoch hüpfen kann, ohne zu entgleisen. Gelohnt hat sich die abenteuerliche Fahrt kaum: Pyin Oo Lwin hat außer einem botanischen Garten und seltsamen Vögeln nichts zu bieten.
Wir suchen schnell das Weite, ein Pickup soll uns nach Mandalay bringen, in die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Fahrt ist – Überraschung! – holprig. Unterwegs bricht eine der Holzbänke, sodass eine untersetzte Omi fast rücklings von der offenen Ladefläche purzelt. Am Ziel angekommen, klopfen wir uns den Staub aus den Kleidern und genießen den letzten Abend in Myanmar an der längsten Teakholzbrücke der Welt.
Während Daniel die Abendstimmung fotografisch einfängt, spaziere ich entlang der Brücke – allerdings kaum ungestört. Ein Dutzend Jugendlicher und ganze Familien knipsen begeistert Gruppenfotos mit mir, eine Frau schenkt ihre selbstbestickte Perlentasche, eine andere eine Hand voll Obst. Diese außergewöhnliche Gastfreundschaft macht die Reise nach Myanmar für mich so wertvoll. Dennoch befinde ich mich stets im moralischen Zwiespalt. Das investierte Geld landet zumeist in den Taschen aktueller Regierungsangehöriger (ehemalige Generäle) oder deren reicher Unterstützer. Ob Fernbusse, Restaurants, Banken, Hotels oder Tankstellen – Vetternwirtschaft und Günstlingsunternehmen dominieren den Tourismussektor. Kleinere Herbergen erhalten keine Lizenz für ausländische Besucher, Bauern wird das Land geraubt um neue Hotelstandorte zu erschließen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen keine Rolle. So sehr ich die natürliche Herzlichkeit der Menschen schätze, so künstlich fühlt sich das Reisen an. Alles ist gelenkt, freies Entdecken nicht möglich; zu jeder Zeit können die Falschen darüber entscheiden, in welche Richtung sich der Tourismus entwickelt und letztlich das gesamte Land.