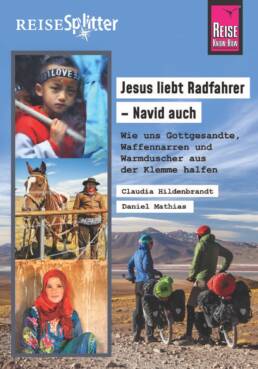Marokko
23. Februar – 17. April 2019 | 2.340 km, 25.390 hm
Umgeben von einer Bakterienwolke betrete ich erstmals seit zwei Jahren Europa. Ich bin erkältet, meine Aura könnte besser sein – was hoffentlich den sozialen Klimawandel erklärt, der uns in Spanien entgegenschlägt. Kaum einer grüßt, kaum einer spricht uns an, hier und dar gar pampige Ungeduld, wenn mein bemühtes Spanisch auf Montagmorgengesichter trifft.
Von Madrid aus fahren wir gen Süden Richtung Andalusien. Winterkahle Agrarwüsten weichen bunten Blumenwiesen und hügeligen Olivenhainen, soweit das Auge reicht. Jedes Dörfchen eine Perle, in den Straßen fegen, scheuern Einheimische sogar mit Eimer und Lappen die Gehwege. Spanien scheint alle Eleganz und Schönheit für sich gepachtet zu haben.
Ich sitze auf einer Caféterrasse in Granada, vor mir das leckerste Glas Weißwein, die köstlichsten Oliven, stilvoll gekleidete Menschen rauchen, wiegen sich galant im Takt der Musik. „Den Spaniern geht es nicht gut“, hatte mir kurz zuvor ein Journalist erklärt. So sehr ich es versuche, ich kann ihn nicht verstehen.
Mit der Fähre setzen wir nach Marokko über – und fühlen uns, es klingt verrückt, sofort heimelig. Die Menschen winken, rufen „Bienvenue!“, „Salam alaikum!“, überall ein Daumen hoch, Autos hupen uns willkommen, Abgase vernebeln die Sinne. Es ist fast so, als kämen wir nach zwei Jahren wieder an. In Iran, in Zentralasien, zurückgebeamt an den Beginn der Reise. Ein junger Autowäscher spendiert Trinkwasser und fragt nach unserer Herkunft. „Allemagne.“ Seine erste Reaktion: „Angela Merkel! Sie ist stärker als vier Männer zusammen!“
Ab jetzt hilft das aufgefrischte Schulfranzösisch, neben Arabisch die zweite Amtssprache des Landes. Schnell wird das Hals- zum Kopftuch umfunktioniert, lange, luftige Kleidung gekauft, im sunnitisch-muslimischen Marokko zwar keine Pflicht, aber besonders auf dem Land angebracht. Mohammed VI. gilt als „König der Armen“, investierte in Ausbildung und neue Jobs, stellte Mann und Frau in der Verfassung gleich. Allerdings liegt Marokko nur auf Platz 123 im Human Development Index der UN, rangiert damit mit Blick auf Bildung, Lebenserwartung und Einkommen zwischen Bolivien und Indien. Welten entfernt vom fünften Platz – vom deutschen Wohlstand.
In der „Blauen Stadt“ Chefchouen kommen wir mit dem 17-jährigen Badis ins Gespräch. Er will Mathe und Physik studieren. Ob er täglich in die Moschee gehe? „Nein, ich lese viel Philosophie und bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt an Gott glaube.“ Badis’ Eltern besuchten nie eine Schule, erwirtschaften in einem zugigen Imbiss das bisschen Geld für das tägliche Leben. Ein Auto haben sie nicht, kein Motorrad, kein Fahrrad, stattdessen schauen sie, dass alle vier Kinder studieren. Aber das sei in Marokko nicht viel wert, meint Badis desillusioniert: „Hier studiert man nicht für einen Job”, sondern „nur aus Interesse am Fach.“ Ein Studium bedeute noch lange keine Anstellung, und schon gar nicht im Fachgebiet. Der Bruder, eigentlich Physiker, arbeitet als Hotelpage in Marrakesch. Die Schwester studiert Soziologie, „wird aber wahrscheinlich einfach heiraten und zuhause sein.“ Seinen Eltern verschweigt er den Wunsch, mittels Schleppern und Schlauchboot nach Europa zu gelangen. „Sie würden niemals wollen, dass ich mein Leben riskiere.“ Laut UNHCR starben 2018 mindestens 2.275 Menschen im Mittelmeer, durchschnittlich sechs Menschen am Tag.
Wie er seine Zukunft sehe, fragen wir den Siebzehnjährigen, und Badis Antwort spricht Bände: „Maybe nothing.“
Ein Drittel der jungen Marokkaner ist arbeitslos – und das in einem Land, in dem das Durchschnittsalter 28 Jahre beträgt. Alle, mit denen wir sprechen, würden lieber in Marokko leben als in der EU, aber es fehlt schlicht an soliden Jobs, 40 Prozent der Einwohner buckeln noch immer in der Landwirtschaft.
Nach den Gastarbeitern im Ausland sind Touristen die zweitwichtigsten Devisenbringer. „For security“ heftet sich die Polizei daher an unsere Fersen. Tagelang tuckern Hilfssherifs in ihren Blechkisten hinter uns her, warten geduldig, bis wir zu Mittag gegessen und ausgedehnte Kaffeepausen beendet haben. Hastig schlagen wir uns abends ins Gebüsch, um die Verfolger abzuwimmeln und in Ruhe zu zelten. Häufig erfolglos. Dennoch weigern wir uns, die Cops in ein Hotel zu begleiten. Mehrfach bleibt der Staatsgewalt nichts anderes übrig, als Nachtwache am Zelt zu schieben …
Wir sind im Rif-Gebirge unterwegs, der größten Cannabis-Plantage der Welt: 3.000 Tonnen Gras bringen jährlich 20 Milliarden Euro Umsatz und sichern einer Million Menschen im sonst armen Norden des Landes ein beschauliches Einkommen. „Da könnte man schon mal auf euch schießen, wenn ihr auf dem falschen Feld landet“, warnt ein Einheimischer. Und tatsächlich: Während eines morgendlichen Fotospaziergangs muss ich falsch abgebogen sein, anders ist der machetenfuchtelnde Bauer nicht zu erklären. Denn der Anbau wird von der (korrupten) Polizei zwar toleriert, ist aber nach wie vor illegal.
Eine Schäferfamilie winkt uns heran, ob wir bei ihnen übernachten wollten? Klar, schließlich verfolgt uns die Polizei. Schwiegertochter Hasma ruft mich in das kleine Gehöft mit Ziegenstall nebst Schlafzimmer, zeigt mir eifrig den Brotofen, Hochzeitsfotos, dann Küche und Kühlschrank. Daniel darf ihr weder die Hand reichen noch sie fotografieren. „Islam“, begründet die 22-jährige forsch. Und fordert mich nach dem Duschen auf, mein Kopftuch aufzusetzen.
Ihr Schwager Chafer hält es hingegen nicht ganz so streng mit dem Koran, fragt verschmitzt, ob wir auch kifften und Alkohol trinken würden? „Aber du bist doch gläubiger Muslim?“ Er zwinkert: „Allah ist gut, aber Whiskey ist auch gut!“ Alkohol ist in Marokko offiziell verboten, doch gäbe es Bars und Supermärkte für Touristen, in der sich auch die Einheimischen versorgten. Chafer schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, studiert nicht, weil er das Geld auch für die verwitwete Mutter erarbeiten muss. Witwenrente gibt es keine.
Wir erreichen die Altstadt von Fés, ein Weltkulturerbe und unübersichtliches Gewirr aus hunderten Sackgassen und Treppen. Händler transportieren Waren auf Eseln, bieten Gewürze und Teppiche feil, frittiertes Süßkram, Kamelfleisch und Hammelköpfe. Der Duft von Haschisch und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. „Wow, it’s like a fairytale!“, „Wie im Märchen!“, staunt ein amerikanischer Tourist.
Doch nur wenige Meter abseits der aufgehübschten Vorzeigegassen kriecht bleierner Verwesungsgeruch in jede Pore. Junge Männer stehen bis zur Hüfte in Gerbereibottichen, walken Ziegenfelle in Taubenkot und Rinderurin wie vor 800 Jahren. Leprakranke betteln um Almosen, Alte bieten stumm im Staub sitzend ein paar Kräuter und Erbsen an, Obdachlose wühlen im Müll. Regen verwandelt die Gassen in Schlammlöcher, spült allen Unrat in den nächsten Fluss. Die Altstädte Marokkos sind keine Träume aus 1001 Nacht, sondern Viertel der Armen. Die Mittelschicht ist längst in die Außenbezirke gezogen.
Mittendrin im Gewimmel Cafébesitzer Driss, dreißig, frisch verheiratet. Seine Schwester schaut vorbei, wild geschminkt, mit goldenem Blingblingkettchen, die Haare eine braune Mähne mit blonden Strähnen. Sie lacht laut, feixt und ich muss an Hasma denken, die nur eine Tagesetappe – und doch Welten – entfernt auf dem Land lebt. Driss’ Frau ist 24, Laborantin im Krankenhaus. Kinder wollten sie höchstens zwei und liegen damit im landesweiten Trend. „Für mich war es wichtig, dass meine Verlobte noch Jungfrau war.“ Warum? Er tut sich schwer, es zu beschreiben. „Ich wollte immer eine ehrliche, ruhige Frau“, fügt jedoch hinzu, dass 50, 60 Prozent der heutigen Verlobten Erfahrung im Bett hätten. Seine Frau trage kein Kopftuch, denn „wir sind Muslime im Herzen und nicht dadurch, dass wir Kopftuch oder lange Bärte tragen.“
Wir verlassen Fés gen Süden auf asphaltierten, fast einsamen Nebenstraßen. Nach dem regenreichen Winter leuchtet die Landschaft in sattem Grün, Kirschen, Mohn und Ginster blühen um die Wette. Allmählich gewinnen wir an Höhe, vor uns türmt sich das über 4.000 m hohe Atlasmassiv. Die Gebirgskette reicht von Tunesien über Algerien bis an die marokkanische Atlantikküste und teilt des Land in zwei klimatische Extreme: mediterran und feucht im Norden, kontinental und trocken im Süden.
Die Frauen versammeln sich derweil im Haus: gestampfte Lehmböden, winzige Fenster, gekocht wird über offenem Feuer, es gibt Couscous eingeweicht in Milch mit geschmolzener Butter. Einer der Männer spricht Französisch: im Schnitt habe jede Frau im Dorf sechs, sieben Kinder, denn Rente gäbe es keine. Ich frage ihn nach all den Sozialprogrammen, die der König angeblich angestoßen habe. „Die existieren nur auf dem Papier. En réalité: rien!“ In Wahrheit: nichts. Die Krankenhäuser seien zwar gebaut, aber nur „décor“, es fehle an Geräten, an Medizin, an Ärzten. Wer eine teure OP bräuchte, würde Familie, Nachbarn und Moscheegemeinde um Hilfe bitten. „Aber wo ist denn das ganze Geld aus den Sozialtöpfen?“ „Wir haben viele korrupte Diebe im Land. Wer überleben will, muss arbeiten. Wer besser leben will, muss stehlen.“ Marokko liegt auf Platz 73 von 180 Ländern im Korruptionsindex von Transparency International, zwischen Senegal und Burkina Faso.
Tiefe Gewitterwolken und patagonische Gegenwinde künden von einer mehrwöchigen Schlechtwetterperiode. Die Temperaturen dümpeln im unteren einstelligen Bereich, nachts fällt Schnee und tagsüber eisiger Regen. Wir flüchten aus den Bergen und wollen in Sefrou überwintern. In der verwinkelten Medina klappert Karima mit uns ein geschlossenes Hotel nach dem anderen ab, bis wir endlich fündig werden. Rezeptionist und Besitzer säßen jedoch gerade vier beziehungsweise 24 Monate im Gefängnis, die beiden hätten wiederholt Pärchen ohne Eheurkunde in einem Zimmer schlafen lassen – in Marokko sei das rechtswidrig, nur bei Touristen gelten Ausnahmen.
Karima selbst ist 38 und hat islamisches Recht, die Scharia, studiert. Homosexualität lehnt sie ab, deshalb achtet sie darauf, dass ihr Sohn separat von den Mädchen spielt, das „Frauliche“ soll nicht auf ihn abfärben. „Findest du es nicht ungerecht, dass Frauen vor der Ehe keinen Sex haben dürfen, Männer dagegen schon?“, frage ich weiter. „Nein, nein“, winkt sie ab. Männer nähmen sich von Natur aus, was sie wollten, seien egoistisch, Frauen dagegen sensibel. „Der Koran beschützt die Frau.“ Dennoch kritisiert sie harsch die chauvinistische Haltung und Respektlosigkeit gegenüber ihresgleichen. „Wenn eine Marokkanerin in der Ehe leidet, schweigt sie. Andernfalls verliert sie den Mann als Geldgeber und ihr gesellschaftliche Anerkennung. Lässt sich der Mann scheiden, wird häufig der Frau die Schuld zugeschoben.“ Die Frau lande dann meist auf der Straße oder in einem der sozial geächteten Frauenhäuser.
Karima sorgt sich um ihr 14-jähriges, körperlich behindertes Mädchen. „Kein Mann wird meine Tochter je heiraten wollen, und in Marokko finden noch nicht einmal gesunde Frauen Arbeit.“ Deshalb bäckt sie für Hochzeiten, erzählt ihrem Mann jedoch nichts von dem Verdienst. „Er würde mir sonst das Haushaltsgeld streichen.“ Klammheimlich legt sie das Geld zurück, „nur für meine Töchter, mein Sohn hat ganz andere Chancen in dieser Gesellschaft.“
Weiterhin bleibt das Wetter übellaunig, doch erneut erweist sich das Rad als Mitleidsgenerator und Menschenfänger. Kellner Lahsne sieht uns zittern und lädt uns ein, die Nacht bei seiner Familie zu verbringen. Seine Tochter Manal empfängt uns mit einem Festmahl, unter vier Augen spricht sie persönlichere Dinge an. Noch nie habe die 18-jährige geküsst. Der Vater erlaube ihr nicht einmal, mit einem Jungen allein zur Schule zu gehen. Am Ortsrand gäbe es ein Wäldchen, wo sich die Liebespaare heimlich träfen. Einmal sei ihre Freundin aufgeflogen und es habe zuhause Prügel gesetzt. Die Jungen dagegen könnten machen, was sie wollten. „I hate the society a little“, flüstert Manal. Sie hasse diese Gesellschaft „ein bisschen“.
Marokko fordert, fesselt, packt und ergreift. Wir bleiben länger, als geplant. Halten öfter unterwegs inne, kapseln uns häufiger in Hotels ab, auch um die Wucht zu verdauen, mit der Chauvismus, Armut und Perspektivlosigkeit unterwegs immer wieder auf uns prallen. Gleichzeitig erinnern uns die vielen herzlichen Einladungen und überschwänglichen Willkommensgrüße noch einmal eindrücklich daran, sich in Deutschland nicht wieder hinter einem Montagmorgengesicht zu verschanzen – sondern offen zu bleiben, auf Unbekannte mit Neugier zuzugehen und sich täglich vor Augen zu halten, wie gut es uns geht!