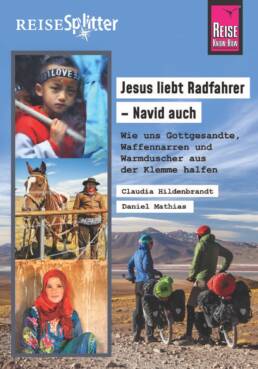Vietnam
16. Dezember 2013 – 09. Januar 2014
Zugegeben: ich fühle mich zunehmend Asien-müde. Menschenmassen kann ich kaum entfliehen, das dröhnende Hupen der Mopeds höre ich im Schlaf, knatternde LKWs wirbeln Unmengen von Staub auf und rauben jeder Radtour ihren Charme, Radio und Fernseher laufen jederzeit auf Maximallautstärke, die Verständigung auf Englisch hapert – zu oft gibt es böse Überraschungen in Restaurants. Natürlich sind das alles keine großen Probleme, im Gegenteil, das pure Abenteuer. Doch vier Monate ständig tief durchatmen und Kompromisse machen zu müssen, das zehrt an meinen Nerven. Ich fliege nach Vietnam mit einem mulmigen Gefühl.
Doch ausgerechnet das kühle Hanoi, welches uns mit Regen und herbstlichen Temperaturen empfängt, spendet mir neue Kraft! Die Metropole macht Spaß, ihr Flair ermuntert – ein Mix aus französischen Straßencafés, multikultureller Studentenszene, asiatischer Lebendigkeit und westlicher Großstadtmoderne. Wir checken in einem luxuriösen Hotel ein. Die Duschvorrichtung ist neuzeitlich, das Bett doch tatsächlich frisch bezogen! National Geographic läuft die halbe Nacht. Urlaub vom Urlaub! Und draußen flitzen die Mopeds vorbei. Angeblich acht Millionen zählt die Stadt, das Überqueren der Straße wird zur echten Mutprobe …
Wir planen, uns im landschaftlich wohl reizvolleren Norden des Landes aufzuhalten; ein Bus bringt uns zunächst nach Tam Coc, südlich Hanois. Das ruhige Örtchen liegt malerisch inmitten der sogenannten „Reisfeld-Halong-Bucht“. Wir staunen über unzählige erodierende Kalksteinfelsen, deren Täler sich im Lauf der Jahrtausende mit Sedimenten füllten. Die Berge ragen so wie Zuckerhüte aus einer endlosen Ebene, dazwischen liegen verstreute Weiler, Plantagen und Fischteiche.
Bis auf die Kälte und den Duft von Stollen, der von Deutschland herüber zieht, erinnert nichts an die bevorstehenden Weihnachtstage. Eine Fähre bringt uns auf eine entlegene Insel der Cai Tu Long-Bucht. Mit ihren verstreut aus dem Meer ragenden, schroffen Kalksteinformationen bezaubert sie ähnlich wie ihre berühmte Schwester Halong. Sie blieb jedoch von Massentourismus und Kommerz bislang verschont. Es gibt ein einzelnes, verschlafenes Betonkaff, eine Handvoll Unterkünfte und Strom zwischen 17 und 22 Uhr.
Am Ende des weitläufigen Strandes kann man das Ende der Welt sehen, ich schwör’s. Und so schweifen meine Gedanken sehnsüchtig ins ferne Thüringen, wo man sich gerade in der heimeligen Stube am reichlich gedeckten Tisch versammelt, die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, Glühweinduft und Kerzenschein. Ein ganzes Jahr reisen kommt mir in diesem Moment doch furchtbar lange vor …
Schon bald sind wir des süßen Nichtstuns überdrüssig, setzen wieder über auf das Festland und schlagen uns mühsame zwei Tage im „local bus“ bis an die nordöstliche Grenze zu China durch. Die pittoreske Landschaft setzt sich hier nahtlos fort, zwischen den steil aufragenden Felsen stürzen tosende Wildbäche durch die Schluchten. Der Ban Gioc-Wasserfall liegt am Grenzfluss zum roten Riesenreich und dient als Vorbild für all die kitschigen Wandgemälde in Chinarestaurants.
In einem zugigen Städtchen stürzen wir uns in das geschäftige Markttreiben. Argwöhnisch werden wir beobachtet, jeder Schritt genau registriert. Zunächst zeigen sich die Marktweiber distanziert und kamerascheu – bis die Erste ihr Konterfei auf dem Kameramonitor erblickt! Kreischendes Gelächter bricht aus, Freunde werden herbeigerufen, Fotomutige rennen auf Daniel zu, Ängstliche vor ihm weg. Das ganze Nest gerät in Aufruhr. Und einmal mehr fungiert Daniels Nikon als echter „Eisbrecher“.
Man nötigt uns zu allerlei harntreibenden Tees, klebrigen Süßigkeiten, gerösteten Bienenmaden, getrockneten Maiskolben – und schließlich beißt Daniel in ein Stück Hundewurst („Schmeckt ein bisschen streng, wie Leber!“). Soviel Gastfreundschaft hatten wir gar nicht erwartet. Die Vietnamesen geben sich zumeist ziemlich ruppig und barsch. Zwar emsig, clever und jederzeit für ein Geschäft zu haben. Aber ein warmes Lächeln (mit dem uns die Burmesen stets verwöhnten) gibt‘s hier oft nur, wenn man den Geldbeutel zückt.
Tagelang treffen wir auf keinen anderen westlichen Touristen, von Restaurants keine Spur, mit Englisch kommen wir hier genauso voran wie mit Latein – gar nicht. Ich erweitere mein vietnamesisches Hallo-Danke-Tschüss-Vokabular um so wichtige Worte wie Bus, Toilette, vegetarisch, Reis, Gemüse. Wir essen Reisnudelsuppe zum Frühstück, sitzen in schmalen Garküchen auf winzigen Plastikstühlen, Einheimische schmunzeln über unseren zunächst tölpelhaften Umgang mit Essstäbchen.
Für eine Strecke von 240 km benötigen wir zwei volle Tage. Der Lokalbus wird nämlich umfunktioniert zum Postauto. Wir ernten ärgerliche Blicke, da wir den Platz besetzen, der eigentlich für wuchtige Pakete voller Naturalien, Steppdecken, Strickware und gackernde Hühner reserviert war. Um die Post direkt zum Empfänger zu liefern, stoppen wir von Haus zu Haus. Passagiere und Fahrer erfreuen sich an schnulzigen Liedern. Ich, eigentlich atheistisch, fange an zu beten – wir überholen grundsätzlich in Kurven, an Anstiegen und jedem Gegenverkehr zum Trotz.
Nur eine Stadt im Nordwesten, umgeben von den höchsten Bergen des Landes, wird vom Tourismus erstürmt: Sapa. Hier sowie im Umland leben etwa ein Dutzend ethnische Minderheiten, die sich nach wie vor in traditionelle Gewänder kleiden. Leider müssen wir jedoch genau vor den bunt Kostümierten mit ihrem Trödel flüchten. „Shopping, Shopping!“, rufen sie jedem Westler zu und tätscheln dessen Arm, „Wer ar ju from? Wod ies jor näm?“ Daniel ist bei diesen Gelegenheiten schon lange nicht mehr der Arzt aus Germany, sondern Rüdiger (können sie nicht aussprechen), mittelloser Biologiestudent aus Rumänien (kennen sie nicht).
Die Gegend um Sapa wird als landschaftlich wunderschön gepriesen, im Sommer leuchtet das terrassierte Land in sattem Grün und Bauern bestellen ihre Felder. Ich dagegen bin schockiert: riesige Urwaldflächen mussten Reis- und Kohläckern weichen, die Bauern der Dörfer roden schleichend ganze Wälder für landwirtschaftliche Nutzflächen und Brennholzgewinnung. Die Erosion schwemmt anschließend die Bergflanken zu Tal. Der Kahlschlag der Hänge wird gerade jetzt besonders deutlich, wenn die Felder abgeerntet in tristem Braun liegen. Ich ärgere mich über die Kurzsichtigkeit der Menschen, bis mir klar wird, dass Europa es nicht besser gemacht hat …
Wir sind zurück in Hanoi, organisieren ein Ticket nach Laos, freuen uns über den seifigen Geruch unserer frisch (hand)gewaschenen Kleider, genießen Cocktails und Bier Hanoi. In meiner begrenzten Vorstellung assoziierte ich Vietnam eher mit Kriegsgräuel, trist und grau. Tatsächlich bringt die Jahreszeit diesige Luft und kaum Sonnenschein mit sich; die Vietnamesen sind meist distanziert. Doch genau diese Distanz und angenehme Kühle söhnen uns wieder aus mit dem sonst so einvernehmenden Südostasien.