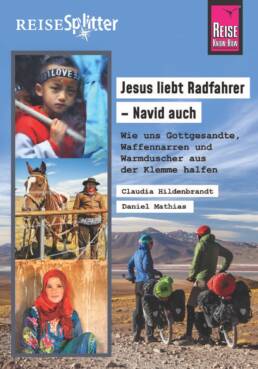USA – Arizona & Utah
24. März – 03. Mai 2018 | 2.080 km, 20.630 hm
Blaubeeren, Knusperflocken, selbstgemachte Pfannkuchen, Orangensaft, Feigenmarmelade, Schoko-Donuts, für Daniel brutzeln die Eier in der Pfanne, duftet der Schinken im Ofen. Dorothys Gastliebe ist groß und vor allem großmütterlich: warm und üppig. Ich bin zutiefst gerührt, als ich am Morgen in ihre Küche strauchele, noch etwas angeschossen vom guten Weißwein des vergangenen Abends. Sie durchsucht die Schränke: „Ich versuche mich in euch hineinzuversetzen, was könntet ihr noch gebrauchen für unterwegs?“ Dorothy und John sind über 70, fit wie Turnschuhe und Mitglieder der Warmshowers-Gemeinschaft. Doch bieten sie weit mehr als eine Bleibe für die Nacht. Wir schlafen in einem Himmelbett und genießen den Luxus einer eigenen Haushälfte. „Ich backe euch noch schnell Brownies. Und bitte kommt im Sommer wieder, ihr könnt das ganze Haus für euch haben, wenn wir bei unseren Kindern wohnen!“ Der Abschied fällt uns ungeheuer schwer, nicht nur wegen der übervollen Radtaschen.
„Welcome to Grand Canyon State“, begrüßt uns eine Werbetafel an Arizonas Landesgrenze. Ich bekomme Gänsehaut. Ein Jahr sind wir mit den Rädern inzwischen getourt und haben die wunderschönsten Gegenden durchquert, doch der Grand Canyon ist ein Kindheitstraum. „Weder Hochglanzfotos noch Filme können Besucher wirklich auf dessen Anblick vorbereiten“, frohlockt schon der Reiseführer. Umso zäher scheint die Anfahrt durch topfebene Steppe, nur hier und da unscheinbares Buschland, Daniel kämpft mit Sekundenschlaf.
Endlich angekommen, lassen wir uns Zeit bis zum Sonnenuntergang und schieben die Räder erst am Abend Richtung Abgrund. Bis zur Kante verstecken Bäume das Nichts. Nur noch wenige Schritte. Aufregung vernebelt mir die Sinne und doch möchte ich jede Sekunde dieses Momentes dehnen und strecken, so wie man den ersten Kuss im Leben für immer genießen will. Amerikanische Touristen kommen uns entgegen: „Unfassbar“, schüttelt einer den Kopf. „Ich kann nicht glauben, was ich sehe“, kommentiert ein anderer. Als wir den Rand des Canyons erreichen, fange ich an zu weinen.
Der Canyon ist ein junges Gebilde. Erst vor sechs Millionen Jahren hob sich das Colorado-Plateau, seitdem fräst sich der gleichnamige Fluss immer tiefer in das Gestein und hat bis heute eine gewaltige Schlucht geschaffen.
Wir schlagen das Zelt neben Gavin auf, einem Wanderer, der die großen Trails Amerikas durchläuft. Diese Art von „Touristen“ reist extrem leicht, der Rucksack wiegt kaum mehr als ein Schulranzen. Zelt und Kocher sind nicht drin. Er schläft unter freiem Himmel und ernährt sich von chinesischen Fertignudeln, eingeweicht in kaltem Wasser, so wie die meisten anderen dieser genügsamen Spezies. Ein sympathischer, junger Typ, der sich vor Grizzlys und zu viel angestaubter Sesshaftigkeit zu schützen weiß. Doch dann der Schreck: Am Lagerfeuer „outet“ sich Gavin als Trump-Wähler, er habe sogar eine Rede von ihm besucht. „Trump kennt sich mit Wirtschaft aus“, so seine Begründung, „und er war der maximale Arschtritt. Eigentlich wähle ich die Demokraten, aber ich hatte einfach keine Lust auf die nächste Präsidentendynastie.“ „Aber spätestens als er einen Behinderten nachäffte, muss dir doch klar geworden sein, dass er ein menschliches Desaster ist?“ Gavins ehrliche Antwort: „Das habe ich ausgeblendet.“ Die nachfolgende Schweigeminute sagt mehr als tausend Worte. Doch anders als in Deutschland, wo ich vermutlich aufgestanden und gegangen wäre, fasse ich mich und suche weiter das Gespräch. Irgendwie ist es eine sportliche Herausforderung, sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen.
Wir treffen Harry, einen Pfarrer an der Route 66, der uns einlädt in seiner Kirche zu übernachten. Harry ist stockkonservativ, Republikaner und Waffennarr. „I have 25 beautiful guns, and I love them all!“, schwärmt er von der Anmut seiner Knarren. „Kommt mich zu Hause besuchen, dann können wir ordentlich ballern. Die Magnum wird euch den Arm auskugeln, ein heißes Teil!“ Du darfst nicht töten, heißt es in der Bibel – „Außer in Notwehr!“, verbessert Harry Gott. Seine Waffen lässt er sich nicht nehmen, deshalb die Stimme für Trump.
Andere entschuldigen sich beschämt oder fuchsteufelswild für ihren Präsidenten. Wir begegnen einer Jüdin, deren Familie aus Nazi-Deutschland floh. Nun hat sie sich den deutschen Pass besorgt, nimmt Sprachkurse und überlegt, ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern. Sie fühle sich nicht mehr sicher in diesem Land, das einen Rassisten ins höchste Amt gewählt hat. Die Geschichte schlägt Purzelbaum!
Sie schaut sich um und flüstert, während sie von ihren Plänen erzählt – nicht die Einzige und das schockiert uns noch mehr. In einem freien Land beginnen die Einwohner beim Thema Politik zu flüstern? „Wir wollen niemanden provozieren, die Situation ist angespannt genug.“ Selbst wir empfinden die Gesellschaft als stark polarisiert und es erstaunt uns nicht zu hören, dass während der letzten Wahl so manche Freundschaft zerschellte. Das Verzwickte ist ja, dass niemand tatsächlich Böses will, sondern alle nur das Beste für sich und ihr Land, aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Die Frage lautet also: Wie löst man die Herausforderungen der Zeit auf Kompromissbasis?
Im Zickzack führt die Strecke von Arizona in den Süden Utahs, von einem Highlight zum nächsten: Die Gegend ist mit Nationalparks so dicht gespickt, dass Bemühungen bestehen, das gesamte Gebiet zu einem zusammenhängenden Schutzgebiet zu erklären. Skurrile Sandsteinformationen kontrastieren mit glucksenden Bächen, lebensfeindlichen Wüsten und saftigen Tälern.
Auch auf Höhe des Bryce Canyon (2.500 m) bringt ein später Wintereinbruch noch einmal eisige Kälte und Schnee. Ich traue mich nicht aus den Daunen und weiß nun endgültig, Daniel ist verrückt: Wer bei sibirischen Winden noch weit vor Sonnenaufgang zu eingeschneiten Felsnadeln wetzt, der hat ein Rad ab – oder ist Fotograf.
Doch schon in wenigen Jahren wird die Szenerie ihr Antlitz spürbar verändert haben. Wasser und Frost erodieren den weichen, lehmigen Sandstein kontinuierlich und überraschend schnell, zersetzen die massiven Wände, bis natürliche Fenster, Bögen oder wackelige Kleckerburgen übrig bleiben. Im Amphitheater stehen besonders viele der filigranen Felstürme, manchmal so uniform aneinandergereiht wie Zinnsoldaten.
Bei knapp zweistelligen Minusgraden ist der Zeltplatz wie leer gefegt, nur die Hartgesottenen bleiben und klüngeln. Der typische Amerikaner ist eine gesellige Quasselstrippe und höflicher als die Queen. Oft helfen mir ungefragt andere Kunden durch das Supermarktlabyrinth oder empfehlen ihren Lieblingskäse. In der Warteschlange tippt niemand auf dem Smartphone, vielmehr passiert etwas ganz Verrücktes: Die Leute reden miteinander! Selbst der Kassierer plauscht entspannt. „Have a wonderful day, honey!“, verabschiedet er mich. Angestrengt wie erfolglos versuche ich mich zu erinnern, wann ich zuletzt einem Kassierer einen „wundervollen Tag“ gewünscht und einen deutschen Supermarkt lächelnd verlassen habe.
Doch der Gipfel amerikanischer Nettigkeit nennt sich „Pay it forward“, „Zahl für den Nächsten.“ Es passiert uns häufiger, dass der Kaffee an der Tanke oder das Eis im Café bereits für uns bezahlt wurde. Das Prinzip ist einfach: Man spendiert etwas im Voraus für den nächsten Gast, ohne zu wissen, wer der Glückliche ist. Man stelle sich das mal zu Hause vor! Für Wildfremde vorab bezahlen? No way!
Wir treffen Menschen wie Rebecca und Mark, die uns zum Schlafen in ihre Wohnwagen oder auf luxuriöse Zeltplätze einladen, zu Frühstück und Abendessen in Restaurants, die gar Geld in unseren Radtaschen verstecken. „Wir haben auch Söhne, die viel unterwegs sind und hoffen auf die Gastfreundschaft der Einheimischen.“ Da ist die Besitzerin eines Wohnwagenparks, die uns zwei Nächte spontan und kostenlos zelten und heiß duschen lässt. „Erzählt euren Leuten, dass wir nicht alle so sind wie unser Präsident.“ Manchmal gibt’s an der Supermarktkasse einen Rabatt, einfach so. Auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit über die Autobahn bietet einer an, uns extra 60 Kilometer zu fahren, er müsse eigentlich in die Gegenrichtung, „aber ich hab frei und mag Leute.“
Unsere Tour durch Arizona und Utah endet im Hinterhof eines Radladens nahe der Grenze Wyomings. „Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr möchtet!“, überlässt uns der Chef sein Grundstück zum Zelten. Und Mitarbeiter Josh zeigt am Lagerfeuer, wie man DAS amerikanische Nationalgericht zubereitet: S’Mores, die Abkürzung für „Some more?“. Ein Sandwich aus süßen Crackern, geschmolzener Schokolade und gerösteten Marshmallows. Die Amis wissen, wie man Zucker tankt!
„Wir haben uns als Fremde getroffen und als Freunde verabschiedet“, schreibt uns Dorothy später eine Nachricht. „Bekommt mein Daniel auch genug Eier und Speck?“ Würden wir all die Gastfreundschaft irgendwann an andere Reisende zurückzahlen wollen, wir hätten noch einiges zu tun. Aber man kann auch im Kleinen beginnen. Pay it forward – wieso nicht auch in Deutschland einfach mal dem Nachbarn einen Kaffee spendieren, an der Kasse einen Plausch halten und wieder häufiger einen schönen Tag wünschen? Oder Reiseradler wie uns für ein, zwei Nächte beherbergen?