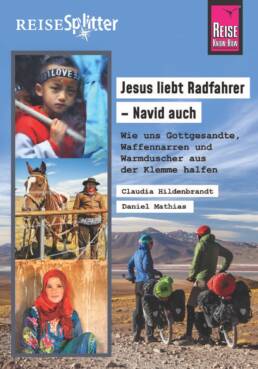Pakistan
27. September – 08. November 2017 | 1.470 km, 18.850 hm
Es gibt ein Ereignis, von dem wir alle haargenau wissen, wo und wie wir es erfuhren. Selbst wir als Kinder kannten plötzlich die Taliban. „Seit 9/11 kommen deutlich weniger Touristen zu uns nach Pakistan“, seufzt unser Gastgeber Imran und schenkt dampfenden Pakistani Tee ein. Starker Schwarztee mit sahniger Milch und viel Zucker. Er reicht einen Kristall aus Salz und ermuntert uns, ihn darin einzutunken. Das salzigsüße Getränk wird uns später vorkommen wie sein Land selbst: ein einziger Widerspruch.
Eigentlich hatten wir nicht vor, ein Rad über die pakistanische Grenze zu setzen. Hier fassten die Amerikaner Osama bin Laden und die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beruhigen auch nicht gerade. Bombenexplosionen und Terroranschläge, drei Radreisende wurden zuletzt entführt, ein Dutzend Bergsteiger erschossen und alleine im vergangenen Jahr 700 Mal der Ehre wegen gemordet. In der Islamischen Republik richten Militär und Scharia-Gerichte und verhängen Todesurteile gegen Minderjährige. Doch in dieses vermeintliche Moloch aus Gewalt und Extremismus führt eine der höchsten, spektakulärsten Fernstraßen der Welt: der Karakorum-Highway.
Beginnend im chinesischen Kashgar, quert der Highway das schroffe Karakorum-Gebirge, umzirkelt den Nanga Parbat und endet in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Bis vor Kurzem noch ein einspuriges Schotter-Abenteuer, baute China die Fernstraße zu einer modernen Schnellstraße aus und ergänzte sie gar um einen eigenen Hafen in Karachi, um sich so einen effizienten Zugang zum Indischen Ozean zu verschaffen. Noch ist das 400-Millionen-Dollar-Projekt nicht fertig, ein Glück für uns, denn nur wenige rußende Trucks stottern vorbei. Flüsterasphalt, geringe Steigungen, kaum Verkehr – ein Radlertraum!
Als wir das erste Städtchen erreichen, wähne ich mich in Kabul, sind wir hier wirklich richtig? Uns erwarten ausnahmslos Männer in traditioneller Kleidung, weiten Pluderhosen, mit brustlangen Bärten, mancher mit dunkel geschminkten Augen. Vor unserem Hotelzimmer patrouilliert ein Polizist mit Kalaschnikow. Einer kommt auf mich zu, ein finsterer Blick, dann ein Lächeln. „Es ist so toll, dass ihr hier seid. Lasst uns Tee trinken!“ Er umarmt mich, und fragt auch Claudia: „Darf ich dich mal drücken?“
„Ihr müsst einen Tag pausieren“, warnen uns Imran und seine Schwester. Weiter unten würden die Schiiten eine Prozession abhalten, die Straßen seien deshalb gesperrt. Einen Tag verbringen wir daher in Imrans abgelegenen Bergdorf, das mich völlig überraschend in mein Leipziger Studentenleben zurückbeamt. Wir treffen uns mit Freunden, allesamt Philosophie-Studenten, auf dem Tisch stapeln sich Kant, Rousseau, Foucault. Im fließenden Englisch lästern sie über das Militär und reagieren wie jeder Nicht-Ossi, dem wir vom Nacktbaden am Cospudener See erzählen: „Da müssen wir hin!“ Das Dorf ist blitzblank geputzt, die Frauen tragen ihr Kopftuch lässig oder gar nicht. Wir sind bei den Ismaeliten im nördlichen Hunza-Tal. Eine muslimische Gruppe, deren Führer Aga Khan vor allem in Schulen und Universitäten investiert. „Bleibt bei uns in Hunza,“ raten sie zum Abschied und wir fragen uns, weshalb?
Nur einige Dörfchen weiter verändert sich die Atmosphäre, wir erreichen konservative, schiitische und sunnitische Gebiete. Die Menschen sind weiter freundlich, ohne Frage, wir erhalten Hilfe wann immer notwendig. Doch deutlich weniger winken uns zu, sie starren statt zu grüßen und uns anzusprechen. Es fällt uns schwer, höflich zu bleiben bei all den staubigen Männern, die Milchtee trinken, Haschisch rauchen, lethargisch die Straßen säumen, umgeben von Unrat. Ganze Dörfer erinnern an langjährige Männer-WGs.
“Wo sind all eure Frauen? Ich fühle mich einsam“, frage ich in Englisch sprechenden Runden. Einer verweist auf deren separate Straßen, als sei es das Normalste der Welt. „Wir machen Business, die Frauen sind Zuhause.“ Geschäftstüchtigkeit ist hier ein dehnbarer Begriff. Ein anderer bringt es auf den Punkt: „Unsere Frauen erledigen die Drecksarbeit.“ Die wenigen Muslima, die wir hier von Nahem sehen dürfen, haben Hände wir Steinbrucharbeiter. Von Kopf bis Fuß verschleiert ackern sie auf den Feldern und ersetzen mit ihren Rücken Esel und Pferde um die Erträge fortzuschaffen.
Im Global Gender Gap Report belegt Pakistan den vorletzten Platz, nur im Jemen ist die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern größer. Weniger als die Hälfte der Frauen können lesen und schreiben, bei den Männern sind es immerhin 70%. Es gibt noch Stammesgebiete, in denen Mädchen ihre Vergewaltiger heiraten müssen, um den Frieden zwischen den Clans zu wahren. Anderswo kontrolliert die Schwiegermutter das Bettlaken nach der Hochzeitsnacht auf Blut hin, um sicherzugehen, dass die Braut unbefleckt war. Ein Hauptstädter zeigt sich unglücklich mit seiner jungen Frau, krank sei sie geworden nach der Geburt des vierten Kindes. Nun werde er sich eine zweite Gattin suchen, die den Haushalt führt.
Doch fassungslos und tieftraurig macht uns vor allem eine Sache: erstmals verhüllen junge Mädchen ihr Gesicht, sobald sie uns entdecken, Frauen schnappen ihre Kinder und rennen fort. „Schüchtern“ seien die Damen, grinsen die Männer. Ein schöner Euphemismus für indoktrinierte Scheu und Unterwürfigkeit. Von einer Lehrerin erfahren wir: „Mein Mann erlaubt es nicht, dass ihr mich fotografiert. Eigentlich dürft ihr mich gar nicht sehen. Es geht um meine Ehre.“ Eine unerträgliche Doppelmoral – ich werde nämlich meist ungefragt von deren Ehemännern geknipst. Manchmal staut sich soviel Frust darüber an, dass ich verlange, die Bilder zu löschen.
Wir verlassen den Highway und zweigen ab ins Skardu-Tal. Eine abenteuerliche Straße folgt dem Oberlauf des Indus, der in Tibet entspringt und auf seinem Weg schon über 1.000 km zurückgelegt hat. Seine schmutzig-sandigen Fluten haben im Laufe der Zeit schwindelerregende Schluchten in den Fels geschmirgelt. Die Straße schmiegt sich in engen Serpentinen an die steilen Hänge, manchmal kaum breit genug für ein einzelnes Fahrzeug.
Der Karakorum gilt als höchstes Gebirge der Welt, denn er beheimatet fünf Achttausender, mehr Sechs- und Siebentausender als Nepal und mehr als die Hälfte seiner Fläche überragt 5.000 Höhenmeter. Noch immer drückt der indische Subkontinent gegen die asiatische Landmasse und faltet das Gebirge auf. Und während Geologen über dessen Zugehörigkeit zum Himalaya streiten, wachsen seine Gipfel um bis zu einen Zentimeter pro Jahr. Die eisigen Höhen beherbergen einige der größten Gletscher außerhalb der Polarregionen, die entgegen des weltweiten Trends ihre Größe bewahren oder sich gar ausdehnen. Gewaltige Eiswalzen verschieben Unmengen Geröll, schaffen tiefe Täler und zahlreiche Seen.
Doch der Karakorum, das „Schwarze Geröll“, ist bröckelig und instabil. Wind und starke Niederschläge zersetzen den blanken Fels wie einen Haufen Sand im Regen. Zahlreiche Felsstürze und Gerölllawinen sind die Folge. Wir bekommen eine Gänsehaut, als wir halb verschüttete Dörfchen passieren. Und erschrecken, wenn sich weit oben Steine lösen und wie Geschosse auf die Straße knallen.
In Skardu begegnen wir einem Professor der örtlichen Uni und genießen aufklärende Gespräche. Kopfschüttelnd erläutert er den zentralen Grund für die patriarchalischen Strukturen und Lethargie auf den Straßen: die unterirdische Bildung. Nur 1 Prozent des BIP fließt in die Ausbildung (in Deutschland 5) – doch sind mehr als die Hälfte der 200 Millionen Pakistani unter 25 Jahre jung. Häufig stellt die Regierung nur Schulen für Jungen zur Verfügung. Die Armen besuchen Madrassas, Religionsschulen, die neben dem Unterricht auch kostenfreies Mittagessen ausgeben und die Gehirne mit Stumpfsinn füttern. „Manche Lehrkräfte müssen 2 bis 3 Stunden laufen, ehe sie ihre Schule erreichen. Im Winter fällt der Unterricht oft aus“, erklärt der Professor. Ich muss an die deutsche Phrase denken: „Die Schlauen sollen in ihrem Land bleiben und es aufbauen.“ Wie platt und leer sie mir vorkommt, wenn ich ihm zuhöre. Mit seinem wachen und kritischen Verstand wirkt er mitunter völlig deplatziert.
Der direkte Weg in das benachbarte Astore-Tal führt über die Deosai Plains, das zweithöchste Plateau der Erde – nur Tibet liegt höher. Auf über 4.000 m ist der Winter angekommen, bis auf -10 °C fällt das Thermometer über Nacht. Auf den Schlafsäcken bildet sich eine Eisdecke aus Kondenswasser, während wir unter dem Kilo Daunen schwitzen. Am nächsten Morgen sind die Wasserflaschen durchgefroren, ebenso die Bananen und Handcreme.
Als wir Tage später den Highway erneut erreichen, steht er plötzlich da, ganz unerwartet und einfach so: der Nanga Parbat (8.125 m). Wir befinden uns auf nur 1.500 m und der Achttausender wirkt, als hätte ein Riese diesen weißen Klotz inmitten der relativ flachen Umgebung fallen gelassen. Nicht umsonst gilt der Nanga Parbat als höchste freistehende Erhebung der Erde – es sind diese unbegreiflichen Extreme, die den Karakorum-Highway so einzigartig machen.
Die Räder streifen das Nichts, Steine bröckeln in die endlose Tiefe. Wir haben jenen Jeep-Fahrer gewählt, der am wenigsten bekifft aussieht, trotzdem wird es totenstill im Wagen. Eine Piste für Lebensmüde führt zu den „Märchenwiesen“, einer mit Kiefern gesäumten Alm und Ausgangspunkt zum Gipfel des Nanga Parbat. In einer spektakulären, fast schon unwirklichen Tagestour wandern wir zum Basislager des neunthöchsten Berges der Welt. Die Stille wird nur durchbrochen vom Knacken des Gletschers, der im warmen Herbstlicht ächzt und stöhnt wie ein erwachendes Ungeheuer. Fließt das Eis über unebenen Fels, bilden sich haushohe Eistürme, die wie Zacken einer Krone gen Himmel ragen.
In der Nähe ermordeten Terroristen 2013 ein knappes Dutzend ausländischer Bergsteiger. Obwohl sich die Taliban umgehend bekannten, machen Verschwörungstheorien die Runde. Indien, USA, die Saudis, Afghanistan – die Sponsoren der Attentäter variieren je nach Gesprächspartner. Seitdem eskortieren Polizisten hier jeden Touristen und notieren in der gesamten Region mehrfach täglich unsere Passdaten. Manchmal brauchen wir uns gar nicht vorzustellen, denn die Beamten kennen bereits unsere Namen. Als wir ein Dörfchen erreichen, tuschelt ein Passant „Germany…“ in sein Telefon, nur wenige Minuten später sitzt ein Polizist im Restaurant. Tatsächlich war jener Nanga-Parbat-Anschlag der einzige in der von uns besuchten Provinz Gilgit-Baltistan. Immer wieder versichern uns Einheimische „Macht euch keine Sorgen“, und wir finden es unfair, dass ihnen eine Handvoll Hirnverbrannter den Tourismus als Einnahmequelle raubten.
Pakistans Widersprüche fordern uns wie die Gipfel des Karakorums einen Bergsteiger. Die Landschaft raubt uns den Atem aufgrund ihrer Schönheit, die Städte wegen der unerträglichen Luft. Manchmal fährt unsere Stimmung innerhalb eines einzigen Dorfes Achterbahn. Etwa wenn wir inmitten der Lethargie und Rückständigkeit ganz unerwartet in ein spannendes Gespräch verwickelt werden, uns selbstbewusste Mädchen Äpfel schenken oder einheimische Studenten wie Berliner Hipster daherkommen. Wahnsinnig spannend, wie sich im langsamen Radreisetempo gravierende Unterschiede spüren lassen, von Dorf zu Dorf und Tal zu Tal. Insofern haben wir von den bildungsaffinen Ismaeliten des Hunzatals zu den konservativeren Örtchen mit ihren verkrusteten Strukturen ganze Universen durchradelt. Einmal mehr wird uns besonders anschaulich bewusst, dass nur eine Bildung, die auf wache und kritische Geister abzielt, die Basis einer gesunden und offenen Gesellschaft ist. Nichtsdestotrotz: Wann immer wir bei Familien nächtigen, werden wir umsorgt und gemästet als sei es Heilig Abend, und sicher fühlen wir uns überall.
Letztlich ähnelt Pakistan einer Droge: Eine aufputschende, faszinierende Welt, von der wir kaum genug bekommen, die aber auch plötzliche Tiefschläge und Magenschmerzen versetzt. Süchtig sind wir allemal und verbringen statt geplanter 2 mehr als 6 Wochen im Land. Einzig die Ausreise ermöglicht den Entzug – erneut geht es für uns nach China.