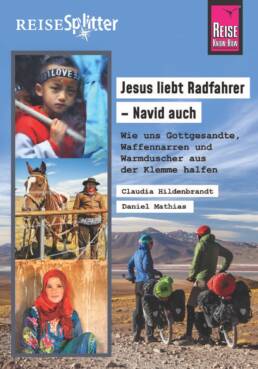Nordpatagonien
30. Oktober – 29. Dezember 2018 | 2.270 km, 31.890 hm
Ich fühle mich seekrank und bin gar nicht auf dem Wasser. Nachbeben lassen mich schwanken. Doch keine seismische Kraft treibt mich aus dem Bett, sondern die Übelkeit nach dem stärksten Cocktail, den chilenische Familienfeiern zu bieten haben: „Terremoto“ – Erdbeben. Ein Gemisch aus Weißwein, klebrig süßem Grenadinesirup und Ananaseis. Ein paar Tage tanken wir Heimat bei Paulina im chilenischen Los Ángeles. Familienfeste bis zum Morgengrauen, Frühstück vielleicht um zwölf, vielleicht gar nicht, ungewiss auch die anderen Mahlzeiten, dafür jede Nacht Terremoto-Party mit dutzenden Verwandten. Alles also noch beim Alten seit unserem letzten Besuch 2014. Nach vier Tagen ist unser Biorhythmus völlig durcheinander, Schlaf- und Wachphasen auf den Kopf gestellt. Völlig selbstverständlich werden wir noch schnell zu Weihnachten und einer anstehenden Hochzeit eingeladen, „¡Mi casa es tu casa!“ Dass Daniels Eltern Paulina vor zehn Jahren als Austauschschülerin aufnahmen, hat uns letztlich eine zweite Familie auf einem anderen Kontinent geschenkt.
Paulinas Familie zählt zum Mittelstand Chiles, der Lebensstandard ist hoch im reichsten Land Südamerikas. Die Preise für Lebensmittel, Hotels, Autos und Hochzeiten ähneln denen in Deutschland. Lähmende Armut, wie in den Nachbarländern Peru und Bolivien, gibt es selten. Während der Pinochet-Diktatur wurden „auf freundliche Empfehlung“ der USA Kupfer, Wälder, Strom, aber auch Bildungs- und Gesundheitswesen, Rente, alles teil- oder ganz privatisiert. „Wir sind eben eine Kolonie der USA“, spotten ein paar Studenten. Das brachte ausländische Investitionen – jedoch auch alle Nebenwirkungen grenzenloser Privatisierung mit sich. Die Minengesellschaften im wüstenhaften Norden sicherten sich private Wasserrechte, in manch einer Kommune bleibt keines mehr für den häuslichen Gebrauch und wird teuer mit Tankwagen herangeschafft. Paulina musste für ihr Studium einen Kredit aufnehmen, ihre Schwester Geld sparen für eine OP in einer Privatklinik. Selbst die Nationalparkverwaltung vergibt Lizenzen an private Unternehmer, die zwar jeden Peso aus ihren Besuchern pressen, aber kaum investieren. Vergammelte Infrastruktur, lieblose Wanderwege, überquellende Toiletten, dafür saftige Eintrittspreise und die dreiste Masche, ausländische Touristen doppelt zur Kasse zu bitten.
Nicht nur riesige Shoppingmalls und protzige Autos, auf Pump gekauft, erinnern an den Lieblingsverbündeten. Wie die US-Amerikaner leiden viele Chilenen unter Einzäuneritis. Private Ländereien und Forstplantagen, ja sogar Rapsfelder sind lückenlos von Stacheldraht umgeben, was die Zeltplatzsuche enorm erschwert. Manchmal öffnen wir die Zäune und zelten heimlich, viele Bauern überlassen uns ihre Viehweiden aber auch ganz offiziell, oft mit Logenblick auf Vulkane und Gletscher. Guillermo und Myriam laden zu Abendbrot und Dusche. Überwältigt von so fernem Besuch ist auch Luisa, die ihren Sohn am Telefon abwimmelt: „Ich kann jetzt nicht, ich habe wichtige Gäste, es sind Deutsche!“
Von Dänemark bis in die Sahara, so weit ist es von der Atacama ganz im Norden Chiles bis zu unserem Ziel am südlichen Ende: Feuerland. Schlappe 4.200 Kilometer liegen dazwischen. Chile ist zwar lang, aber dünn wie ein Strich und daher gerade einmal doppelt so groß wie Deutschland. Nur 18 Millionen Einwohner zählt das Land. Zwei Drittel der Fläche bestehen aus unbewohnbaren Wüsten, zerklüfteten Gebirgen, Fjorden und ewigem Eis, nur ein kleiner Teil ist landwirtschaftlich überhaupt nutzbar.
Nachdem wir im Norden des Landes genug Sand geschluckt haben, wollen wir das zentral gelegene Seengebiet erkunden und landen auf Pferdepfaden. Durch manche Gebiete kommen mitunter nur noch Ross und Wanderer, und zwei bescheuerte Radtouristen, die ihre Lastesel durch das unwegsame Gelände schieben müssen. Doch das ist allemal sicherer als geteerte Hauptstraßen.
Bäume, aufgespannten Regenschirmen gleich, sind das Ziel der beschwerlichen Anreise. Die öligen Kerne der seltsamen Araukarien sicherten den Ureinwohnern in der nicht enden wollenden Winterzeit das Überleben, heute sind sie selbst vom Aussterben bedroht. 2.000 Jahre lang kann ein solcher Gigant Vulkanausbrüchen und Waldbränden trotzen – modernen Kettensägen hat die dicke Borke allerdings nichts entgegenzusetzen. Immer weiter schrumpfen die Bestände, um Platz zu machen für schnell wachsende Kiefern- und Eukalyptusplantagen.
Die Anden bilden das Rückgrat des Landes und sind das Ergebnis tektonischer Aktivität: seit 150 Millionen Jahren taucht die Nazca-Platte unter die Südamerikanische Platte, mit rasanten sechs Zentimetern pro Jahr, wird unter ungeheurem Druck aufgeschmolzen und ergießt sich in unzähligen Vulkanen. Über 2.000 sollen es allein in Chile sein, je nach Zählweise, davon sind 80 noch heute aktiv – mehr Vulkanismus gibt es nur in Indonesien.
Viele Feuerspucker der Region zählen zu den besonders anmutigen Stratovulkanen, die wie schneebedeckte Wächter ihre Umgebung überragen. Besonders zähflüssige Lava türmt sich im Laufe unzähliger Eruptionen zu einem spitzen, perfekten Kegel, oft von einer vergletscherten Spitze gekrönt. Immer wieder erschüttern spektakuläre Ausbrüche das Land, verschütten Dörfer und Städte, formen schwerste Erdbeben ganze Landschaften neu. Im Krater des Villarica brodelt gar seit zwanzig Jahren ein daueraktiver Lavasee. Angst vor der nächsten Verwüstung aber hat niemand, im Gegenteil. Während wir mit mulmigem Gefühl am Fuße der Feuerberge zelten, radeln, wandern, wundern wir uns, weshalb mehr und mehr Häuser gebaut werden und Hotels entstehen. Viele antworten: „Ich bin halt damit aufgewachsen.“ Angst hat man wohl vor dem, das man nicht kennt.
Nicht nur die Vulkane lassen unsere Herzen flattern. Dutzende Bäckereien werben mit „Kuchen“, Brauereien mit „Kunstmann Bier“. Deutsche Auswanderer wurden Mitte des 19. Jahrhunderts angeworben, sie hatten Geld, Know-How und machten die Gegend überhaupt erst urbar. Gut so – wir schlemmen uns durch Rhabarberkuchen mit Pudding und echte deutsche Bäckerbrötchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen auch einige Nazis nach Chile. Vor uns sprechen die Einheimischen jedoch weiterhin gut von den „Alemanes“ und verharmlosen allzu oft ihre Verbrechen. Antijüdische Verschwörungstheorien hören wir immer wieder. Und einmal mehr auf dieser Reise müssen ausgerechnet wir die Schandtaten der Deutschen erklären.
Auch die Aufarbeitung der eigenen Diktatur geht schleppend voran. Während des 17-jährigen Militärregimes wurden 2.000 Menschen ermordet, knapp 30.000 Oppositionelle gefoltert, verschwanden über 1.100 spurlos. Doch noch heute zeigen Umfragen, dass etwa die Hälfte der Chilenen die erst 1990 endende Epoche nicht grundsätzlich als etwas schlechtes empfindet. „Eines Tages haben Pinochets Männer meinen Neffen geholt, er ist bis heute verschwunden. Aber das war auch gut so! Er und seine sozialistischen Kameraden haben Bomben gebastelt, sie hätten uns ins Unglück gestürzt“, so Umberto, ein Grundbesitzer, der uns seine Gartenlaube für eine Nacht überlässt. Nein, nach seinem Neffen suche er ganz sicher nicht. Manche Lehrer würden das Wort „Diktatur“ im Unterricht vermeiden. Mittäter schweigen, Familien wissen immer noch nicht um die Rolle ihre Angehörigen im System. Vieles erinnert an die Aufarbeitung der SED-Dikatur in Ostdeutschland, bei der wir über das Wort „Unrechtsstaat“ streiten und „auch nicht alles schlecht war.“
Ausgerechnet ein Projekt Pinochets treibt uns Reiseradlern Freudentränen in die Augen: die Carretera Austral. Der Diktator befahl 1976 den Bau einer Straße im bis dahin nahezu unerschlossenen Süden Chiles, um in den schwelenden Grenzstreitigkeiten mit Argentinien Präsenz zu zeigen. 10.000 Soldaten trieben die 1.200 Kilometer lange Schotterpiste in Patagonien unablässig voran, die bis heute nicht fertiggestellt ist. Mittlerweile sind etwa 60 Prozent der Straße asphaltiert und ein Bauarbeiter mein persönlicher Held – er schiebt mich rennend einen ganzen Anstieg hinauf!
Viel haben wir gesehen in den vergangenen 20 Monaten, doch die Carretera Austral setzt allem noch ein landschaftliches Sahnehäubchen auf. Die Straße windet sich durch immergrünen Regenwald und offene Steppen, folgt Fjorden und Flüssen, passiert Vulkane und Gletscher, findet ihren Weg durch scheinbar unpassierbares Terrain. Nun, im Frühsommer, schmeckt die Luft nach Ginster, scheint die Welt parfümiert von blühenden Lupinen. Jeder Kilometer im Rausch – alle Frischverliebten wissen, wie wir uns fühlen.
Dazu unendlich viel Ruhe, nur ab und zu passieren wir kleine Ortschaften mit gut sortierten Tante-Emma-Läden. Die Verkäuferin hüpft aus dem Wohnzimmer ins Geschäft und zurück in die Küche, um uns die Schätze im Ofen zu zeigen: warme, selbstgemachte Brötchen. Dazu Butter, aufgeschnittene Tomaten, keine große Auswahl und doch alles da. Nirgendwo fliegt Müll herum, vielmals wird auf Plastiktüten verzichtet, ein Staudamm am wasserreichstem Fluss Chiles, dem Rio Baker, durch zivilen Protest verhindert. Umweltschutz wird (mittlerweile) groß geschrieben in Patagonien, bringt der naturnahe Tourismus doch berufliche Perspektiven und damit die junge Generation wieder zurück in die Region.
Wir übernachten im Garten von Polizist Jorge. „Hast du überhaupt irgendetwas zu tun hier?“, lachen wir. „Un pocito. Hauptsächlich Viehdiebstahl. Meist flüchten die Gauner über die grüne Grenze nach Argentinien, dann müssen wir mit den Pferden auf Suche gehen.“ Das Leben hier sei entspannter als im dichter besiedelten Norden, nur im Winter verdrückt er sich, „dann frieren die Wasserleitungen zu.“
Plötzlich endet der Asphalt. Wir passieren einen gewaltigen Erdrutsch, der ganze Berg scheint ins Tal geflossen zu sein. Eine kilometerlange Paste aus verbackenem Schlamm, daraus ragen zerborstene Bäume, busgroße Felsen, irgendwann Dächer: Ein halbes Dorf liegt unter dem Geröll begraben.
An einem Samstag Morgen vor fast genau einem Jahr hört Claris Lärm „wie von einem Bulldozer.“ Sie schaut aus dem Küchenfenster. Schlamm, Autos, die Nachbarhäuser fließen vorbei. Claris ruft Mann, Kinder, Enkel aus den Betten, und während das Geröll die Wände um sie herum eindrückt, den Boden des Holzhauses hebt, umklammert die Familie einander fest. Vier Minuten beten sie zu Gott, dann wird es still. Als sie sich ihren Weg nach draußen bahnen, finden sie das Bettchen des Nachbarkindes an ihre Hauswand gedrückt, darin der tote Junge. Claris’ Haus blieb als einziges im Umkreis von hundert Metern verschont. 23 Nachbarn starben. Und während viele Hinterbliebenen den Glauben an Gott verloren, erklärt sie sich ihr Glück mit dessen Willen: „Gott ist der Souverän.“ Warum er ausgerechnet sie hat überleben lassen? „Weil wir berichten sollen, dass wir ‘en serio’, wirklich an ihn glauben müssen.“ Mit 70 bauen sie und ihr Mann ohne staatliche Hilfe alles wieder auf. Geld gäbe es nur, wenn sie an einen sicheren Ort ziehen würden. Aber hier hätten sie doch alles, Wasser, Natur, Ruhe. Nur die Nachbarn fehlten. Blumen und Bäume hat Claris bereits gepflanzt.
Der Erdrutsch von Santa Lucia war Folge des Klimawandels und der schwindenden Gletscher, es fehlt an Permafrost, der die Bergmassive zusammenkittet. Doch noch steht das Campo de Hielo Sur, das zweitgrößte Gletscherfeld außerhalb der Polarregionen und versperrt Chiles längster Sackgasse den Weg gen Süden – die Carretera Austral endet im Dörfchen Villa O’Higgins. Nach vielen Wochen Sonnenschein erwischt uns kurz vor Weihnachten doch noch das patagonische Schmuddelwetter. Wir bauen am 24. Dezember im Morgengrauen das nasse Zelt ab, preschen sieben Stunden durch den Regen und schaffen es pünktlich zu Heilig Abend per Liveschalte an den Thüringer Gabentisch.
Trotz Hightech-Schalte scheinen wir von gestern, denn entlang der Carretera treffen wir auf eine neue Generation Radreisender, die bereits morgens weiß, wo abends das Zelt steht. Der Grund: Alle richten sich nach ein und derselben App. Zur Erinnerung: Wir sind in der patagonischen Region Aysén, selbst Sibirien ist dichter besiedelt. Oft bietet die Wildnis so viele schöne Lagerplätze, dass wir uns kaum entscheiden können. Viele kommen trotzdem nicht ohne Smartphone aus, das neben den GPS-Koordinaten auch die Nutzerbewertungen der Campingspots ausspuckt. Auf manchen würden laut App sogar „4 Zelte passen“. Das wäre ein Traum, im menschenleeren Patagonien auf’s Nacktduschen verzichten und mit drei weiteren Partien frühstücken, weil sich alle zum gleichen Flecken Wildnis haben navigieren lassen. Wie viele Apps braucht es, ab wann hört das Reisen, das bewusste Sich-Aussetzen, das Ungeplante auf? Wann fängt die Smartphone-geführte Tour an? Einer ruft uns auf dem Weg ins stürmische Feuerland gar noch hinterher: „Keine Chance da unten, ohne die App überlebt ihr nicht!“