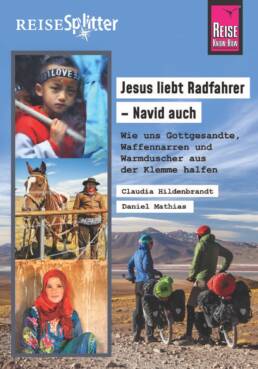Tadschikistan
07. Juni – 10. Juli 2017 | 1.210 km, 13.950 hm
Sekt zur Himbeertorte reicht mir der Minister, „Dawei Dawei“ rufen die UN-Diplomaten, Zeit zum Anstoßen. So unwirklich wie ein glamouröser Hollywoodfilm erscheint mir unser Aufenthalt in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Und doch haben wir unser Zelt in dem wunderschönen Ziergarten eines WHO-Mitarbeiters aufstellen dürfen, kostenfrei, in direkter Nachbarschaft zum Präsidenten des Landes. Unser Gastgeber Igor ist Mitglied der Online-Plattform „Warmshowers“, dem Couchsurfing für Radreisende. Eine knappe Woche erfreuen wir uns an samtweichem Rasen, Kühlschrank und Wasserkocher. Lediglich die Party beim Minister unterbricht das Nichtstun. Dessen Sekt stimmt mich etwas gelassener, bin ich doch trotz der Rast recht angespannt. Einer unserer großen Sehnsuchtsorte liegt vor uns, die wohl faszinierendste wie auch zehrendste Etappe dieser Reise?
Der Pamir-Highway zählt zu den höchsten Fernstraßen der Welt und schlängelt sich in mitunter 4.700 m Höhe zwischen Duschanbe und der kirgisischen Stadt Osh durch das Hochgebirge. Den Besorgten zu Hause verheimlichen wir im Vorfeld weitere Details, denn einfach wird dieser Abschnitt nicht. Gastgeber Igor verabschiedet uns mit einem letzten Tipp: Wir sollten besser Wodka zu jeder Mahlzeit trinken, das desinfiziere zuverlässig. Schulmediziner Daniel verzichtet – und fängt sich prompt einen Brechdurchfall ziemlich übler Sorte ein.
Nicht nur Daniels Schwäche bremst. Die ersten 600 km im flacheren Terrain erstrampeln wir uns bei 40 Grad im Schatten: wie Ergometer fahren in der Sauna, nur staubiger. Schon morgens tropft der Schweiß von der Stirn ins Müsli. Auch der Asphalt wandelt sich zunehmend in holprige Piste. Und so sinkt die Stimmung umgekehrt proportional zur Hitze und körperlichen Schwäche.
Wir radeln durch kilometertiefe Schluchten, auf beiden Seiten stürzen bis zu 5000 m hohe Ausläufer des Hindukusch steil ins Tal. Die Straße klebt am Hang wie eine frische Spaghetti und jede Entfernung vom Flussufer bedingt entsprechende An- und Abstiege. So läppern sich einige tausend Höhenmeter, obwohl wir dem Strom in direkter Nachbarschaft folgen.
Tadschikistan ist das ärmste Land Zentralasiens. Ein Drittel der Einwohner leidet an Unter- oder Fehlernährung, der Zugang zu sauberem Trinkwasser bleibt einem Viertel verwehrt. Zum Bruttoinlandsprodukt tragen maßgeblich Geldsendungen tadschikischer Gastarbeiter bei, die sich im Baugewerbe russischer Großstädte verdingen. Hinzu kommt der Schmuggel afghanischen Opiums, wohl 200 Tonnen pro Jahr.
Noch größer scheint die Armut am anderen Ufer des Flusses. Afghanische Arbeiter räumen Erdrutsche mit Hacke und Schaufel, sprengen sich quälend langsam durch den Fels. Während auf tadschikischer Seite neue Straßen, eine stabile Stromversorgung und die Einnahmen des Tourismus unübersehbaren Fortschritt bringen, führt am afghanischen Ufer nur ein schmaler Pfad entlang, bleibt es nachts oft dunkel, hausen die Menschen in einfachen Lehmhütten und transportieren ihr Hab und Gut auf Eseln oder auf dem Kopf. Wir können ihnen zuwinken, sie sind zum Greifen nah, und doch so fern – das Leben ist nicht fair, wenn man auf der falschen Seite geboren wird?
Nach endlosem Auf und Ab – emotional wie auch gemäß Höhenprofil – erreichen wir Chorugh am Fuße des Pamir. Hier treffen wir endlich andere Radreisende und genießen jede Minute Plaudern und Entspannen mit unseren Gleichgesinnten. Der Pamir ist das Nadelöhr Zentralasiens, hier kommen alle durch.
Nach einigen Tagen kollektivem Nichtstun machen wir uns auf in die Hochebene des Pamir. Endlich gewinnen wir effizient an Höhe, werden die Temperaturen angenehmer, die Nächte kühler. Claudia kämpft mit verstopften Bronchien und ist schon auf halber Strecke völlig atemlos. Schnaufend queren wir schließlich den ersten von fünf Pässen über 4000 m Höhe – und werden belohnt mit buchstäblich atemberaubenden Aussichten, denn wir haben die Hochgebirgswüste des Pamir erreicht!
„Der Letzte hat es in sich“, warnen uns Entgegenkommende. Und mit wachsender Demut nähern wir uns dem letzten 4000er-Pass. Heftiger Gegenwind wirft uns zurück. Plötzlich bricht ein Sandsturm los, so stark, dass ich nicht mehr nach vorne schauen kann. Fliegende Reißzwecken in den Augen, der Nase, Sand knirscht zwischen den Zähnen. Doch in dieser endlosen Ebene finden wir weder Unterschlupf noch können wir unser Zelt in dem haltlosen Boden verankern. Weiter vorn ziehen schwarze Wolken auf. Ich fühle mich gefangen in dieser unendlichen Weite, meine Angst wächst und ich versuche hektisch, mir ruhig zuzureden (?). Später zähle ich meine Pedaltritte, um die Panik zu drosseln. Dann sichtet Daniel eine Anhöhe in einem Flussbett, mit Sandheringen und Felsen sichern wir unser Zelt. Der Wind zerrt mit aller Macht, feiner Staub dringt in jeden Winkel, wir verkriechen uns im Sandkasten und harren aus. Mutter Natur zeigt uns noch einmal, wer der Chef ist.
Am nächsten Tag hat sich der Sturm etwas gelegt. Doch nun strapaziert der Untergrund unsere Geduld. Bei weiterhin starkem Gegenwind holpern wir über groben Schotter und haarsträubende Waschbrett-Piste. Jeder einzelne zurückgelegte Kilometer ist ein Erfolg. Schließlich müssen wir die Räder im dichten Nebel den Pass hinaufschieben. 4.282 m. „Gratulation“, reicht mir ein Motorradfahrer die Hand, wir sind oben angekommen. Gefühlt habe ich den Gipfel des Mount Everest erreicht, so groß war die Anstrengung, so schwach die Beine. Wir passieren die kirgisische Grenze. Die Gewitterwolken des Vorabends müssen heftigen Regen gebracht haben, die Straße ist teilweise weggespült und von Erdrutschen verschüttet.
Auf der anderen Seite des Passes erreichen wir das Leben. Maigrüne Wiesen mit Pferden, Yaks und Jurten. So typisch für Kirgisistan, so belebend und wohltuend für uns. Der Pamir ist ein rauer Ort, abgeschieden, seine Berge und Salzseen bizarr schön. Er wirft uns zurück zum Menschsein, in unsere untergeordnete Rolle gegenüber der Natur. Wir sind demütig und dankbar, für einen Moment seine Gäste gewesen zu sein.