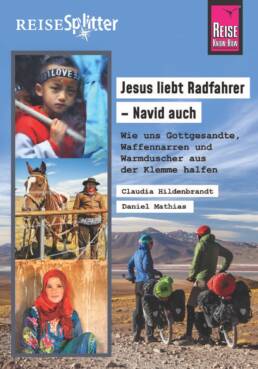Südpatagonien & Feuerland
29. Dezember 2018 – 22. Februar 2019 | 1.440 km, 11.900 hm
Fleischbrühe mit Hackklößen wird aufgetischt, ein Albtraum von Essen. Eigentlich. Und eigentlich sitzt die Inkarnation des Bösen mir gegenüber: Schäfer Carlos, mit blutverschmiertem Hemd, von der Brust bis über beide Ohren rot bespritzt. „Wir haben heute über Tausend Schafe markiert. ‘Nen Schlitz ins Ohr geschnitten. Und die wehren sich immer so!“ Ich bin Vegetarierin, betrachte Menschen und Tiere als gleichwertig – doch Carlos und seine Kollegen sind heute meine Helden. Die argentinischen Schäfer teilen nicht nur ihr Abendbrot, sondern weisen uns einen eigenen Raum zum Schlafen und schmeißen den Gasboiler für die heiße Dusche an. Noch vor einer Stunde habe ich die Winde verflucht, die letzten 500 Kilometer nimmermüden Sturms, der alle Ruhe raubt, nur noch zur Flucht nach vorne drängt. Radfahren in der Pampa fühlt sich an wie eine Treibjagd, nur sind wir die vom Wind Verfolgten. Hier auf der Estancia hat uns der Chef der Schäfer, Santiago, Zuflucht gegeben. Nun sitze ich inmitten blutverschmierter Männer in einer warmen Küche, der Wind ist ausgesperrt, löffle Brühe und werde ganz demütig. Denn Santiago erzählt achselzuckend: „Hier kommen fast täglich Leute auf dem Fahrrad oder Motorrad vorbei, ich nehme jeden auf. Ich möchte einfach, dass es den Menschen um mich herum gut geht.“
Doch spulen wir zurück: In Villa O’Higgins endet Chiles südlichste Sackgasse, die Carretera Austral. Nur über einen Trampelpfad durch triefenden Regenwald gelangen Fußgänger und Reiter nach Argentinien. Das Rad durch Morast hievend erreichen wir den südlichen Teil jener Landschaft, die der portugiesische Entdecker Fernando Magellan 1520 „Patagonien“ taufte. „Patagones“, große Füße, sollen ihre Ureinwohner gehabt haben, dabei hinterließen die eher kleingewachsenen Menschen bloß rätselhaft große Spuren im Sand mit ihren guanakofellgewärmten Füßen.
Lange Zeit blieb Patagonien ein unerforschter weißer Fleck auf der Landkarte. Erst Ende des 19. Jahrhunderts einigten sich Chile und Argentinien auf eine gemeinsame Grenze entlang der kontinentalen Wasserscheide: Gebiete, die in den Pazifik entwässerten, sollten zum chilenischen Territorium gehören; was zum Atlantik floss, Argentinien. Dass die Wasserscheide im damals unerschlossenen, extrem zerklüfteten Patagonien in unregelmäßigen Schleifen mäandert und in Zeiten des Klimawandels gar ihren Verlauf ändern sollte, war damals nicht vorauszusehen. Immer wieder streiten die Nachbarn daher über Zugehörigkeiten, zumal der eigentliche Reichtum der Region offensichtlicher wird: Wasser. Über 20.000 Quadratkilometer erstrecken sich die patagonischen Eisfelder – ganz Sachsen passte hinein – und bilden den drittgrößten gefrorenen Süßwasserspeicher des Planeten.
Sowohl Chile als auch Argentinien errichteten daher grenznahe Vorposten, um sprichwörtlich Flagge zu zeigen. Wie El Chaltén: 1985 noch ein Kaff, heute einer der am schnellsten wachsenden Orte Argentiniens – dank Facebook und Instagram. Denn der Hausberg Fitz Roy gilt als „Place to see before you die“, Selfiesüchtlinge aus aller Welt kommen in Reisebusladungen. Wer gerne Schlange steht beim Wandern, übervolle, Smartphone-Musik-beschallte Zeltplätze bevorzugt und nichts über die argentinische Kultur lernen will, der verbringe seinen kostbaren Jahresurlaub hier.
Gerade lässt der Schneeregen nach, wir tauen auf in einer Herberge und drücken uns vor der bevorstehenden Etappe. Draußen pustet der Wind einen Rollkoffer die Straße hinauf, wo bleibt nur der Besitzer? „Heute ist ein guter Tag zum Wandern!“, meint die Herbergsmutter völlig ernst. Wir wollen nach Feuerland und ich ahne es: vor uns liegen 1.400 Kilometer Wetterprügelei.
An den meisten Tagen fühlen wir uns wie in einem Windtunnel für Formel-1-Boliden. Obwohl wir die Fahrtrichtung nicht dem Zufall überlassen und überwiegend mit den vorherrschenden Winden fahren, bleiben immer noch genügend Abschnitte, uns die tollwütigen Sturmböen um die Ohren klatschen zu lassen. Einmal pusten sie mich vom Rad, ich lande auf der Gegenfahrbahn. Daniel wirft es beim Wandern mitsamt Rucksack ins Gebüsch. Jeder Gegenstand muss stets und ständig an den Rädern festgebunden werden, um nicht in Afrika zu landen. Der Wind ist so stark, dass der Kaffee aus den Bechern spritzt, seine Lautstärke so unerträglich, wir müssen uns anbrüllen, um einander überhaupt verstehen zu können. Wir hangeln uns von einer verfallenen Hütte zur nächsten, kochen in Straßenunterführungen und Erdlöchern, zelten hinter Kieshaufen und in verlassenen Scheunen. Kein schützender Wald, kein Gesträuch, keine Berge, keine Dörfer, manchmal kann das Auge die Weite nicht mehr ertragen.
Daniel reißt ausgerechnet während der heftigsten Mittagsthermik ein Schaltzug. Glücklicherweise haben wir Ersatz dabei und vorsorglich ein Youtube-Video gespeichert: „Fädeln Sie den Seilzug vorsichtig durch Öse 8 und 9…“ Mit Ruhe und Geduld macht er sich allem Sturm zum Trotz an die Arbeit. Mein Gesicht jedoch scheint nach sieben Wochen Wind und Kälte nur noch „Ausgebrannt“ zu signalisieren, denn die wenigen Bewohner zeigen besonders viel Mitgefühl: Ein Ladenbesitzer winkt uns in seine Wohnstube, damit wir im Warmen Mittag essen können. Eine Studentin schenkt Bananen und Apfelsinen. In einer Herberge finden wir einen Tag Unterschlupf, die Besitzerin kümmert sich wie (m)eine Oma. Schweizer Urlauber pfropfen uns und zwei weitere Radfahrer in ihren Pickup, ersparen uns somit 120 Kilometer Gegenwind. Die Zuflucht, die uns Santiago und seine Schäfer geben. Immer wieder Quäntchen neuer Schubkraft, die mich letztlich davon abhalten, mein Rad im nächsten See zu versenken.
Unsere stürmischen Gegner heißen Brüllende Vierziger, Wilde Fünfziger und Schreiende Sechziger – im Wissenschaftsjargon. Wir befinden uns zwischen dem 40. und 60. Breitengrad und schon unter den frühen Seefahrern galt das Sprichwort: „Unterhalb des vierzigsten Breitengrades gibt es kein Gesetz mehr, ab den Fünfzigern auch keinen Gott.“ Verantwortlich für diese furiosen Stürme ist die Nähe zum antarktischen Kältepol. Von hier fließen frostige Meeresströme und Luftmassen Richtung Äquator – der Motor für diese außergewöhnlich starken und kalten Westwinde, die ungebremst um den Erdball jagen. Die Spitze des südamerikanischen Kontinents ist dabei die einzige nennenswerte Landmasse, die wie ein Finger in diesen Ventilator ragt. Was wir in Deutschland hin und wieder als Orkan erleben, ist hier der Normalfall.
Die Kontinentalmasse Antarktis ist dabei viel kälter als unsere Arktis, acht mal stärker als auf der Nordhalbkugel wehen daher die Westwinde der südlichen Breiten. Und in noch einer Sache hat Europa Glück gehabt: der Golfstrom hält uns warm. Denn Patagonien liegt in gar nicht so extremen Breiten wie man denkt: El Chaltén befindet sich auf dem gleichen Breitengrad wie Augsburg – bloß auf der Südhalbkugel – und selbst Ushuaia, immerhin die südlichste Stadt der Welt, ist genau so weit entfernt vom Süd- wie Kiel vom Nordpol. So kommt es, dass der patagonische San-Rafael-Gletscher auf dem 47. Breitengrad bis hinunter ins Meer fließt – es ist beinahe so, als würden die Alpengletscher ins Mittelmeer kalben.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten die Weißen die endlose Pampa als wertvolle Weiden. Einem kurzen Vernichtungskrieg gegen die Mapuche und Tehuelche folgten Schafzüchter, die die halbe Welt mit Wolle und Fleisch belieferten. Argentinien wandelte sich zu einem der reichsten Länder der Erde. Noch Mitte des letzten Jahrhunderts galt „Reich sein wie ein Argentinier“ in Deutschland als geflügeltes Wort. Bis in die 90er Jahre wurden die natürlichen Ressourcen ausverkauft, ausländische Firmen wie die Modemarke Benetton zu den größten Grundbesitzern des Landes. Heute jedoch sind die Weltmarktpreise für Wolle und Fleisch so verfallen wie die einstigen Gutshöfe, ist das Weideland vielerorts überweidet und der Erosion preisgegeben.
Doch hier im Nirgendwo sollen sie verschachert sein: Millionen von Dollar in Koffern und Containern. Schmiergelder, die das ehemalige Präsidentenpaar Kirchner von Bauunternehmen erhielt. Öffentliche Aufträge sind begehrt, denn keiner überprüft, ob die Straßen oder Wasserkraftwerke überhaupt entstehen. Der Whistleblower im jüngsten Korruptionsskandal war der präsidiale Chauffeur: akribisch notierte er seine „Dienstfahrten“ und sogar das Gewicht der Plastikbeutel voller Dollarscheine, die er im Auftrag der Kirchners durch das riesige Land transportierte. 160 Millionen Dollar – so viele Hotels konnte das Präsidentenpaar gar nicht bauen, um das Geld reinzuwaschen, deshalb rücken nun die Bagger auf der Suche nach vergrabenen Plastikbeuteln in Patagonien an. Senatorin Kirchner genießt jedoch Immunität, und weil Korruption fast zum guten politischen Ton in Argentinien gehört, gibt es Gerüchte, dass sie erneut zur Präsidentschaftswahl antritt.
Lange hatten wir uns darauf gefreut, schließlich gilt Chiles bekanntester Nationalpark als der Inbegriff Patagoniens schlechthin: Torres del Paine. Doch je näher das Highlight rückt, desto nüchterner stellen wir fest, dass das Weltnaturerbe zum Disneyland gerät. Massen asiatischer Touristen schieben sich im Gänsemarsch die Pfade entlang, beleibte Amerikaner mieten einheimische Träger, um Abenteuerluft am Ende der Welt schnaufen zu können. Wer mag, kann für 2.000 Dollar pro Nacht in einem der Luxushotels nächtigen. Nur Radreisende, die spontan auf einfachen Zeltplätzen lagern müssen, haben das Nachsehen. Und die Nationalparkbehörde wundert sich ob der explodierenden Besucherzahlen und erhöht die Eintrittspreise immer weiter – die wir umgehen, indem wir uns vor Sonnenaufgang am Tor vorbei schleichen.
Magellan und seine Mannschaft zermürbte die ewige Kälte auf hoher See, das immernasse Wetter, die endlosen Winternächte, nur durchbrochen von den flackernden Feuern der Ureinwohner – er nannte die Insel „Feuerland“. Um heute noch Siedler in diese harschen Gefilde zu locken, senkte der Staat die Einkommenssteuer und subventioniert massiv die Elektroindustrie. Fernseher, Kühlschränke und Smartphones – in Argentinien alles „Made in Tierra del Fuego“. „Die Leute hier sind Eiszapfen an der Nase gewöhnt“, lacht Blanca, die uns auf ihren Zeltplatz einlädt. „Wir öffnen Anfang Oktober, bei 7 Grad rennen uns die Familien die Tore ein.“
Erleichtert erreichen wir „die südlichste Stadt der“ Welt: Ushuaia. Im Haus von Zimmervermieterin Gloria tropft es von der Stubendecke, das Dach ist undicht und wir vermuten die argentinische Gelassenheit als Ursache. Sie kommt von selbst auf das Thema zu sprechen: Gas- und Strompreise seien erneut gestiegen, das Geld reiche einfach nicht, um zu sparen oder das Haus zu reparieren. Gelassenheit oder Geldmangel, vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. In der Pizzeria nebenan sechs Angestellte, eine kämmt sich die Haare, eine andere trinkt Kaffee, die nächste Mate, der andere flirtet, der Rest whatsappt. Am Flughafen frage ich den Kellner nach einem kleinen Rabatt und zahle den halben Preis – das sollte ich mal zu Hause versuchen?
Wir verlassen Kaltundwindistan und fliegen ins schwülheiße Buenos Aires. Der erste Weg führt zur Physiotherapeutin: Daniel kämpft mit Rückenschmerzen. Die Sprechstundenhilfe singt beschwingt, ihr Kollege empfängt in hautenger, kurzbeiniger Jeans. Eigentlich ist eine ärztliche Überweisung notwendig, aber „Tranquilo Amigo, das passt schon!“
Trotz seiner greisenhaften Silhouette hetze ich den alten Mann durch die Museen. Das ehemals größte Folterzentrum des Landes liegt mitten im Stadtzentrum. Während der Militärdiktatur wurden hier Ende der 70er tausende Oppositionelle gefoltert, vermummt und angekettet, aber nicht ohne noch ein Geschäft rauszuschlagen: Kinder der Regimegegner wurden unter Offizieren und Unternehmern verschenkt oder verkauft, Schwangere in einen extra Raum gedrängt, um zu gebären, bevor Piloten des Militärs sie mit den anderen Gefangenen narkotisiert ins Meer warfen. Als ihre Kinder und Enkel spurlos verschwanden, gingen die Mütter und Großmütter auf die Straße. Seit 1978 demonstrieren die Madres de Plaza de Mayo an jedem Donnerstag Nachmittag, wollen wissen, wo die Verschwundenen sind. 130 Enkel von 500 vermissten konnten sie finden. Niemand brachte sie zum Schweigen, auch dann nicht, als die Anführerin selbst verschwand wie ihr Sohn zuvor.
Zimmervermieter Nicolas lädt zum Asado: zur typisch argentinischen Abendbrotzeit, um zehn, wird das Grillgut aufgetafelt. Sein Stadtteil erinnert optisch an Neukölln. Anderthalb bis zwei Stunden pendelt die Freundin im Bus in die zehn Kilometer entfernte Downtown. „Freut ihr euch auf zu Hause?“, fragt uns Nicolas, als wir von unserem Flug nach Madrid berichten. Ja, nein. Nun.
„Südamerika war hart“, so könnte man die vergangenen sechs Monate zusammenfassen. Die Kälte der Hochgebirgswüsten, das Auf und Ab entlang der Carretera Austral, der Wind Patagoniens – die klimatischen Extreme zehrten mehr als erwartet, aber die Landschaften und Gastfreundschaft entlohnten zuverlässig für jede Müh. Bald werden wir Thüringen und Leipzig wieder so nahe sein wie seit zwei Jahren nicht mehr. Auf die Heimkehr stellen wir uns jedoch – noch – nicht ein und rollen in die entgegen gesetzte Richtung: nach Marokko.