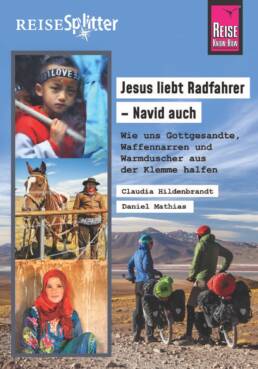USA - Kalifornien II
26. Juli – 25. August 2018 | 1.000 km, 9.650 hm
Mit – kein Witz – erhobenen Händen wagten wir uns etwa 70 Mal auf amerikanische Privatgrundstücke, um nach einem flauschigen Stück Rasen für unser Zelt zu bitten. Nur einmal reagierte der Eigentümer fuchsteufelswild. Keiner zog seine Knarre. Heute öffnet der Jackpot die Tür: die “Bezaubernde Jeanne”! Ein wahrlich guter Geist, denn sie bewirtet hauptberuflich auf Hochzeiten. Jeanne jubelt: “Come on in and have a drink!”, als hätte sie den ganzen Tag auf nichts anderes gewartet als zwei verschwitzte Radfahrer. Schwups hat sie Caipirinhas gezaubert und die mundgerechten Snacks einer Catering-Königin vor uns drapiert. Heiß duschen können wir auch. Und so eingemummelt in Gastliebe kann der Tag nicht wärmer enden!
Jeanne weiß, dass eine durchschnittliche Hochzeit in den USA 30.000 bis 50.000 Dollar kostet. Oft schon wurde mir in den letzten Monaten schwindelig angesichts der Beträge, mit denen hier bereits junge Erwachsene rechnen: eine Physiotherapeutin zahlte 100.000 Dollar für ihr Studium, ein Arzt mehrere Hunderttausend. Der übliche Pickup-Truck kostet 50.000, lediglich Häuser scheinen mit 100.000 bis 150.000 etwas günstiger. Im dürregeplagten Kalifornien bohrt man zudem regelmäßig, ob legal oder illegal, den eigenen Brunnen tiefer – für weitere 100.000 Dollar. Dazu sind die Häuser mit allem ausgestattet, was Mensch nicht braucht. Kein Single hinterfragt den wandschrankgroßen Kühlschrank, elektrische Korkenzieher und Eiswürfel-Dispenser gehören zur Grundausstattung und selbst in den trockenheißen Wüstenstaaten rumpelt der Trockner rund um die Uhr – es ist eben einfacher, die Wäsche von einem Loch ins nächste zu stecken, als mühevoll im Hof aufzuhängen. Der Zwang zum Unnützem, zum Horten von Ramsch bis das Haus platzt, ist auch durchs Camping nicht therapierbar. Ziemlich „outdoorsy“ sind die Amerikaner, doch selbst auf dem Zeltplatz müssen einige ihr gesamtes Spielzeug mitnehmen: Der Wohnwagen in Omnibusgröße reicht nicht aus – dieser zieht meist noch einen „Klein“wagen und der wiederum einen Anhänger mit Fahrrädern, Harleys und Boot. Selbst ein Flugzeug auf dem Trailer ist schon an uns vorbeigedüst. Stolz berichten manche, ihr ganzes Haus für das Camperleben verkauft zu haben: „Ich hätte nie gedacht, mit so wenig auszukommen.“ Ein Blick in das Wohnwagenschloss und ich weiß: Darin befindet sich mehr, als ich je besaß.
Das alles erzeugt den enormen Druck, Geld im Übermaß zu scheffeln. Amerikaner arbeiten nicht nur mehr Stunden am Tag als der Durchschnittsdeutsche, auch die Anzahl bezahlter Urlaubstage fällt mit etwa zehn pro Jahr mickrig aus. Die Kehrseite des amerikanischen Traums. Viele, die wir treffen, frönen einem Lebensstil, der sie zwangsläufig zu Jongleuren macht. Die sündhaft teure Ausbildung und Hochzeit, Haus und Truck sind der Anfang, immer neue Bälle kommen hinzu, immer höher der Einsatz, und immer schwieriger wird es, das rasante Spiel am Laufen zu halten. Wer bis Mitte 50 durchhält, kann sich wohlverdient zur Ruhe setzen und einen langen Lebensabend im Motorhome genießen. Wer jedoch einen Ball verliert, dem kracht mitunter die gesamte Existenz zusammen. Meist ist dieser entscheidende Ball die Gesundheit: Klinikrechnungen sind die Ursache für zwei Drittel aller Privatinsolvenzen in den USA.
„Meine Kasse wäre mich liebend gern los, die nennen mich ihr Million Dollar Baby!“, lacht ein Kalifornier, dessen Nieren-OP erdrückende 250.000 Dollar verschlang. Ein einwöchiger Krankenhausaufenthalt kostete – wohlgemerkt ohne jegliche Diagnostik oder Therapie – unfassbare 35.000 Dollar. Eine Mutter berichtet von ihrem privaten Spendenmarathon, um den Mindestbetrag von 5.000 Dollar zusammenzukratzen, damit ihre Tochter überhaupt auf die Organspendeliste durfte. Ein anderer beklagt den Verkauf seiner Waffensammlung, um die Krebstherapie der Frau zu bezahlen. Trotz der immensen monatlichen Beiträge für die Krankenkassen bleiben oft eine hohe Selbstbeteiligung und begrenzte Maximalerstattung, Zusatzpolicen und Ausschlussklauseln. Wen wir auch fragen, über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg, der Tenor ist stets der gleiche: „The whole system sucks!“
Dabei geben die Amerikaner mehr Geld für ihre Gesundheitsversorgung aus als jede andere Nation, mehr als doppelt so viel wie die Deutschen. Pharmakonzerne diktieren Arzneipreise und Ärzte verdienen Hunderttausende – auch, um die enormen Haftpflichtbeiträge zu finanzieren und Ausbildungsschulden zu tilgen. Da Krankenhäuser sowohl Gewinne maximieren als auch Notfallbehandlungen für Unversicherte durchführen müssen, werden regulären Patienten Mondpreise abgeknöpft und Notfallambulanzen geschlossen. Die USA zeigen, wie ein weitgehend marktreguliertes Gesundheitssystem scheitert. Uns gruselt, dass Deutschland in die gleiche Richtung steuert – wenn wir uns nicht dagegen wehren.
Wir wollen die wunden Nervenspitzen heilen und flüchten in die Natur, ganz im Norden Kaliforniens. Ihre Stämme schießen wie Nadeln, lang und astlos, über 110 m in die Höhe und überragen damit nicht nur die Freiheitsstatue, sondern locker alle anderen Bäume dieser Erde: die Redwoods. Ihre außergewöhnlich dicke, schwammige Borke macht sie unempfindlich gegen Waldbrände und Krankheitserreger, die schlanke Form trotzt Stürmen über Jahrhunderte – Sequoia sempervirens, der „Immerlebende“, fällt manchmal erst nach 2.000 Jahren dem eigenen Gewicht zum Opfer. Oder Holzfällern: Mitte des 19. Jahrhunderts versiegte der kalifornische Goldrausch und andere Rohstoffe mussten her. Als der Mensch die höchsten Bäume des Planeten entdeckte, tat er, was der Mensch eben tun muss: sie fällen und Hotels draus zimmern. Heute stehen noch 3 Prozent der ursprünglichen Bestände, der Rest wurde zu Bauholz und Zahnstochern verarbeitet. Wir verbringen einige Ruhetage auf dem schönsten Zeltplatz der Reise. Claudia wird plötzlich spirituell, umarmt die Bäume – und schreibt sich die Finger wund: „Das tollste Arbeitszimmer der Welt!“
Als wir die Küste verlassen, bestimmt eine ganz neue Herausforderung unsere Routenplanung: Feuer! Bereits im Juli steht Kalifornien in Flammen. Gewitterwolken gleich rollen Rauchschwaden in die Täler und verdunkeln den Himmel, die Temperaturen fallen spürbar. Glutrot flackert die Sonne selbst mitten am Tag, die Luft kratzt und schmirgelt wie Schleifpapier in meiner Lunge. Nachts rieselt Asche auf unser Zelt. Nie sind wir wirklich in Gefahr, doch die Dichte der Feuer trübt die Sicht wie dicker Nebel scheinbar überall, niemand kann sich dem Rauch entziehen, ein unheimliches Fahrgefühl.
Ende Juli platzte einem Autofahrer ein Reifen, die auf dem Asphalt schleifende Felge schleuderte einige Funken in die benachbarte Böschung, die augenblicklich zündelte. Was so harmlos anfing, sollte sich zu einem der verheerendsten Feuer der Geschichte des Bundesstaates auswachsen: das Carr-Fire. 40.000 Menschen werden evakuiert, acht sterben, mehr als 1000 zerstörte Wohnhäuser, 1,6 Milliarden Dollar Schaden. Der benachbarte Mendocino-Komplex vernichtet derweil ein Gebiet doppelt so groß wie Berlin und geht gar als größter Waldbrand in die Geschichte Kaliforniens ein – dabei hat die Saison gerade erst begonnen.
Der Bundesstaat erlebt seit Jahren wiederkehrende Dürren, schätzungsweise 130 Millionen verdorrte Bäume warten darauf, in Flammen aufzugehen. Die lang ersehnten Regenfälle 2017 segneten die Landschaft zwar mit üppigem Grün, das nun aber, im nächsten Jahr der Trockenheit, überall lichterloh brennt. Flächenbrände sind zwar Teil eines natürlichen Zyklus, werden aber oft schon im Keim erstickt, um besiedelte Gebiete zu schonen, denn immer mehr Städter ziehen aufs Land. Wesentlicher Faktor ist jedoch der Klimawandel mit sich beinahe jährlich überbietenden Rekordtemperaturen, die verheerende Waldbrände wahrscheinlicher machen. Selbst die Trump-Administration prognostiziert eine Erwärmung der Erdatmosphäre um bis zu 4 °C bis zum Jahr 2100, hält Gegenmaßnahmen aber für nicht durchsetzbar – das sei zu aufwändig.
14.000 Feuerwehrmänner sind in diesem Sommer im Einsatz, angespornt von bunt bemalten Plakaten der Einheimischen. Einer der Nationalhelden ist Tommy, ehemaliger Germanistikstudent und nun “Smokejumper”. Er springt mit dem Fallschirm in abgelegene Waldbrandherde und verbringt dort bis zu zwei Wochen, hackt in sengender Hitze Feuerschneisen frei, bedeckt die Flammen mit Staub und Steinen. Ein Knochenjob. Nur alle paar Tage bringt ein Helikopter frisches Trinkwasser und Nahrung.
350 Mal sprang er bereits, einmal sei er dabei im Baum gelandet. Angst im Feuer zu sterben hat Tommy nicht: “Ich würde schneller in einem Büro krepieren!” Er führt uns durch seine Basis im Bundesstaat Washington, hilft Daniel den 60-Kilo-Rucksack auf den Rücken zu wuchten, mit denen die Smokejumper nach vollendeter Mission zurück zu einer Straße wandern müssen. Für den Adrenalinsüchtigen ein Traumjob, der es ihm ermöglicht, im feuerfreien Winter das im Sommer verdiente Geld auf Hawaii zu verjubeln.
Wir überspringen einen Teil der verrauchten Gebiete dank unserer Mitfahrgelegenheit Dave, als verwundeter Veteran schon seit 30 Jahren berentet. Die Irakis schossen im Zweiten Golfkrieg seinen Helikopter vom Himmel, zwei seiner Kameraden starben. Veteranen sind wichtiger Teil des amerikanischen Mythos, der den Patriotismus schürt und die Nation zusammenhält: Straßen werden ihnen gewidmet, in fast jedem Supermarkt hängen Fotos der lokalen Krieger. „America, land of the free because of the brave“ – Freiheit daheim als Rechtfertigung für dutzende Invasionskriege. Trotz der allgegenwärtigen Heroisierung nehmen sich 22 Veteranen täglich das Leben. Eigentlich stellt das Department for Veteran Affairs extra Krankenhäuser und Therapeuten bereit, doch werden die Kriegsversehrten häufig auf Wartelisten geschoben. Selbst körperliche Wunden bleiben spärlich versorgt, ganz zu schweigen von den seelischen. Alkoholismus und Drogenkonsum folgen, jeder fünfte Obdachlose ist Veteran.
Über Veteranenkult und Kriegstreiberei regt sich einer ganz besonders auf: Kelvin, mit dem wir uns am Lake Tahoe zum Kayaken treffen. Ein schwuler Anarchist und hierzulande ein Exot, weil er in Gebiete verreist, deren Namen die Amis schwer aussprechen können. Kelvin chauffiert uns im Pickup, wir peppen die Junggesellenküche am Lagerfeuer auf – ein guter Deal!
Auch der weltbekannte Yosemite-Nationalpark bleibt aufgrund der dicken Luft wochenlang geschlossen, einmalig in dessen Geschichte, und so weichen wir zu den Vulkanen des Lassen-Nationalpark aus. Daniel checkt sämtliche Qualmprognosen täglich, mehrfach, stündlich, in aufgeregter Erwartung. In 2.500 m Höhe sind die Schwaden dünn genug, um Anfang August die Lightshow des Jahres zu bewundern: den Perseiden-Schauer. Bis zu hundert Meteoriten pro Stunde jagen über das Firmament, explodieren mit feurigem Schweif, der noch Sekunden nachglüht. Wir liegen im Schlafsack unter freiem Himmel, von Mitternacht bis zum Morgengrauen, und genießen den Film.
Das Visum drängelt und wir müssen schnellstens vom Inland nach San Francisco. Kaum zu schaffen, doch erneut purzeln wir ins Glück: Neben uns campen Mitch und Joni. Eigentlich ist deren Pickup schon voll bis oben hin, aber Mitch spielt verdammt gut Tetris und pfropft noch jeden Reiseradler mitsamt Gepäck ins Auto. Wir übernachten in ihrem Gästezimmer, werden mit Pizza und extrastarken Mojitos beglückt und am nächsten Morgen zur Fähre nach San Francisco kutschiert.
Dort begann unsere Nordamerika-Runde im Februar, die Stadt ist wie Cola: prickelnd, süß, trotzdem viel Elend. Doch wir kehren aus einem anderen Grund zurück: dem Wiedersehen mit Ruth und Edward. Die inspirierendsten Gastgeber der Warmshowers-Gemeinschaft. Die Weltgewandtesten. Reiseführer, Geschichtsbücher, Sprachführer, politikwissenschaftliche Analysen, die spannendsten Romane – ich will in ihren hunderten Büchern baden und erst wieder auftauchen, wenn ich all das Wissen eingesogen habe, das darin offenbart wird. Ruth kündigte ihren Job im Silicon Valley, um als Mathelehrerin zu arbeiten, Edward schreibt Reiseführer, verweigerte in den 80ern die Registrierung auf einer Anmeldeliste für einen möglichen Militäreinsatz in Afghanistan – und handelte sich damit viereinhalb Monate Gefängnis ein. In ihrem Haus hängen Demoplakate, für Obamacare, gegen Polizeigewalt, für weniger Rüstungsausgaben. Am liebsten würde ich gleich damit losmarschieren! Während ich den ersten Kuchen seit anderthalb Jahren backe, tobt sich Daniel im Garten aus. Er alleine übernimmt dieses Mal die Verabschiedung – stumm bin ich nur noch damit beschäftigt, nicht zu weinen.
Es gilt noch eine offene Rechnung zu begleichen: Big Sur. In engen Schleifen windet sich der legendäre Highway 1 die Steilküste entlang, rechts der Pazifik, links die kilometerhoch aufragende Santa Lucia Range. Noch bis August versperrte ein 800 m breiter Erdrutsch die Weiterreise nach Los Angeles, nach über einem Jahr Bauarbeiten ist die Durchfahrt wieder frei.
In Los Angeles, der Stadt der Engel, lebt eine besonders Herzensgute: Karen. Auch Mitglied bei Warmshowers. Bei unserer Ankunft ist der Kühlschrank für uns proppevoll gefüllt, auch hat sie bereits Kartons für den Flugtransport der Räder organisiert und ein vorausgeschicktes Paket mit Ersatzteilen aufbewahrt. Karen besteht darauf, allabendlich zu kochen und tanzt und springt wie ein junges Mädchen zwischen Herd und Esstisch. Das größte Wunder für sie selbst: Noch vor zwei Jahren konnte sie kaum gehen, mit 50 schon waren beide Hüften verschlissen. Karen, durch eine lang ersparte OP wieder fit, chauffiert uns sogar zum Flughafen.
Und nun folgt der schwerste Abschied. „Die Amis haben einen Knall“, meinte ein anderer deutscher Radtourist. Ja, ihr Konsumwahn, Veteranenkult, die Verschwendungssucht, närrische Waffenliebe, Kriegstreiberei und alles, was ihre aktuelle Regierung angeht, ist hanebüchen und himmelschreiend furchtbar. Und nein, wir wollten in diesem Land ganz sicher nicht leben: Die reichste Nation der Welt leistet sich ein Dritte-Welt-Gesundheitssystem mit beschämender Säuglingssterblichkeit und gar sinkender Lebenserwartung – im einzigen Industrieland überhaupt. Schon vorbeisausend auf dem Rad sind die Ursachen unheimlich spürbar: der ungesunde Lebensstil, die Verelendung ganzer Landstriche, Waffengewalt und die jüngste Opiatseuche, infolge derer mehr Menschen einer Überdosis erliegen als je zuvor. So abgesichert wir in Deutschland leben, so riskant ist das Jonglierspiel des amerikanischen Traums: Pechvögel können mitten im Diesseits bis in die Hölle fallen.
Dennoch war es hochspannend und lehrreich sich mit Menschen unterschiedlicher politischer Couleur auszutauschen. Die Neugier der Amerikaner, ihre entspannte Art, die Unterhaltungen am Lagerfeuer, vor Supermärkten, am Straßenrand, aber vor allem ihre wahnsinnige (!) Gastfreundschaft haben uns tief beeindruckt. Uns einen Spiegel vorgehalten, Himmel, wie verkappt und misstrauisch wir doch sind! Ich erwarte keine völlige Transition, keine Erleuchtung, auch nach einer solchen Reise bleibt der Mensch der gleiche, vielleicht etwas sortierter. Ein Erfolg wäre schon, sollten wir auch nur einen Bruchteil ihrer Geselligkeit übernehmen. Dann hätten uns die Amerikaner tatsächlich zu beschwingteren, hilfsbereiteren Mitmenschen gemacht.