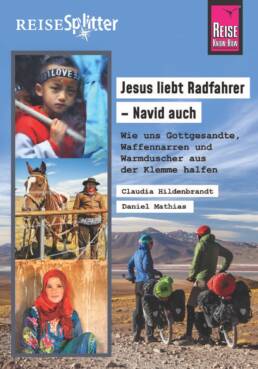Atacama & Altiplano
25. August – 26. September 2018 | 900 km, 8.710 hm
Sofort packt uns Santiago de Chile, lässt uns keine Zeit, das Erlebte in Nordamerika zu verdauen. Wir gönnen uns ein kleines Apartment, wollen uns verkriechen in Privatsphäre, langsam an Chile herantasten, Freunde wiedersehen. Nichts da! Für den googlenden Reisenden gibt es keine Gnade.
Bei Recherchen zur Pinochet-Diktatur wirft mir die Suchmaschine ein Foto unserer Air-BnB-Gastgeberin entgegen. Constanza sucht Eltern, sucht Töchter und Söhne. Während des Militärregimes in den 70er und 80er Jahren wurden die Kinder getöteter Oppositioneller verkauft. Ein Markt entwickelte sich, Ärzte, Hebammen, Sozialarbeiter, Richter, Politiker beteiligten sich am Menschenhandel. Verkauften nun auch Neugeborene mittelloser Eltern und hielten sie in dem Irrglauben, ihre Babys seien kurz nach der Geburt verstorben. Nachdem Constanza erfuhr, dass sie selbst verkauft wurde, gründete sie die Organisation „Nos buscamos“ („Wir suchen uns“). Constanza und ihr Team aus Ehrenamtlichen fahnden nach Geburtsurkunden und Akten, welche die wahren Eltern auflisten, arbeiten mit einem DNA-Labor zusammen. Überall hin wurden die Kinder geliefert, in die USA, nach Schweden, Deutschland. Bisher haben sich mehr als 3.500 Suchende in ihrer Organisation registriert, 32 Familien führte sie bereits zusammen, zuletzt verhalf sie einem in Chile geborenen Kalifornier zurück zu seinen Wurzeln. Ich versetze mich in die Lage seiner Mutter, der Constanza telefonisch beibrachte: „Ihr Junge lebt und sucht nach Ihnen.“ Einmal mehr auf dieser Reise schlucke ich Tränen. „Immer, wirklich immer, wenn ich öffentlich oder auf privaten Partys über Nos Buscamos spreche, ziehen mich anschließend Gäste zur Seite, die selbst auf der Suche nach ihren Eltern oder Kindern sind.“ Staatliche Zuschüsse für die Organisation hat sie hart erkämpft. Eine, die nicht nur Haltung zeigt, sondern handelt.
Constanza (unten rechts) mit ihrer wiedergefundenen Familie. Quelle: www.paula.cl.
Seit unserem letzten Besuch in Santiago 2014 hat sich allerhand gewandelt. Auffällig viele Schwarze verkaufen heute Tand und Snacks in den Straßen. Die vorherige sozialistische Präsidentin Bachelet öffnete die Grenze für Haitianer, die nach den Venezolanern die zweitgrößte Einwanderungsgruppe stellen. Und kaum Anschluss finden. „Als ich vor ein paar Jahren den ersten Schwarzen in meinem Leben hier sah, konnte ich nicht anders, als ihn anzustarren“, meint eine chilenische Freundin. Die aktuelle rechtskonservative Regierung um Piñera fährt zweigleisig: Sie wirbt die meist gut ausgebildeten, Spanisch sprechenden Venezolaner an, setzt jedoch die Hürden für Haitianer höher. Seit 2014 hat sich die Zahl der Migranten verdoppelt, mitunter kamen 30.000 Einwanderer pro Tag ins Land.
Und noch etwas fällt auf: In den Supermärkten sind viele Produkte mit Warnungen bedruckt: Achtung Zucker, Fett, Kalorien! Das zunehmend übergewichtige Chile hat eines der strengsten Gesetze zur Kennzeichnung und Werbung von Lebensmitteln weltweit eingeführt. Auf zuckerhaltigen Müslis dürfen nicht einmal mehr bunte Comicfiguren abgedruckt sein.
Nach einer Woche Radelfrei wollen wir weiter. „Da wart ihr doch schon?“, erinnert sich eine Bekannte, als wir von unserem Plan berichten, die sogenannte „Lagunenroute“ zu fahren. Recht hat sie, allerdings sind wir 2014 in geführter Tour im Sechsmann-Touristenjeep durchgepeitscht. Diesen Augenschmaus wollen wir noch einmal auf dem Rad erfahren. Das Rahmenprogramm klingt so verlockend wie abschreckend: Die Strecke führt von der Atacamawüste ganz im Norden Chiles hoch in das Altiplano Boliviens entlang unzähliger Lagunen und Vulkane zum Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Erde. Dazwischen liegen 440 Kilometer Sand- und Schotterpiste, Geröllfelder, Vulkan- und Salzwüste. Viele namenlose Pässe führen bis in knapp 5.000 m Höhe. Sauerstoff, Wasser und Nahrung sind – na klar – knapp.
Die Atacama erstreckt sich vom Süden Perus bis weit nach Chile, über 2.000 Kilometer Lebensfeindlichkeit. An manchen Orten hat es seit Menschengedenken, wahrscheinlich sogar seit mehreren tausend Jahren, nicht mehr geregnet. Der kalte Humboldtstrom im Westen verdunstet zu wenig Wasser, das sich abregnen könnte, und die hoch aufragenden Anden im Osten verhindern ein Hinüberschwappen feuchter Luft aus den Wäldern des Tieflandes. Umgeben von Wasser, und doch davon abgeschnitten: die trockenste Wüste der Erde.
Während der gut hundert Kilometer langen Fahrt von Calama nach San Pedro zähle ich eine Eidechse, zwei Fliegen und ein paar Büsche, ansonsten flimmert nur Sand vorüber, Schotter und verbackener Lehm. In der Pause schmiere ich ein Brötchen, das währenddessen schon zu Knäckebrot verdorrt. Abends kämmen wir uns Salz aus den Haaren, obwohl wir gar nicht merkten, dass die Haut überhaupt je feucht wurde. Die Lippen platzen auf wie Blätterteig, Bronchien und Schleimhäute wehren sich gegen das ungewohnte Klima. Schnaufend liegen wir im Schlafsack und haben nicht einmal 70 Kilometer geschafft. Zweifel kommen auf.
In San Pedro verbringen wir die Zeit mit der Suche nach möglichst energiereicher Nahrung, jede Kalorie pro Gramm zählt. Als Geheimwaffen entpuppen sich Butter, Parmesan und Dulce de Leche, der hier übliche karamellähnliche Brotaufstrich. Um unseren Kreislauf an die Höhe anzupassen, fahren wir zum Vulkan Lascar, dem aktivsten Nordchiles. Die Akklimatisation wird sich später bezahlt machen, bis auf Verdauungsstörungen und leichte Schlafapnoe wird uns die Höhenkrankheit verschonen.
„¡Vamonos – auf geht’s ins Altiplano!“ Von San Pedro führt eine steile, serpentinenlose Rampe in nur 42 Kilometern in über 4.600 m Höhe. Die klare Luft lässt die Dimensionen schrumpfen und wachsen zugleich, Entfernungen sind kaum schätzbar. Die Räder bleischwer bepackt, mit Nahrung für acht Tage und zehn Extralitern Wasser. Wir erliegen dem Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. Es ist, als würde man den ganzen Tag auf einem Ergometer sitzen und auf ein hübsches Landschaftsbild starren. Nach acht Stunden sind wir oben und passieren zugleich die Grenze Boliviens.
Seit mindestens 30 Millionen Jahren schiebt sich die ozeanische Nazca-Platte unter ihren östlichen Nachbarn, ein bis heute andauernder geologischer Prozess, der die Südamerikanische Platte an ihrem Rand immer weiter in die Höhe treibt und jene spektakuläre Berglandschaft bildet, die wir als Anden kennen. Die Abertrillionen Tonnen aufgeschmolzenen Gesteins fanden ihr Ventil in hunderten Vulkanen: Mal aufgereiht wie an einer Perlenkette, mal verstreut wie Pockennarben, die meisten erloschen, manche über 6.000 Meter hoch. Mittendrin bildete sich eine ausgedehnte Schüssel: das Altiplano. In der abflusslosen Senke konzentriert sich der Niederschlag der umliegenden Berge in bunten Lagunen. In den extrem salzigen und schwermetallhaltigen Gewässern können nur besonders robuste Mikroorganismen überleben.
Die Lagunenroute ist berüchtigt für ihre fürchterlichen Pisten. Ein Potpourri aus Wellblech und sandigen Wegen in allen nur vorstellbaren Zerfallsstadien, je nach Untergrund mal besser, meist jedoch schlechter fahrbar. Anhand der Staubwolken entgegenkommender Geländewagen versuchen wir zu erraten, welche Spur über festen Grund verlaufen wird, wechseln ständig die Seite, müssen absteigen und durch den tiefen Sand schieben, wieder für wenige Meter auf den Sattel, und so weiter. Ein kniffliges Taktikspiel – jeder gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer.
Vier Stunden wärme ich meine traktierten Muskeln in einer heißen Thermalquelle am „Straßen“rand auf. Irgendwann steigt ein Spanier dazu und der siebte Sinn trügt nicht: Pedro ist kein normaler Jeeptourist, sondern auf der Suche nach UFOs. Jetzt ist Feinsinn gefragt, wie erfährt man Details ohne ihm auf den Schlips zu treten? Schließlich will ich Daniel und mir die Viertelstunde Lachen gönnen, die wir laut Apothekenumschau täglich brauchen. Je naiver meine Fragen, desto mehr kommt Pedro in Schwung, ahmt energisch mit zwei Händen die Blinksignale der UFOs nach, singt Mantren, mit denen ich sie anlocken könne, verrät, er spüre hier Aliens überall. Der Energieling ist ganz eins mit der Natur, nimmt ein Billigshampoo, wäscht sich mit viel Schaum in der streng geschützten Quelle die Haare, und schaut dabei zu, wie die Energie der Chemikalien und die Chemikalien selbst direkt in die Lagune zu den Flamingos fließen …
Unser schöner Plan, die vorherrschenden Südwestwinde auszunutzen, scheint zunächst aufzugehen. Doch bereits am Abend künden Lenticularis-Wolken von einem Wetterwechsel, und tatsächlich: Die Vorhersage lässt einen orkanartigen Gegensturm mit Spitzengeschwindigkeiten von 110 km/h für den nächsten Tag erwarten. Um der gröbsten Thermik zum entgehen, starten wir schon im frostigen Morgengrauen. Eine kräftige Brise bläst von vorn, die gefühlte Temperatur sinkt auf -10 °C. Wenigstens geht es steil bergauf und uns wird warm. Erste Böen pusten mich vom Rad. Immer stärker wird der Sturm und schickt meterhohe Staubwände in unsere Richtung, bis die Zähne knirschen. In knapp 5.000 m Höhe kämpfen wir uns im ersten Gang durch den brüllenden Wind, kurbeln gegen eine unsichtbare Pranke, die an den Klamotten, Haaren, allem reißt, uns an den Armen packt und ins Gesicht schlägt. Alle paar Minuten müssen wir anhalten, einen sicheren Stand suchen und den Kopf unter die Achsel stecken, um uns vor dem Gröbsten zu schützen. Über vier Stunden benötigen wir für 22 Kilometer – Negativrekord.
Da war das Wetter noch besser.
Endlich biegt die Straße nach rechts, in die vermeintliche Sicherheit des Seitenwindes, und verläuft sich in unzähligen, nutzlosen Spuren eines Geröllfeldes. Die seitlichen Böen finden an den großen Fahrrädern eine noch bessere Angriffsfläche, werfen uns hin und her, vor und zurück, als würde man Spießrutenlaufen und jeder tritt mal kräftig dagegen. Wir hoppeln wie zwei Karnickel auf Speed über das Geröll, bis ich entnervt aufgebe und schiebe, ach, mich in den Dreck setze und fluche. Ich verfluche den Wind, die Kälte, die Armut Boliviens, das sich kaum Straßen leisten kann, aber am meisten verfluche ich mich selbst, dass ich mich auf dieses Himmelfahrtskommando überhaupt eingelassen habe, ich Idiot!
Ein Schweizer Pärchen im Geländewagen hält neben uns, Dahe kurbelt das Fenster herunter. „Voll geil, wenn ich mal groß bin, mache ich das auch!” Ich bin mir nicht sicher, ob er das ernst meint. „Wenn du blöd genug bist, nur zu…”, erwidere ich bitter lächelnd. Ehe ich mich wehren kann, stecken 100 Dollar in meiner Jackentasche. „Trinkt einen auf mich, wenn ihr in der Zivilisation angekommen seid!”, aufmunterndes Schulterklopfen gibt es obendrein. Extrem beschwingt von soviel Zuspruch und mit der Aussicht auf ein deftiges Essen, eine Flasche Wein und zwei Kilo Schokolade schieben wir weiter.
Hier gibt es eine kleine Herberge, die Wirtin schenkt uns mitleidsvoll ein warmes Mittagessen, ihr Mann will wissen, welche Länder wir bereits besucht haben. Als ich bei den USA angelange, stellt er mir eine Frage, die mich fast von der Bank fegt: „Dort sterben die Meerestiere, weil der Ozean verschmutzt ist, richtig?“ Er lebt an einem der trockensten Orte der Erde und ich bezweifle, dass er je einen Fisch in Natura gesehen hat. Trotzdem kümmert ihn das Sterben der Meerestiere. Wer von uns schert sich um ihn, dem der Klimawandel das Wasser raubt?
In den wenigen Herbergen unterwegs bemutteln und bevätern die Bolivianer uns, lassen uns kostenfrei übernachten, schenken uns Obst und Brot, obwohl sie täglich viele Touristen bewirten. Auch die Urlauber selbst vermachen uns die meist üppigen Reste ihres Abendbuffets, wir könnten essen für zehn! Wir sind unendlich dankbar für jedes liebe Wort, für jede Hilfe der Einheimischen und anderer Touristen, die uns unterwegs unzählige Motivationsspritzen injizieren. Ob wir es ohne sie gepackt hätten?
Nur einen Anstieg nach der Lagune beginnt die Siloli-Wüste, ein himmelweites Meer aus Schutt und Kies, wir winzig darin wie ein Stäubchen auf einem Körnchen Sand. Wir trauen uns nicht ohne zwei GPS-fähige Smartphones mit detaillierten Offline-Karten, Papierkarten und Kompass hierher, und obwohl die Navigation deutlich einfacher als früher ist, verfransen wir uns im Nirgendwo. Es bleibt nichts anderes, als ungeschützt auf 4.700 m zu zelten. Als die Sonne hinter den Bergen versinkt, fällt das Thermometer fast augenblicklich unter den Gefrierpunkt. Weit darunter, bis auf -15 °C. Vorsorglich verstauen wir die kälteempfindliche Elektronik und etwas Wasser für den nächsten Tag im Innenzelt. Am Morgen treiben mich keine zehn Lamas aus der Molligkeit der Daunen, bevor nicht die Sonne das Zelt auftaut. Die Schlafsäcke sind mit einem Panzer aus gefrorenem Kondenswasser überzogen, Raureif rieselt auf nackte Haut, die Zahnpasta ist zu Kaugummi erstarrt. Rein in die knochenharten Stiefel, Zähneputzen mit Eiswasser. Die Radtaschen sind so steif, dass die Finger bluten und selbst das Kocherbenzin so kalt, dass es kaum brennt.
Nach neun Tagen steigen wir allmählich herab und erreichen die Salzpfannen am Fuße des Altiplano, endlich wird die Luft wärmer und dicker. Pünktlich zum Sonnenuntergang frischt die Thermik noch einmal auf, und als wir das Zelt im Wind verankern wollen, wird klar, was wir vergessen haben: einen Stein! Wer hätte auch geahnt, dass es plötzlich an Steinen mangelt? Keine Chance, die Heringe in den harten Boden zu hämmern, also binden wir die Räder ans Zelt und hoffen auf das Beste.
Salar de Uyuni, der Salzsee von Uyuni. Schon sein Name lässt die Ohren klingeln und es gehört wohl zu den unverrückbaren Träumen einer jeden Radlerseele, einmal im Leben über seine unendlichen Weiten zu rollen. Wobei „unendlich weit“ nicht einmal metaphorisch gemeint ist: hundert mal hundert Kilometer, 10.000 Quadratkilometer misst der größte Salzsee der Erde und ist damit halb so groß wie Sachsen-Anhalt. Wer in seiner Mitte steht, sieht weiß, egal in welche Richtung.
Unser Ziel ist die Isla Incahuasi, Spitze eines erloschenen Vulkans, die aufgrund der Erdkrümmung vom Ufer aus allerdings nicht sichtbar ist. Dem Kompass folgend tauchen nach zwanzig Kilometern die ersten Umrisse auf, nehmen Kontur an, formen sich zu Kakteen und Felsen. Sie bietet Schutz, denn – kaum vorstellbar – auf dem See zu zelten, ist nicht ganz ungefährlich. Bolivianische Drogenschmuggler rasen unbeleuchtet durch die Nacht Richtung Chile, viele Fahrer der Tourjeeps tun es ihnen nach, um ihren Gästen einen besonderen Nervenkitzel zu bescheren. Immer wieder kommt es zu tödlichen Zusammenstößen.
Und das Salz ist keineswegs überall kompakt: Während der Regenzeit füllt sich der Salar, steht das Wasser knöcheltief und verdunstet im Laufe des Winters. Nun, während der Trockenzeit, ist die Oberfläche meist trocken und fest, doch der Wasserspiegel liegt nur wenige Zentimeter darunter. Das Salz schwimmt darauf wie eine Eisdecke. An manchen Stellen stehen Pfützen, an anderen bilden sich große Löcher, so tief, dass man deren Ende nicht sieht.
Die Mitte der Salzpfanne ist betonglatt, als rolle man über ein Blatt Papier, die Kristalle knuspern schön wie Kekskrümel. Je näher wir aber dem Ufer kommen, desto schlechter wird die Spur, ist oft nass und rau wie überfrorener Schneematsch, erinnert meist aber an in Porzellan gegossene Kiesel. Wie ein winziger Radfahrer, der über Legosteine rüttelt. Die ersten Schrauben fliegen vom Rad, der Kocher zerlegt sich selbständig, nach 60 Kilometern sieht der Inhalt der Lenkertasche aus wie durch den Betonmischer gedreht.
Mit tauben Händen und den Hintern bis ins Hirn gehämmert erreichen wir Uyuni. Was uns während unseres letzten Besuchs vorkam wie das letzte Kaff auf Erden, erscheint nun wie deren pure Verheißung. Wir schwelgen in den Annehmlichkeiten der Zivilisation, genießen ein richtiges Bett und dieses Loch in der Wand, aus dem heißes Wasser kommt, man nennt es wohl „Dusche“, und verstopfen fast den Abfluss.
Wir lesen noch einmal unseren Blog aus 2014, als wir die gleiche Route im beengten Geländewagen unternahmen. Binnen zwei Tagen wurden wir zum Ziel gekarrt. Dem Altiplano widmeten wir damals genau einen Abschnitt, heute füllen wir Seiten. Verliebt und millionenfach dankbar lächele ich mein Fahrrad an. Wie viel intensives Erleben, intensives Leben du uns doch schenkst!