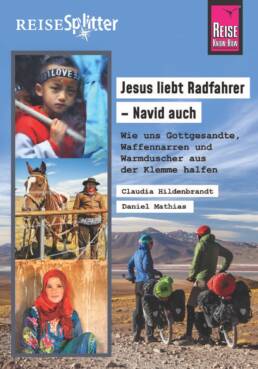Reisebericht Kirgistan & Kasachstan
Kirgistan & Kasachstan
10. Juli – 26. August 2017 | 2.140 km, 17.480 hm
Treppen aus verschlissenen LKW-Reifen, ausrangierte Tischdecken nützen als Sichtschutz für das Plumpsklo, zum Blumengießen taugen verbeulte Wasserkocher. Hier in Zentralasien landet nichts einfach im Müll. „Warum werft ihr neue Möbel weg?“, wundert sich dagegen ein 16-Jähriger Kirgise und zeigt mir einen Youtube-Clip vom Sperrmüll in Deutschland. Inzwischen flicken auch wir Zipp-Beutel, wechseln zwischen nur zwei T-Shirts und tauschen Schrauben gegen Putzlappen mit anderen Langzeitradlern. Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer – all unser Hab und Gut passt in ein paar Radtaschen. Braucht es mehr?
Nur ein Wunsch bleibt offen: das Fahrverbot für alle (!) Kirgisen. Wir plagen uns auf dem Highway von Osh Richtung Norden, wieder zermürben 40° im Schatten, schmeckt die Luft nach Ackerstaub. Auf der rissigen Spur dröhnen Sattelschlepper, drängen Minibusse, Testosteron- und Wodka-gesteuert. Die Straße gleicht einem Raubtiergehege, wo einzig das Recht des Stärkeren gilt. Selbst auf geschotterten Nebenrouten fegen uns die Raser ins Abseits. Nur ein improvisierter Abstand-Halter sichert vermutlich unser Überleben.
Als wir am Abend des 28. Juli vor dem Zelt ruhen, schießt in der Ferne ein grelles Licht empor. Der Feuerball zieht mit langem Schweif rasend schnell am Horizont entlang. 30 Sekunden starren wir ängstlich fasziniert gen Himmel. Sollte das etwa ein Komet sein, der auf die Erde kracht? Das hätten die Amerikaner sicher verhindert. Oder ein Flugzeugabsturz? Später erfahren wir, dass an jenem Abend eine bemannte Rakete vom 1.100 km (!) entfernten Stützpunkt Baikonur zur ISS aufstieg. In hektischer Erwartung des nahen Armageddon habe ich kein Bild zustande gebracht, aber so ungefähr hat es ausgesehen.
Eine Nebenstraße führt über etliche Höhenmeter aus der sommerlichen Hitze hinauf in die sattgrüne Gebirgswelt. 50 Kilometer ätzende Waschbrettpiste, grober Schotter, steile Serpentinen. Gut geschüttelt erreichen wir den Song Kul-See, der wie kaum ein anderer Ort das Klischee kirgisischer Landschaften verkörpert. Ein Meer geschwungener Hügel, rauchende Jurten, grasende Pferde – das ganze Land eine Wiese. Schafe und Kühe mähen durch die Täler, Reiter jagen einander in waghalsigen Manövern und fügen sich dennoch friedlich in dieses Idyll.
Die aus Holz und Filz gefertigten Jurten sind schnell errichtet, äußerst geräumig und trotzen jedem Wetter. Nur während des kurzen Sommers werden die Almen bewirtschaftet, denn schon im September fällt der erste Schnee, dann wird das Vieh in die umliegenden Täler hinab getrieben und das Plateau wieder verlassen sein. Jetzt mästen und melken die Hirten ihre Tiere, stellen Butter und Sahne her und trocknen den Dung zum Heizen im Winter.
Höflicherweise schlucken wir eine Schale Kymys hinunter: gegorene Stutenmilch, die im wesentlichen wie erbrochenes Bier schmeckt. Ähnlich wie Kymys fließt auch der Wodka zu allen Uhrzeiten. Allah nimmt’s wohl gelassener im muslimisch geprägten Kirgisien? Männer hofieren kleine Wohlstandsbäuche, Frauen bestimmen mit und Liebende heiraten ohne vorherige Arrangements ihrer Eltern. Erstmals in Zentralasien ertappen wir uns dabei zu vergessen, außerhalb Europas zu reisen. Noch dazu in einer autokratischen Gesellschaft, wo man Polizisten schmiert und Häftlinge foltert. Die familiären Bindungen sind der zentrale gesellschaftliche Kitt, auch die Älteren hoch geschätzt innerhalb der Familien. „Warum bringt ihr Deutschen eure Eltern in Pflegeheime?“, wirft mir eine junge Kirgisin verständnislos vor.
Zwischen Apfel- und Aprikosenbäumen zelten wir für einige Tage im Garten einer kirgisischen Familie am See Issyk Kul. Wir faulenzen derart, dass sich unser Gastgeber sorgt, wir würden unsere Zeit verschwenden. Endlich leihen wir einen Rucksack, schnüren die Wanderschuhe und machen uns auf in die Postkartenlandschaft des Altyn Arashan. Hoch zu Ross führt der Weg durch unwegsames Gelände, über Bäche und Geröllfelder – harte Arbeit für Pferd und Reiter(hintern).
„Muss dieser Abstecher nach Kasachstan wirklich sein?“, appelliere ich an den Arzt in Daniel, schließlich erwarten wir in der glühenden Steppe 45 °C und eine prekäre Wasserversorgung. Doch der Fotograf in ihm siegt – glücklicherweise! Eine „Kalt“front beschert uns angenehme Temperaturen und sogar Regen am Charyn-Canyon. Gleichnamiger Fluss grub in Jahrmillionen hunderte Meter tiefe Schluchten in die sonst flache Ebene. Wir zelten an deren Rande und sehen uns kaum satt an der spektakulären Aussicht.
Versteckt in den umliegenden Bergen liegt der Kaindy-See. Ein Erdrutsch bildete 1911 einen natürlichen Staudamm, die überschwemmten Fichten ragen noch heute wie Nadelspitzen aus dem türkisblauen Wasser. Das Highlight ist zwar nicht weit entfernt, mit den schweren Reiserädern allerdings kaum erreichbar. Entnervt stoppen wir einen Jeep, angeheuert von Anja und Petra aus Deutschland. Schnell zurrt der Fahrer die Räder auf dem Dach fest und wir sparen uns die tagelange Anfahrt.
Für viele Einheimische ist es kaum vorstellbar, aus eigener Kraft so weit zu reisen. Keiner läuft, jeder besitzt ein Pferd, Moped oder Auto. Entsprechend oft ernten wir ungläubiges Kopfschütteln, vielleicht Bewunderung, in jedem Falle aber Einladungen, Essen und Wasser.
Zurück in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek stelle ich mich einer heiklen Mutprobe: ich muss dringend zum Zahnarzt. Der schmunzelt, als ich ihm mit dem Smartphone-Übersetzer meinen Krater im Backenzahn erkläre. Ich hatte auf einen Kieselstein gebissen, hinterlistig versteckt in einer Aprikose, getrocknet am Straßenrand. Er zeigt mir das Betäubungsmittel aus Deutschland und legt los. Dawei, dawei!
Nach knapp vier Monaten verlassen wir nun Zentralasien und seine faszinierenden Landschaften. Selten zuvor genossen wir es so sehr zu zelten, ob in der freien Natur oder so manchem Obstgarten. Noch mehr jedoch beeindruckten uns die hilfsbereiten, offenen und vor allem geselligen Menschen: entspannte Frohnaturen, völlig entgegen unserer Vorurteile. Lange diskutierten wir mit ihnen über starke Präsidenten, das westliche Demokratieverständnis, Islam und Terrorismus – selten wurde unser Horizont so erweitert. Wir fühlten uns in Sicherheit und herzlich willkommen. Besonders freuten wir uns über praktizierende Muslime als Gastgeber, die uns am großzügigsten verwöhnten. Grotesk, reißt doch die Furcht vor Moslems derzeit eine tiefe, wiederum beängstigende Kluft in die Gesellschaften der westlichen Welt. In unserem Fall bedurfte es dieser Radreise durch Zentralasien, um besser zu verstehen, akzeptieren und unsere Denkmuster zu hinterfragen. Dennoch fühlten wir uns manchmal trotz der weiten Distanz zur Heimat ein Stück weit wie zuhause – dank der Gastfreundschaft und der nachhaltigen Erkenntnis, dass die Gemeinsamkeiten und nicht Unterschiede überwiegen.
Reisebericht-Tadschikistan
Tadschikistan
07. Juni – 10. Juli 2017 | 1.210 km, 13.950 hm
Sekt zur Himbeertorte reicht mir der Minister, „Dawei Dawei“ rufen die UN-Diplomaten, Zeit zum Anstoßen. So unwirklich wie ein glamouröser Hollywoodfilm erscheint mir unser Aufenthalt in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Und doch haben wir unser Zelt in dem wunderschönen Ziergarten eines WHO-Mitarbeiters aufstellen dürfen, kostenfrei, in direkter Nachbarschaft zum Präsidenten des Landes. Unser Gastgeber Igor ist Mitglied der Online-Plattform „Warmshowers“, dem Couchsurfing für Radreisende. Eine knappe Woche erfreuen wir uns an samtweichem Rasen, Kühlschrank und Wasserkocher. Lediglich die Party beim Minister unterbricht das Nichtstun. Dessen Sekt stimmt mich etwas gelassener, bin ich doch trotz der Rast recht angespannt. Einer unserer großen Sehnsuchtsorte liegt vor uns, die wohl faszinierendste wie auch zehrendste Etappe dieser Reise?
Der Pamir-Highway zählt zu den höchsten Fernstraßen der Welt und schlängelt sich in mitunter 4.700 m Höhe zwischen Duschanbe und der kirgisischen Stadt Osh durch das Hochgebirge. Den Besorgten zu Hause verheimlichen wir im Vorfeld weitere Details, denn einfach wird dieser Abschnitt nicht. Gastgeber Igor verabschiedet uns mit einem letzten Tipp: Wir sollten besser Wodka zu jeder Mahlzeit trinken, das desinfiziere zuverlässig. Schulmediziner Daniel verzichtet – und fängt sich prompt einen Brechdurchfall ziemlich übler Sorte ein.
Nicht nur Daniels Schwäche bremst. Die ersten 600 km im flacheren Terrain erstrampeln wir uns bei 40 Grad im Schatten: wie Ergometer fahren in der Sauna, nur staubiger. Schon morgens tropft der Schweiß von der Stirn ins Müsli. Auch der Asphalt wandelt sich zunehmend in holprige Piste. Und so sinkt die Stimmung umgekehrt proportional zur Hitze und körperlichen Schwäche.
Wir radeln durch kilometertiefe Schluchten, auf beiden Seiten stürzen bis zu 5000 m hohe Ausläufer des Hindukusch steil ins Tal. Die Straße klebt am Hang wie eine frische Spaghetti und jede Entfernung vom Flussufer bedingt entsprechende An- und Abstiege. So läppern sich einige tausend Höhenmeter, obwohl wir dem Strom in direkter Nachbarschaft folgen.
Tadschikistan ist das ärmste Land Zentralasiens. Ein Drittel der Einwohner leidet an Unter- oder Fehlernährung, der Zugang zu sauberem Trinkwasser bleibt einem Viertel verwehrt. Zum Bruttoinlandsprodukt tragen maßgeblich Geldsendungen tadschikischer Gastarbeiter bei, die sich im Baugewerbe russischer Großstädte verdingen. Hinzu kommt der Schmuggel afghanischen Opiums, wohl 200 Tonnen pro Jahr.
Noch größer scheint die Armut am anderen Ufer des Flusses. Afghanische Arbeiter räumen Erdrutsche mit Hacke und Schaufel, sprengen sich quälend langsam durch den Fels. Während auf tadschikischer Seite neue Straßen, eine stabile Stromversorgung und die Einnahmen des Tourismus unübersehbaren Fortschritt bringen, führt am afghanischen Ufer nur ein schmaler Pfad entlang, bleibt es nachts oft dunkel, hausen die Menschen in einfachen Lehmhütten und transportieren ihr Hab und Gut auf Eseln oder auf dem Kopf. Wir können ihnen zuwinken, sie sind zum Greifen nah, und doch so fern – das Leben ist nicht fair, wenn man auf der falschen Seite geboren wird?
Nach endlosem Auf und Ab – emotional wie auch gemäß Höhenprofil – erreichen wir Chorugh am Fuße des Pamir. Hier treffen wir endlich andere Radreisende und genießen jede Minute Plaudern und Entspannen mit unseren Gleichgesinnten. Der Pamir ist das Nadelöhr Zentralasiens, hier kommen alle durch.
Nach einigen Tagen kollektivem Nichtstun machen wir uns auf in die Hochebene des Pamir. Endlich gewinnen wir effizient an Höhe, werden die Temperaturen angenehmer, die Nächte kühler. Claudia kämpft mit verstopften Bronchien und ist schon auf halber Strecke völlig atemlos. Schnaufend queren wir schließlich den ersten von fünf Pässen über 4000 m Höhe – und werden belohnt mit buchstäblich atemberaubenden Aussichten, denn wir haben die Hochgebirgswüste des Pamir erreicht!
„Der Letzte hat es in sich“, warnen uns Entgegenkommende. Und mit wachsender Demut nähern wir uns dem letzten 4000er-Pass. Heftiger Gegenwind wirft uns zurück. Plötzlich bricht ein Sandsturm los, so stark, dass ich nicht mehr nach vorne schauen kann. Fliegende Reißzwecken in den Augen, der Nase, Sand knirscht zwischen den Zähnen. Doch in dieser endlosen Ebene finden wir weder Unterschlupf noch können wir unser Zelt in dem haltlosen Boden verankern. Weiter vorn ziehen schwarze Wolken auf. Ich fühle mich gefangen in dieser unendlichen Weite, meine Angst wächst und ich versuche hektisch, mir ruhig zuzureden (?). Später zähle ich meine Pedaltritte, um die Panik zu drosseln. Dann sichtet Daniel eine Anhöhe in einem Flussbett, mit Sandheringen und Felsen sichern wir unser Zelt. Der Wind zerrt mit aller Macht, feiner Staub dringt in jeden Winkel, wir verkriechen uns im Sandkasten und harren aus. Mutter Natur zeigt uns noch einmal, wer der Chef ist.
Am nächsten Tag hat sich der Sturm etwas gelegt. Doch nun strapaziert der Untergrund unsere Geduld. Bei weiterhin starkem Gegenwind holpern wir über groben Schotter und haarsträubende Waschbrett-Piste. Jeder einzelne zurückgelegte Kilometer ist ein Erfolg. Schließlich müssen wir die Räder im dichten Nebel den Pass hinaufschieben. 4.282 m. „Gratulation“, reicht mir ein Motorradfahrer die Hand, wir sind oben angekommen. Gefühlt habe ich den Gipfel des Mount Everest erreicht, so groß war die Anstrengung, so schwach die Beine. Wir passieren die kirgisische Grenze. Die Gewitterwolken des Vorabends müssen heftigen Regen gebracht haben, die Straße ist teilweise weggespült und von Erdrutschen verschüttet.
Auf der anderen Seite des Passes erreichen wir das Leben. Maigrüne Wiesen mit Pferden, Yaks und Jurten. So typisch für Kirgisistan, so belebend und wohltuend für uns. Der Pamir ist ein rauer Ort, abgeschieden, seine Berge und Salzseen bizarr schön. Er wirft uns zurück zum Menschsein, in unsere untergeordnete Rolle gegenüber der Natur. Wir sind demütig und dankbar, für einen Moment seine Gäste gewesen zu sein.
Reisebericht USA - Arizona & Utah
USA – Arizona & Utah
24. März – 03. Mai 2018 | 2.080 km, 20.630 hm
Blaubeeren, Knusperflocken, selbstgemachte Pfannkuchen, Orangensaft, Feigenmarmelade, Schoko-Donuts, für Daniel brutzeln die Eier in der Pfanne, duftet der Schinken im Ofen. Dorothys Gastliebe ist groß und vor allem großmütterlich: warm und üppig. Ich bin zutiefst gerührt, als ich am Morgen in ihre Küche strauchele, noch etwas angeschossen vom guten Weißwein des vergangenen Abends. Sie durchsucht die Schränke: „Ich versuche mich in euch hineinzuversetzen, was könntet ihr noch gebrauchen für unterwegs?“ Dorothy und John sind über 70, fit wie Turnschuhe und Mitglieder der Warmshowers-Gemeinschaft. Doch bieten sie weit mehr als eine Bleibe für die Nacht. Wir schlafen in einem Himmelbett und genießen den Luxus einer eigenen Haushälfte. „Ich backe euch noch schnell Brownies. Und bitte kommt im Sommer wieder, ihr könnt das ganze Haus für euch haben, wenn wir bei unseren Kindern wohnen!“ Der Abschied fällt uns ungeheuer schwer, nicht nur wegen der übervollen Radtaschen.
„Welcome to Grand Canyon State“, begrüßt uns eine Werbetafel an Arizonas Landesgrenze. Ich bekomme Gänsehaut. Ein Jahr sind wir mit den Rädern inzwischen getourt und haben die wunderschönsten Gegenden durchquert, doch der Grand Canyon ist ein Kindheitstraum. „Weder Hochglanzfotos noch Filme können Besucher wirklich auf dessen Anblick vorbereiten“, frohlockt schon der Reiseführer. Umso zäher scheint die Anfahrt durch topfebene Steppe, nur hier und da unscheinbares Buschland, Daniel kämpft mit Sekundenschlaf.
Endlich angekommen, lassen wir uns Zeit bis zum Sonnenuntergang und schieben die Räder erst am Abend Richtung Abgrund. Bis zur Kante verstecken Bäume das Nichts. Nur noch wenige Schritte. Aufregung vernebelt mir die Sinne und doch möchte ich jede Sekunde dieses Momentes dehnen und strecken, so wie man den ersten Kuss im Leben für immer genießen will. Amerikanische Touristen kommen uns entgegen: „Unfassbar“, schüttelt einer den Kopf. „Ich kann nicht glauben, was ich sehe“, kommentiert ein anderer. Als wir den Rand des Canyons erreichen, fange ich an zu weinen.
Der Canyon ist ein junges Gebilde. Erst vor sechs Millionen Jahren hob sich das Colorado-Plateau, seitdem fräst sich der gleichnamige Fluss immer tiefer in das Gestein und hat bis heute eine gewaltige Schlucht geschaffen.
Wir schlagen das Zelt neben Gavin auf, einem Wanderer, der die großen Trails Amerikas durchläuft. Diese Art von „Touristen“ reist extrem leicht, der Rucksack wiegt kaum mehr als ein Schulranzen. Zelt und Kocher sind nicht drin. Er schläft unter freiem Himmel und ernährt sich von chinesischen Fertignudeln, eingeweicht in kaltem Wasser, so wie die meisten anderen dieser genügsamen Spezies. Ein sympathischer, junger Typ, der sich vor Grizzlys und zu viel angestaubter Sesshaftigkeit zu schützen weiß. Doch dann der Schreck: Am Lagerfeuer „outet“ sich Gavin als Trump-Wähler, er habe sogar eine Rede von ihm besucht. „Trump kennt sich mit Wirtschaft aus“, so seine Begründung, „und er war der maximale Arschtritt. Eigentlich wähle ich die Demokraten, aber ich hatte einfach keine Lust auf die nächste Präsidentendynastie.“ „Aber spätestens als er einen Behinderten nachäffte, muss dir doch klar geworden sein, dass er ein menschliches Desaster ist?“ Gavins ehrliche Antwort: „Das habe ich ausgeblendet.“ Die nachfolgende Schweigeminute sagt mehr als tausend Worte. Doch anders als in Deutschland, wo ich vermutlich aufgestanden und gegangen wäre, fasse ich mich und suche weiter das Gespräch. Irgendwie ist es eine sportliche Herausforderung, sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen.
Wir treffen Harry, einen Pfarrer an der Route 66, der uns einlädt in seiner Kirche zu übernachten. Harry ist stockkonservativ, Republikaner und Waffennarr. „I have 25 beautiful guns, and I love them all!“, schwärmt er von der Anmut seiner Knarren. „Kommt mich zu Hause besuchen, dann können wir ordentlich ballern. Die Magnum wird euch den Arm auskugeln, ein heißes Teil!“ Du darfst nicht töten, heißt es in der Bibel – „Außer in Notwehr!“, verbessert Harry Gott. Seine Waffen lässt er sich nicht nehmen, deshalb die Stimme für Trump.
Andere entschuldigen sich beschämt oder fuchsteufelswild für ihren Präsidenten. Wir begegnen einer Jüdin, deren Familie aus Nazi-Deutschland floh. Nun hat sie sich den deutschen Pass besorgt, nimmt Sprachkurse und überlegt, ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern. Sie fühle sich nicht mehr sicher in diesem Land, das einen Rassisten ins höchste Amt gewählt hat. Die Geschichte schlägt Purzelbaum!
Sie schaut sich um und flüstert, während sie von ihren Plänen erzählt – nicht die Einzige und das schockiert uns noch mehr. In einem freien Land beginnen die Einwohner beim Thema Politik zu flüstern? „Wir wollen niemanden provozieren, die Situation ist angespannt genug.“ Selbst wir empfinden die Gesellschaft als stark polarisiert und es erstaunt uns nicht zu hören, dass während der letzten Wahl so manche Freundschaft zerschellte. Das Verzwickte ist ja, dass niemand tatsächlich Böses will, sondern alle nur das Beste für sich und ihr Land, aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Die Frage lautet also: Wie löst man die Herausforderungen der Zeit auf Kompromissbasis?
Im Zickzack führt die Strecke von Arizona in den Süden Utahs, von einem Highlight zum nächsten: Die Gegend ist mit Nationalparks so dicht gespickt, dass Bemühungen bestehen, das gesamte Gebiet zu einem zusammenhängenden Schutzgebiet zu erklären. Skurrile Sandsteinformationen kontrastieren mit glucksenden Bächen, lebensfeindlichen Wüsten und saftigen Tälern.
Auch auf Höhe des Bryce Canyon (2.500 m) bringt ein später Wintereinbruch noch einmal eisige Kälte und Schnee. Ich traue mich nicht aus den Daunen und weiß nun endgültig, Daniel ist verrückt: Wer bei sibirischen Winden noch weit vor Sonnenaufgang zu eingeschneiten Felsnadeln wetzt, der hat ein Rad ab – oder ist Fotograf.
Doch schon in wenigen Jahren wird die Szenerie ihr Antlitz spürbar verändert haben. Wasser und Frost erodieren den weichen, lehmigen Sandstein kontinuierlich und überraschend schnell, zersetzen die massiven Wände, bis natürliche Fenster, Bögen oder wackelige Kleckerburgen übrig bleiben. Im Amphitheater stehen besonders viele der filigranen Felstürme, manchmal so uniform aneinandergereiht wie Zinnsoldaten.
Bei knapp zweistelligen Minusgraden ist der Zeltplatz wie leer gefegt, nur die Hartgesottenen bleiben und klüngeln. Der typische Amerikaner ist eine gesellige Quasselstrippe und höflicher als die Queen. Oft helfen mir ungefragt andere Kunden durch das Supermarktlabyrinth oder empfehlen ihren Lieblingskäse. In der Warteschlange tippt niemand auf dem Smartphone, vielmehr passiert etwas ganz Verrücktes: Die Leute reden miteinander! Selbst der Kassierer plauscht entspannt. „Have a wonderful day, honey!“, verabschiedet er mich. Angestrengt wie erfolglos versuche ich mich zu erinnern, wann ich zuletzt einem Kassierer einen „wundervollen Tag“ gewünscht und einen deutschen Supermarkt lächelnd verlassen habe.
Doch der Gipfel amerikanischer Nettigkeit nennt sich „Pay it forward“, „Zahl für den Nächsten.“ Es passiert uns häufiger, dass der Kaffee an der Tanke oder das Eis im Café bereits für uns bezahlt wurde. Das Prinzip ist einfach: Man spendiert etwas im Voraus für den nächsten Gast, ohne zu wissen, wer der Glückliche ist. Man stelle sich das mal zu Hause vor! Für Wildfremde vorab bezahlen? No way!
Wir treffen Menschen wie Rebecca und Mark, die uns zum Schlafen in ihre Wohnwagen oder auf luxuriöse Zeltplätze einladen, zu Frühstück und Abendessen in Restaurants, die gar Geld in unseren Radtaschen verstecken. „Wir haben auch Söhne, die viel unterwegs sind und hoffen auf die Gastfreundschaft der Einheimischen.“ Da ist die Besitzerin eines Wohnwagenparks, die uns zwei Nächte spontan und kostenlos zelten und heiß duschen lässt. „Erzählt euren Leuten, dass wir nicht alle so sind wie unser Präsident.“ Manchmal gibt’s an der Supermarktkasse einen Rabatt, einfach so. Auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit über die Autobahn bietet einer an, uns extra 60 Kilometer zu fahren, er müsse eigentlich in die Gegenrichtung, „aber ich hab frei und mag Leute.“
Unsere Tour durch Arizona und Utah endet im Hinterhof eines Radladens nahe der Grenze Wyomings. „Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr möchtet!“, überlässt uns der Chef sein Grundstück zum Zelten. Und Mitarbeiter Josh zeigt am Lagerfeuer, wie man DAS amerikanische Nationalgericht zubereitet: S’Mores, die Abkürzung für „Some more?“. Ein Sandwich aus süßen Crackern, geschmolzener Schokolade und gerösteten Marshmallows. Die Amis wissen, wie man Zucker tankt!
„Wir haben uns als Fremde getroffen und als Freunde verabschiedet“, schreibt uns Dorothy später eine Nachricht. „Bekommt mein Daniel auch genug Eier und Speck?“ Würden wir all die Gastfreundschaft irgendwann an andere Reisende zurückzahlen wollen, wir hätten noch einiges zu tun. Aber man kann auch im Kleinen beginnen. Pay it forward – wieso nicht auch in Deutschland einfach mal dem Nachbarn einen Kaffee spendieren, an der Kasse einen Plausch halten und wieder häufiger einen schönen Tag wünschen? Oder Reiseradler wie uns für ein, zwei Nächte beherbergen?
Reisebericht Turkmenistan & Usbekistan
Turkmenistan & Usbekistan
20. Mai – 07. Juni 2017 | 1.350 km, 4.460 hm
Wir sitzen in einem turkmenischen Truckstop unweit der Grenze und ein Alien schlurft aus der Küche! Eins mit zwei X-Chromosomen, langer Mähne, knallpinken Hotpants und neongrünem Top. Wir staunen uns die Augen aus dem Kopf, so hatten wir uns schon an die vermummten Frauen Irans gewöhnt! Bereits zuvor erlebte ich einen galaktisch schönen Moment: Noch nie habe ich mich so gefreut, ein T-Shirt anzuziehen und die Hosenbeine meiner Zipp-Off-Hose abzutrennen! Das ist es, was wir am Reisen so lieben: völlig selbstverständliche Dinge können plötzlich paradiesische Züge annehmen.
Nach einer Kontrolle zäher als Kaugummi überqueren wir die Grenze erst zur Mittagszeit. Die Sonne erweicht den Teer zu klebrigem Honig, in flirrender Hitze haben wir bisweilen das Gefühl durch Treibsand zu fahren. Schnurgerade Straßen führen durch topfebene Wüste und stetiger Gegenwind treibt turmhohe Windhosen über das Land.
Turkmenistan kann durchaus mit den diktatorischen Eigenheiten Nordkoreas konkurrieren. Das Land wurde nachhaltig durch den Alleinherrscher Niyazov geprägt, der sich selbst die Namen „Führer der Turkmenen“ und „Diamantenkranz des Volkes“ gab. Per Gesetz benannte er alle Monate und Wochentage nach Mitgliedern seiner Familie, dazu einen Meteoriten und eine Melonensorte nach sich selbst. Seine Minister mussten ihn noch zu Lebzeiten zum Propheten ausrufen. Die Einnahmen aus den gewaltigen Erdgasvorkommen des Landes flossen sicher nicht ins Sozialwesen: alle Krankenhäuser außerhalb der Hauptstadt wurden geschlossen, die Renten gestrichen. Selbst der nachfolgende Präsident lockerte nur die aberwitzigsten Reformen (heute darf man wieder Musik im Auto hören), die Einwohner werden weiterhin von strenger Hand geführt. Doch wie auch in Iran treffen wir auf freundliche, hilfsbereite, wenn auch etwas zurückhaltendere Menschen. Schade, dass wir nur so wenig Zeit haben sie kennenzulernen.
Wir starten meist früh am Morgen, wenn die Thermik noch schwach ist, verschlafen die Mittagshitze in Truckstops und hangeln uns von einem Kaltgetränk zum anderen – die manchmal 60 km voneinander entfernt liegen. Dazwischen oft gähnende Leere, einige Büsche, Echsen und Dromedare. Doch nach striktem Zeitplan und in wechselseitigem Windschatten kommen wir unerwartet gut voran und erreichen glücklich wie erschöpft nach vier Fahrtagen die usbekische Grenze.
Und schon wieder ein Alien! Völlig platt holpern wir über eine Baustellenpiste gen Buchara, da schwebt eine bärtige Fata Morgana über den Asphalt: Christoph Rehage, der von Peking nach Hause läuft. Wir testen seinen Handwagen, kochen Kaffee am Straßenrand und feixen: das Buch über seinen Marsch durch China war uns eine große Inspiration, nun treffen wir ihn unterwegs!
Wenig später erreichen wir Buchara, eine der schönsten, wenn nicht die schönste Stadt Zentralasiens. Unzählige Moscheen mit ihren türkisblauen Kuppeln, bunte Teppichmärkte und sandfarbene Medressen – Islamschulen – prägen die Altstadt. Die Formen und Farben scheinen aus der Zeit gefallen, es hätte uns nicht gewundert, Marco Polo persönlich zu begegnen.
Während Daniel die Gemäuer bröckelig blitzt, werde ich von einer jungen Studentin angesprochen. Sie schwärmt von ihrer Hochzeit mit 700 Gästen, als das Telefon klingelt. Ihr Ehemann möchte wissen, wo sie sei, sie habe ihn nicht um Erlaubnis gefragt. Ich hake verdutzt nach, ob sie das denn nicht einenge, doch sie lacht: „No, no. Sweet sign of his love!“ Tage später wird mir ein anderer Student die patriarchalische Rolle des usbekischen Mannes bestätigen. Er trüge die Verantwortung für das (finanzielle) Wohl der Familie; seine Gattin bitte ihn stets um Rat und Erlaubnis. „Und wenn du deine Firma wechselst, würdest du deine Frau auch um Rat fragen?“ Er grinst: „Nein, sicher nicht.“ Meine westlichen Ohren möchten hören, dass Frauen unterdrückt würden und dies furchtbar schlecht sei, doch ich warte vergebens. Beide sehen in dieser Tradition einen Ausdruck gegenseitigen Respekts und Verantwortung.
Starker Rückenwind treibt uns mit bis zu 140 km pro Tag gen Osten, immer entlang der Seidenstraße. Jene ist im Grunde ein weit verzweigtes Geflecht verschlungener Handelsrouten, die seit jeher Orient und Okzident verbinden. Schon vor Jahrtausenden wurden Gewürze, Metalle, Drogen, Vieh und Menschen gehandelt; Seide aus China war so begehrt wir Buntglas aus Europa. Mit dem Aufkommen der Handelsschifffahrt verlor der Landweg stetig an Bedeutung, erfährt seit einigen Jahren jedoch, begünstigt durch chinesische Großinvestoren, ein unerwartetes Revival.
Dabei verkörpert wohl kein anderer Ort die orientalische Mystik wie Samarkand, zweitgrößte Stadt des Landes und in Teilen ebenfalls Weltkulturerbe. Heute prägen sowjetische Zweckbauten das Stadtbild, die antiken Bauwerke liegen dazwischen verstreut wie Teile eines Puzzles.
Wir radeln bei 40 °C durch dürre Steppe und beeindruckende Schluchten weiter gen Süden. Regelmäßig zum Nachmittag steigert sich das ohnehin große Interesse der usbekischen Männerschaft bis ins Unangenehme, denn bereits zum Mittag wird Wodka aus Teetassen gebechert. Dann sinkt die Distanz, Claudia wird angestarrt und die Räder ausgiebig befummelt. Derart aufgetankt fährt es sich gleich viel leichter; eine reine Männerdomäne übrigens, wir sehen keine einzige Frau hinterm Steuer.
Eigentlich müssten wir alle drei bis fünf Tage in einem Hotel übernachten, sonst gäbe es laut Reiseführer Ärger mit der Grenzpolizei. So richtig halten wir uns daran nicht. Vielmehr genießen wir es, unser „palatka“ – Zelt – auf den Innenhöfen usbekischer Familien aufzustellen. Die anfängliche Scheu verfliegt spätestens, wenn wir unsere Herkunft verraten, dann rufen sie begeistert „RB Leipzig“ und „Modern Talking“. Schnell werden Teppich und Kissen für das Abendbrot unterm Sternenhimmel ausgerollt und wir spontane Nutznießer usbekischer Subsistenzwirtschaft. Suppe, Fladenbrot, Salat, hausgemachter Ayran (gegorene Kuhmilch) und die Himbeer-ähnlichen Früchte des Maulbeerbaumes – ein echtes 5-Sterne-Dinner nach einem langen Tag auf dem Rad.
Die Eltern arrangieren hier oftmals die Ehen, zumindest müssen sie einverstanden sein. Wenn sich die Ehepartner streiten, suchen auch die Väter nach Lösungen. Scheidungen gibt es äußerst selten, komme was wolle. Der familiäre Zusammenhalt steht im Zentrum, nicht das Individuum. Ich denke an die hohe Scheidungsrate und geringe Geburtenquote in Deutschland und fühle mich plötzlich in der Defensive. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob der in unseren Werten über alles hoch gehaltene Individualismus tatsächlich die beste Form des Zusammenlebens ist. Allerdings treffen wir niemanden, der in seiner arrangierten Ehe unglücklich ist, misshandelt wird und seinem Schicksal nicht entfliehen darf.
Auch ich möchte fliehen – vor dem Grenzpolizisten, der nach den fehlenden Hotelregistrierungen verlangt. Mit treuherzigen Rehaugen und dummdoofer Unschuldsmiene tue ich so, als wüsste ich von nichts. Und als es nicht mehr dümmer geht, dürfen wir endlich passieren! Nach den vielen Kilometern durch staubige Wüsten und Steppen freuen wir uns nun auf ein lang ersehntes Abenteuer in schwindeligen Höhen: die Querung des Pamir. Mit wachsender Aufregung fahren wir Tadschikistan entgegen!
Reisebericht Iran
Iran
23. April – 20. Mai 2017 | 1.530 km, 9.310 hm
Unsere Reise steht vor dem Aus, noch bevor sie begonnen hat. Die iranische Polizei hält Daniel am Teheraner Flughafen fest, mit seinem Pass stimmt etwas nicht. Es ist Mitternacht und Interpol schläft; auch macht der Notdienst der Deutschen Botschaft wenig Hoffnung. Blass und müde sitzt der Arme zwischen Wachmännern im Transitbereich, während ich bei unserem Gepäck kauere. Nach sieben Stunden bangen Wartens kommt er mir endlich lächelnd entgegen.
Zügig bauen wir die Räder zusammen und werden erstmals der iranischen Gastfreundschaft – Gastliebe! – gewahr. Mitarbeiter und Reisende wuseln um uns herum, schenken uns ein Kilo Pistazien. Handyfotos von Lothar Matthäus und Bayern München machen die Runde. Selbst Leipzig kennen die Jungs, schließlich ist RB aufgestiegen. Dann wird die Szene wahr, die ich hunderte Male wie ein Film im Kopfkino abgespielt habe: wir setzen uns auf die Räder und rollen vom Flughafen hinein in die Welt.
Auf den ersten Kilometern machen wir uns mit den landestypischen Autobahnen vertraut. Knatternde LKW und Busse überholen sich gegenseitig links und rechts, immer einen Finger an der Hupe. Die Sonne knallt und der Gegenwind schmeckt nach Diesel. Später in den Bergen quellen die Abgase so dicht aus manchem Tunnel, dass wir meinen, es müsse darin brennen. Nach Schätzungen der WHO sterben etwa 25.000 Iraner jährlich auf den Straßen, knapp achtmal mehr als in Deutschland (bei vergleichbarer Einwohnerzahl). Dennoch kommen wir relativ sicher auf dem Seitenstreifen voran – bis wir den sechsspurigen Highway kreuzen müssen …
Nicht nur der Verkehr drückt das iranische Image: Das Land ist eine islamische Theokratie, ewiggestrige Autokraten instrumentalisieren den Glauben als verpflichtende Ideologie und festigen so die eigene Macht. Die Mullahs um den geistlichen Anführer Khamenei bestimmen auch, wer zur Präsidentschaftswahl zugelassen wird. Demonstranten werden verhaftet, Zeitungen verboten. Regimegegner laut Amnesty International öffentlich hingerichtet, ausgepeitscht oder Gliedmaßen amputiert. Schon die Zeichnungen in Kinderbüchern zeigen, wie man Verbrecher erhängt – nur China verhängt mehr Todesstrafen.
Wie alle Frauen in Iran muss auch ich ein Kopftuch und lange Kleidung tragen, selbst auf dem Rad. Ich fühle mich verkleidet, schäme mich für die Kombi aus Zipp-Off-Hose und feinem Kopftuch und stelle mir vor, wie ich diesen nervigen Schweißfänger und Im-Essen-Hänger hinter der Grenze vor den Augen der Polizisten verbrenne. Vier Wochen dauert dieses einmalig unangenehme Reiseabenteuer für mich – die Iranerinnen müssen sich ihr gesamtes Leben dieser Pflicht beugen. Zwar studieren Frauen hier häufiger als Männer, dennoch sind sie in politischen Gremien oder Führungsriegen rar. Zeugenaussagen von Frauen gelten vor Gericht wenig, nur selten erhalten sie nach Scheidungen das Sorgerecht.
Zudem klebt der Name Ahmadinedschad am iranischen Aushängeschild; ein Kriegstreiber, der mit Atombomben drohte und bis 2012 als Präsident das Land vom Westen und vom Fortschritt isolierte. Viele warnen uns vor diesem Schurkenstaat – doch sehen wir keinen einzigen Terroristen, außer vielleicht diesen …?
Von antiwestlicher Stimmung spüren wir hier nichts: selten haben wir uns in einem Land so willkommen gefühlt. Täglich überladen uns die Menschen mit Brot, Gurken, Bonbons, Rosen, Keksen, CDs, Orangen, Malzbier und Muffins. Manchmal passt nichts mehr in die Radtaschen. Zum Zelten kommen wir hier kaum – mitunter werden wir regelrecht „weggefangen“ und mitsamt den Rädern zum Haus der Gastgeber chauffiert.
Wir essen im Kreis der Familien und werden Zeugen überraschender Szenen: einer holt Bier aus dem Kühlschrank, geschmuggelt aus der Türkei und 8 Euro teuer. Ein anderer äfft den singenden Muezzin nach. Mit der „Kopf ab“-Geste deutet der nächste Gastgeber auf seinen Führer Khamenei im TV. Ein Deutschiraner wettert: „Die IS-Terroristen sollten hier für zwei Monate leben – sie würden sich vom Islam abwenden!“ Und immer wieder bittet man uns: Erzählt den Deutschen, dass wir keine Terroristen sind. Sondern gute Menschen!
Mit steigender Höhe fallen die Temperaturen um 25 °C. Nachts toben heftige Gewitter, es hagelt ohrenbetäubend laut, Blitze erhellen die Dunkelheit und Donner lässt den Boden vibrieren. Obwohl wir sicher zelten, ist uns äußerst mulmig, wir liegen lange wach und zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner.
Nach einigen Tagen entlang des Meeres wenden wir uns wiederum gen Südosten und queren den Golestan-Nationalpark. Die Einheimischen bewerben ihren „Dschungel“, dabei handelt es sich um den kläglichen Rest einst ausgedehnter Laubwälder – der Rest fiel der Abholzung zum Opfer. Langsam erreichen wir das trockenheiße Hochplateau, das einen Großteil des Landes ausmacht. Binnen weniger Radstunden ändern sich die klimatischen Bedingungen, Gewitterstimmung liegt in der Luft.
Schon jetzt im Mai erreichen die Temperaturen deutlich über 30 °C im Schatten, wie muss das erst im Sommer sein? In der nächtlichen Kühle genießen wir ruhige Stunden zwischen den Hügeln, lauschen dem Pfeifen der Ziesel, Zirpen der Grillen und dem Ruf der Füchse. Tagsüber werfen uns heiße, teils stürmische Winde fast vom Fahrrad, bringen aber keine Erleichterung. Claudia schmort unter der langen Pflichtbekleidung und schummelt: entweder Helm oder Kopftuch, beides ist zu viel des Guten!
Als wir eines abends in der weitläufigen Landschaft zelten, wir haben schon gegessen und liegen fast in den Schlafsäcken, taucht unvermittelt die Polizei auf. Man verlangt nach den Pässen, fragt, ob wir auch verheiratet seien und verweist uns des Platzes – irgendetwas sei gefährlich. Selbst die telefonisch hinzugerufene Übersetzerin vermag nichts zu konkretisieren. Doch als in der Ferne zwei Hunde jaulen, ist es vorbei. „Mister, danger animal!“ Nach zähen Verhandlungen im Schein der Stirnlampen werden wir schließlich zur größten Moschee der nächsten Stadt eskortiert, mitunter in Begleitung mehrerer Polizeiwagen und eines guten Dutzends Schaulustiger. Dort empfängt der Vorsteher persönlich. Also mich, denn Claudia wird konsequent ignoriert – das einzige Mal in diesem Land. Erst nach zahllosen Höflichkeiten, einigen Gläschen Tee, Keksen, einem Rundgang durch Moschee und Garten, noch mehr Tee und Süßigkeiten fallen wir um Mitternacht endlich ins Bett.
Schneller als gedacht erreichen wir Mashhad nahe der turkmenischen Grenze. Die heiligste Stadt des Landes hütet den Schrein des 8. Imam Reza, einen mit Lapislazuli, Gold und Silber reich verzierten Kuppelbau inmitten des Heiligen Bezirks – und so berühmt, dass dessen Erbauer später auch das Taj Mahal in Indien planten. Uns Ungläubigen ist weder der Zutritt zum Schrein noch Fotografieren mit einer Kamera gestattet. Ringsum locken unzählige Hotels, uniforme Safran-Shops, Schmuckläden und Fastfood-Buden 25 Millionen kauffreudige Pilger jährlich. Wir entspannen ein paar Tage, bevor es Richtung Turkmenistan weitergeht.
Iran erscheint uns als Gefängnis, allerdings mit derart herzlichen, hilfsbereiten und aufgeschlossenen Insassen, dass wir bisweilen vergessen hinter Gittern zu sein. Wann immer wir den biederen Khamenei im TV predigen hören, offenbart sich die gewaltige Kluft zwischen den rückwärtsgewandten Mullahs einerseits und den freundlichen und oft von Deutschland schwärmenden Menschen andererseits. „Betet für uns!“, bittet mich eine Wächterin im Heiligen Schrein Imam Rezas. Und in diesem Moment würde ich sie so gerne mit nach Deutschland nehmen. Dem Paradies auf Erden.