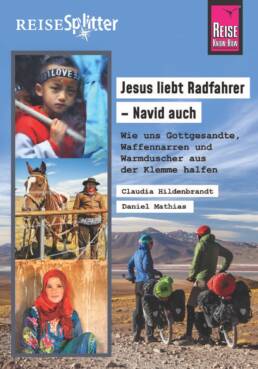Heimkehr
18. April – 05. Juni 2019 | 2.140 km, 11.920 hm
Noch in Marokko galten wir als reiche Deutsche, zurück in Spanien gehören wir wieder den Landstreichern, den Streunenden an. Denn inzwischen sind die Schuhe löchrig, die Hosen abgetragen, der Muff feuchter Zeltnächte klebt an uns und der Ausrüstung. Auf den ersten Blick sind wir schon längst nicht mehr Arzt und Politikwissenschaftlerin. Kein Spanier spricht uns an, dafür Algerier und Libanesen, ein Mauretanier lädt zu sich nach Hause ein. Wir schämen uns in Szenecafés, wirken deplatziert in jenem Milieu, in dem wir uns zuhause so selbstverständlich bewegten. Eine kostbare Erfahrung, die durchaus erdet, fühlten wir uns doch stets heimisch in „der Mitte der Gesellschaft“, hier und jetzt aber als gesellschaftliche Außenseiter. Trotz knappem Budget geben wir heute Obdachlosen mehr denn je, auch weil wir um das Privileg wissen, anders als sie zwischen den Lebenswelten wandeln, aus jeder Vorteile schlagen zu dürfen.
Anstrengender als gedacht erweist sich die Heimfahrt über Frankreich und die Schweiz. Es regnet, es gegenwindet. Kein Höhenflug, kein Rausch will sich einstellen, der uns nach Hause trägt. Landschaftlich reizvolle Bergrouten versinken in einer schwarzblauen Wolkenfront – oder im Schnee. Damit steht die Routenwahl fest und das Navi bekommt die klare Ansage: „Asphalt! Nebenstraßen! Flach!“ Knapp 32.000 km lang haben wir keinen Pass gescheut, die Räder über sandige Pisten in 5.000 m Höhe geschoben und durch Regenwälder gehievt. Das Flussradeln erlaubt nun stumpfes Kurbeln, damit der Kopf den Körper nicht mehr zu Höchstleistung anfeuern muss, sondern nur noch Gedanken und Gedankenlosigkeit atmet.
Ankunft in Frankreich, die erste Bäckerin sitzt gebannt vor der Flimmerkiste, Präsident Macron hält seine Rede an die Nation. Der sei aber nur für die Reichen da, sie wähle Marine Le Pen und ihre rechte Partei, denn es lebten zu viele Muslime im Land, wenn auch nicht in ihrem Dorf. „Würde sich denn Ihr Leben verbessern, wenn es weniger Muslime gäbe?“ „Ja doch, meine Kinder würden in einem Land ohne verschleierte Frauen aufwachsen.“ Sagt’s, und schenkt uns Ausländern eine ganze Tüte Gebäck.
„Großzügigkeit ist an keiner Ideologie festzumachen, an keinem sozialen Status, keiner Religion“, schreibt Andreas Altmann, der weltenbeste Reisereporter. Muslime haben uns wie Könige empfangen, Muslime haben uns geschröpft, Trump-Wähler mästeten uns, Trump-Wähler hupten uns von der Straße. Ob Junge, Alte, Hipster, Spießer, Dicke, Dünne, Schwarze, Weiße – „Generosität ist eine geheimnisvolle Eigenschaft, sie folgt keiner Regel, kein äußeres Anzeichen eines Menschen lässt auf sie schließen, kein Vorurteil hat mir je recht gegeben. Auch unter Hippies und Punks tummeln sich Geizkrägen, auch unter feinen Pinkeln und Lackaffen verkehren Gemüter, die mit Leichtigkeit loslassen.“
Nie zuvor waren wir so hilfsbedürftig wie auf dieser Reise, so abhängig vom Goodwill fremder Menschen. Essen, Zeltplatz, Wasser – nicht einmal die Grundbedürfnisse hätten wir ohne freimütige Einheimische vielerorts stillen können. Die Angst, dass diese Erkenntnis verblasst, ist groß. Wir können uns nur die Fotos der Gebenden an die Wände hängen, ins Gedächtnis tackern, hämmern, meißeln, schweißen, um uns immer wieder vor Augen zu halten, wie Gastfreundschaft geht und vor allem: wie gut sie tut. Wir begannen die Reise mit wenigen Vorbildern – und kehren mit dutzenden zurück.
Dabei erleichterten uns nicht nur geschenkte Kaltgetränke, Obstkörbe, Dollarscheine und all die angebotenen Gästebetten das Radlerleben. Niemals hätten wir gedacht, wie viel beschwingter man reist, wie viel optimistischer man lebt, trifft man auch nur einmal am Tag auf eine nicht alltagszerknitterte Seele, die ein herzliches „Hallo!“ zuruft. Sich erkundigt, ob sie helfen könne. Wie sehr ein Daumen hoch, ein fröhliches Winken auch über schwerste Etappen tragen kann, unvorstellbar! Ich habe Angst, wieder im Meer der Sorgengesichter zu verschwinden und zwinge in Europa auch die muffligste Verkäuferin in einen Plausch, bis ich ihr ein „Gute Weiterreise“ entlocke.
Auffallend viele E-Bikes düsen uns auf brettebener Strecke entgegen. Darauf jedoch keine Schwangeren, Gebrechlichen und Langstreckenpendler, sondern junges Gemüse im Aktivurlaub. Zwanzigjährige führen ihre Hunde auf dem Segway Gassi. Als würde das Lithium der Batterien auf Bäumen wachsen und nicht in knochentrockenen Wüsten abgebaut, wo es die Wasserknappheit der Bewohner noch weiter verschärft (für die Herstellung von einer Tonne Lithiumsalz werden zwei Millionen Liter Wasser benötigt). Nach den vielen Unterhaltungen mit betroffenen Bauern in Bolivien und Argentinien würde uns ein E-Motor unterm Hintern fürchterlich ins Gewissen beißen. Wir radeln nun durch die reichsten Länder der Welt und merken, wie uns der hiesige Kaufzwang inzwischen abstößt. In einer Hyperkonsumwelt, in der uns Tech-Firmen zu grenzenloser Bequemlichkeit verführen, uns selbst im „Aktiv“urlaub, im „Smart“-Home zu infantilen, pflegebedürftigen Konsumschafen degradieren wollen, müssen wir uns entweder immer wieder die Frage stellen: Brauche ich das wirklich? Oder bräsig, bequem, fremdgesteuert – und immer auf Kosten anderer – Quatsch im Überfluss anhäufen.
Mehr denn je empfinden wir Besitz als Last, als Verpflichtung und Zeitverschwendung, denn er will verdient, gewartet, geputzt und gezeigt werden. „Eine schöne Entreicherung habt ihr da durchgemacht!“, bemerkt eine Passantin. Zwei Jahre und einen Monat lebten wir aus fünf Radtaschen, kochten auf einem Benzinkocher, teilten uns ein Handy und das einzige Messer. „Ihr habt ja nicht nur euer ganzes Erspartes ausgegeben, ihr habt in dieser Zeit auch nichts verdient“, sorgt man sich. Wir haben das Geld also gleich doppelt verprasst – und fühlen uns doch reicher denn je.
Keine Inflation, kein Börsencrash, kein Jobverlust, Hausbrand, Diebstahl, kein Einbruch kann uns die Erinnerungen und Erkenntnisse rauben, die wir täglich horteten. Den überquellenden Fundus an Storys, die wir uns noch in sechzig Jahren erzählen werden. Nie zuvor haben wir intensiver gelebt, mehr gelernt, mehr gelitten, mehr genossen! Nie lagen wir zweifelnd in den Schlafsäcken und fragten uns: „Was haben wir heute eigentlich gemacht?“ Nur Wetter und Natur bestimmten unseren Alltag, kein Chef, keine Behörde, kein Auto, das abbezahlt werden will. Jeder Pedaltritt frei und selbstgewählt. Die Zeit zum Lesen, für Muße und Gedanken schien grenzenlos. Wenn wir Luxus und Reichtum definieren sollten: für uns wäre es diese Reise!
Steinreich fühlen wir uns auch wegen der herzlichen Schweizer und deutschen Freunde, die uns auf dem Weg nach Thüringen empfangen. Uns verwöhnen mit selbstgebackenem Brot und Kuchen, Grillabenden, minutiös geplanten Drei-Gänge-Menüs – und allen voran wundervollen, vertrauten Gesprächen.
Unsere Schweizer Reisefreunde Marcel und Fiona.
Die Luzerner Weltradler Roger und Julia (Mitte) inspirierten uns zu dieser Reise.
Pia, Angelika und Norbert luden uns schon in Kanada zu sich nach Biberach ein.
Wiedersehen mit den Langzeitradlern Ralph und Imke in Schwaben.
Mit Traudl und Lothar wanderten wir 2013 in Nepal.
Fotografiefreunde Axel und Heike aus Nürnberg: jeden Abend ein Fest!
Nach 750 Tagen erreichen wir die Grenze zu Deutschland. Nie hätte ich geglaubt, dass mich der Anblick einer Flagge zum Weinen bringen könnte. Tagelang stiere ich auf die Kennzeichen vorbeifahrender Autos, sauge alle Schrift der Straßenwerbung auf, um mich immer wieder zu versichern, dass wir wirklich zurück sind. So sehr wir das Reisen lieben, so sehr vermissen wir unsere Familien, unsere Freunde. So körperlich und seelisch leidvoll war manche Etappe. Auch platzt der Kopf von Eindrücken, wir spüren immer mehr, wie sehr wir uns nach Privatsphäre und einem eigenen Badezimmer sehnen. Öfter schlagen wir Übernachtungseinladungen von Fremden aus, die wir zu Beginn so selbstverständlich angenommen hatten. „Wenn die Neugier nachlässt, geht es zurück“ – wir halten an unserem Credo fest. Es ist der richtige Zeitpunkt, heimzukehren.
„Habt ihr unterwegs denn keine Angst?“, so die vielleicht meist gestellte Frage. Nein, eher Respekt vor dem Unbekannten. Viel mehr Sorge bereitet mir nun vor allem eines: dass das Intensive aus dem Leben schwindet, dass die Fahrwässer des Alltags zwar ein angenehmes, vielleicht auch beständigeres Leben ermöglichen, aber große Freuden, große Dankbarkeit, große Ungewissheit, großes Erstaunen, Überraschungen verunmöglichen. Die Tage dahinplätschern. Und wir wieder anfangen, uns über Nichtigkeiten aufzuregen. Dass sich der Horizont wieder auf das eigene Dasein, die eigenen Sorgen beschränkt, anstatt die Geschichten und Lebenswelten anderer aufzusaugen. Nichts ist für uns langweiliger, beschränkender, als sich immerfort nur um sich selbst zu drehen.
Wir danken all den Freunden und Verwandten, die sich die Zeit für längere Emails oder gar Telefonate nahmen. Jede Zeile ein enormer Energieschub und Gesprächsfutter für uns, die wir täglich 24 Stunden miteinander verbrachten. Wir danken unseren Eltern, die uns immer begleiteten und letztlich Verständnis dafür entwickelten, dass ihre Kinder nun einmal zwischen den „Realitäten“ wandeln. Unseren Schutzengeln, dass wir und all die Daheimgebliebenen gesund und munter blieben. Und schließlich all jenen, die uns unterwegs einen Einblick in ihre Lebenswelt geschenkt, zum Denken und Umdenken, Lachen, Weinen, Kopfschütteln und Staunen gebracht haben. Mit einem neuen Urvertrauen erreichen wir Thüringen: Egal wo auf dieser Welt – es gibt immer jemanden, der hilft.