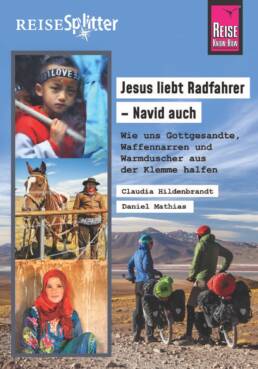USA - Washington & Oregon
27. Juni – 26. Juli 2018 | 1.950 km, 14.950 hm
Niemals streiten Daniel und ich, jede Sekunde scheint die Sonne auf unsere Liebe (haha). Nun, bei diesem Reisebericht hat es gekracht: Gezankt und gefeilscht haben wir um jede der Zeilen, die den vier Nationalparks und vielen Geschichten in Oregon und Washington gerecht werden sollen. Liebe Lesende, entscheidet selbst, wie viel Zeit ihr euch nehmt für Naturschönheiten und Lebenskünstler, wie viel ihr vertragt von Cannabis-Fotografen, Vom-Leben-Gescholtenen, radikalen Abtreibungsgegnern und Heimgeschulten.
Eigentlich wollten wir nach Alaska. Doch der Westen der USA umgarnt uns mit landschaftlichen Reizen, die radlerfreundlich dicht beieinander liegen. Deshalb setzen wir mit der Fähre von Vancouver Island nach Washington über. Im letzten Eck des “immergrünen” Bundesstaates trotzt eine Halbinsel den immerfeuchten Strömen der Westwindzone: die Olympic Peninsula. Aus ihrer Mitte ragt widerspenstig der Mount Olympus empor, ein über zwei Kilometer hoher, vergletscherter Regenfänger. Bis zu 6.000 mm Wasser fallen hier jährlich vom Himmel, in Leipzig sind es 500. Landregen, Starkregen, Nieselregen und Sprühregen tränken die Vegetation (und uns), es tropft, trieft, dampft und nebelt überall. Moose hüllen die knorrigen Baumstämme in ein wattiges Gewand, herab hängen meterlange Flechten, hinauf wachsen Epiphyten und Misteln, darunter Farne und Pilze, alles ineinander und durcheinander. Jeder Quadratzentimeter Grün!
Unser Leipziger Lieblingsausrüster vermittelt uns den Kontakt zu Andreas in Seattle: Der gebürtige Sachse zog Anfang 2000 in die USA, ein Jobangebot bei Microsoft gab den Ausschlag. Nun lädt er zu sich nach Hause ein, ohne uns zu kennen. Wir köcheln, trinken Wein, quatschen bis zum Morgengrauen, als ob wir einen guten Kumpel nach langer Zeit wiederträfen. Am 4. Juli, dem Amerikanischen Unabhängigkeitstag, sitzen wir auf dem Dach, das größte, längste, emotionalste Feuerwerk meines Lebens explodiert direkt vor uns. Andreas’ Partygäste erzählen von den tagelangen Freudentänzen, als Marihuana legalisiert wurde, ebenso die Homoehe. Und dem bis heute anhaltenden Alarmzustand, nachdem Trump ins Weiße Haus einzog. Mit einem Mindesteinkommen von 15 Dollar und einer lokalen Einkommenssteuer entgegen der Landesverfassung ist Seattle liberaler Leuchtturm im sonst republikanisch geprägten Washington. Ich leere das x-te Glas und frage mich, wohin dieses Land steuert, dessen Einwohner uns die tollste Zeit der bisherigen Reise bescheren, und sich gleichzeitig so entgegen stehen?
Der Tod kracht auf jeden ein, der hier vorbeifährt. 43 Grabsteine lassen uns erschaudern, völlig unerwartet auf dem Weg zur Bergkette der Northern Cascades. 2014 verschüttete der Oso-Erdrutsch ganze Familien in ihren Häusern. An einem Samstag Vormittag wurde ihr Leben vom Geröll verschluckt, ob genutzt oder vergeudet, genossen oder ertragen. Ich denke an den Amerikaner vorm Supermarkt, der uns belustigt fragte, wann wir denn endlich „im real life“ ankommen würden. „Job, house, children?“ Arbeit, Kinder, Eigenheim, eine spannende Definition vom „realen Leben“. Doch wieso sollten wir die für uns schönsten Dinge der Welt, Reisen, Fotografieren, Lesen, eintauschen gegen einen Arbeitsalltag? Noch tickt keine biologische Uhr, noch ist die Neugier größer als die Lust auf Routine. Das alles kann warten, zwei Radreisejahre allemal. Was zählt: Jeder soll leben nach seinem Geschmack, schließlich drehen wir nur eine große Runde auf der Erde. Jeder bestimmt, wie viel er mitnimmt bei seinem einzigen Lauf. Und ich will vollgepackt bis oben hin ins Grab flanieren.
Zum anderen: Woher soll ich wissen, was wichtig ist, was unnütz und nichtig? Wenn ich nicht mit Menschen in verschiedenen Ecken der Welt gelitten, gelacht, geweint, sie nach ihren fatalen und goldrichtigen Entscheidungen gefragt habe? Was in der Schule noch verboten war, betreibe ich auf Reisen täglich: Ich spicke. Ich spicke und lunze Lebensmodelle und -weisheiten. Man kann das Leben bunter gestalten, als es die Vorstellungskraft erlaubt und Wege gehen, die man (noch) nicht kennt. Das alles habe ich dem Experten für das „real life“ vorm Supermarkt verschwiegen.
Die Kaskadenkette im Nordwesten der USA zieht sich über 1.100 km vom kanadischen British Columbia bis hinunter nach Kalifornien und teilt die Gegend in zwei klimatische Extreme: sattgrün und kühl im Westen, heiß und trocken im Osten.
Der Gebirgszug ist Ergebnis andauernder tektonischer Aktivität: Seit 70 Millionen Jahren kollidieren tektonische Platten, die einen senken sich und schmelzen, die anderen heben sich und wachsen. Verheerende Erdbeben und Vulkanausbrüche erschüttern die Region in unregelmäßigen Abständen, wie etwa die Explosion des Mount St. Helens 1980, die Asche 24 km hoch in den Himmel schoss und über elf Bundesstaaten regnen ließ. Dutzende Vulkane ploppen aus der zackigen Berglandschaft, ordentlich aufgereiht wie an einer Perlenkette, schneebedeckte Wächter, die ihre Umgebung locker um ein paar Kilometer überragen. Der höchste, und sicher einer der schönsten ist Mount Rainier, ein Klischee von einem Berg: 4.392 m hoch, mit vergletschertem Haupt, kristallklaren Bächen und Almwiesen, die erst jetzt im Juli in voller Blüte stehen.
Wir fahren im Zickzack, erneut geht es für uns Richtung Küste: Highway 101, eine der „Traumstraßen dieser Erde“, entpuppt sich eher als Highway to Hell. Überladene Holztransporter, unsichere Wohnwagenfahrer und genervte Berufspendler verderben selbst die schönsten Abschnitte. Ein besonders gehetztes Arbeitstier bespritzt Daniel gar mit Wasser, damit der von der Fahrbahn springt. Noch nicht bereit zu sterben, fliehen wir zurück ins Inland.
Ich giere nach Feierabend, doch inmitten eingezäunter Enge bleibt nur die Suche nach einem hübschen Vorgarten für unser Zelt. Wir klopfen an – und Miriam öffnet die Tür. Etwa 40, hinter ihr eine große Kinderschar, dazu tragen sie und ihre Töchter gehäkelte Kopfbedeckungen und lange Jeansröcke. Ich habe nur noch Fluchtgedanken, ahne schon den Abend dahinkriechen in Sermonen und missionarischen Umpolungsversuchen. Doch Daniel nimmt bereits die Einladung zum Frühstück an. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus – Gott sei Dank!
Miriams Mutterherz beschlagnahmt uns sofort, sie tischt Pfannkuchen und Früchte auf, Eier und Speck. Während sie zuhause rackert, transportiert Ehemann Rick Benzin, von 1 Uhr nachts bis 18 Uhr abends, zuweilen bis 22 Uhr. Sie sind Mitglieder einer kirchlichen Krankenvereinigung, einmal im Monat überweisen sie Geld, allerdings direkt an den Betroffenen in ihrem Verbund. So wissen sie, wen ihr Beitrag heilt, wem sie das Leben erträglicher machen. Der Nachwuchs wird zuhause unterrichtet. Das Gesetz Oregons verlangt, dass heimgeschulte Kinder alle paar Jahre staatliche Tests in den Hauptfächern absolvieren, dennoch bleibt viel Freiraum. Im Bio-Unterricht der Familie wird Darwin kritisch hinterfragt, denn „God created everything.“ Harry Potter hat keines der Kinder gelesen, weil die Bibel Zauberei und Magie als satanische Sünde verdammt, Hexen und Geister gelten als Diener des Teufels. Nur die Eltern besitzen ein Smartphone, Nachrichten schaut die Familie kaum. Erstaunlicherweise sind Victoria und ihre Geschwister die charmantesten, ausgeglichensten, fröhlichsten und neugierigsten Kinder, die wir seit Langem treffen. Ich muss mich selbst daran erinnern, es nicht gut zu finden, dass die Komplexität meiner Welt in ihrer vielleicht nicht existiert.
Wir erzählen von unserem Plan, es per Anhalter zum weit entfernten Crater Lake zu versuchen – und sitzen zwanzig Minuten später allesamt in der Familienkutsche. Ein spontaner Roadtrip, 350 km mal eben für uns Reiseradler, die wir die Zeit für diesen Abstecher nicht hätten. Ich denke an den Vorabend zurück, meine Anti-Haltung gegen fundamentale Christen. Aber diese Familie überrascht, weil sie nicht zu missionieren versucht, sich nicht nur hinter der hohlen Phrase der Nächstenliebe verbarrikadiert. Ganz nebenbei erzählen sie von ihren Heldentaten, an ihren eigenen Geburtstagen singen sie im Altenheim, backen Kuchen für Nachbarn, versorgen die Witwe nebenan mit Mittagessen. Und verwöhnen uns Fremde.
Crater Lake ist das Überbleibsel des Mazama-Vulkans, dessen Magmablase sich vor knapp 8.000 Jahren zum letzten Mal füllte: Immer weiter erhöhte sich der Druck der gashaltigen Schmelze, bis der Korken knallte und sich ihr Inhalt unter ungeheurem Getöse entleerte. Als würde man eine Seltersflasche schütteln und zu schnell öffnen. Irgendwann war die Kammer leer, stürzte ein und hinterließ eine gewaltige Caldera. Regen und Schmelzwasser füllten die Wanne und schufen den heutigen Kratersee, mit 594 m das tiefste Gewässer der Vereinigten Staaten.
Unser US-Visum läuft bald aus, in Zeitnot müssen wir immer wieder Teilstücke per Anhalter überspringen. Und da stehen wir nun am Straßenrand: Arzt und angehende Lehrerin, in verschwitzter Kleidung, einzig das Rad unterscheidet uns von den vielen Kaputten dieser Gegend. Mitunter steigen wir zu den irrwitzigsten Figuren ein: Da ist Ben, der seinen Lebensunterhalt locker flockig mit dem Fotografieren von Marihuana bestreitet. „Ich komme kaum hinterher mit den vielen Aufträgen, der Markt boomt, seit Pot legalisiert wurde.“ Oder Josh, der als Elektriker 1000 Dollar am Tag verdient und dafür Frau und Kind nur alle zwei Wochen zu sehen bekommt: „Geld macht nicht glücklich, aber süchtig.“ Eric, der 180 km extra für uns fährt: „Ich arbeite Gleitzeit und hab noch keine Lust auf meinen Schreibtisch.“ Dessen Frau psychisch krank ist und kaum Rente ansparen kann. „Es ist völlig unklar, wie sie im Alter zurechtkommt, ich verdiene gerade genug für mich.“ Doch der Tief- und zugleich Höhepunkt ist Melanie. In einem Wagen, der so aussieht, als hätte ihn Henry Ford noch persönlich zusammengeschraubt, zieht sie um, von der Hölle in die Wüste. Ihr Mistkerl von Ehemann prügelte sie grün und blau. Sie las zunächst als Flucht-Strategie, selbst das Britannica Lexikon lenkte sie ab von ihrer erbärmlichen Gegenwart. Nun prescht die Spindeldürre fort, mit ein paar Habseligkeiten und – mühevoll dazwischen gequetscht – 12 Radtaschen und zwei Fahrrädern. Müde wirkt sie, nervös und entschuldigend. „Do you smoke pot?“, fragt sie. „I need only one hit.“ Die zwei Züge beruhigen sie tatsächlich. „Warum hast du uns mitgenommen?“, will ich wissen. „Wir sollten uns doch alle gegenseitig helfen. Pay it forward!“
Nachdem wir in Arizona bereits einen waffennärrischen Priester kennenlernten, übernachten wir nun in der Kirche eines fanatischen Abtreibungsgegners. Pastor Greg ist jung, dynamisch und stimmte 2016 für die Republikaner. Seine Begründung: „Trump schützt das Leben!“ Den Satz muss ich erst einmal verdauen.
Noch ist Abtreibung in den USA erlaubt, jedoch bestehen zwischen den Bundesstaaten starke Unterschiede etwa in der Anzahl durchführender Ärzte. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau interessiert Greg kaum. „Mir geht es nicht um ihren Uterus, sondern um das Leben darin.“ Zu Abtreibungen nach Vergewaltigungen sagt der Pastor: „Was ist schlimmer? Vergewaltigung oder Vergewaltigung plus Mord?“
Später setzt sich eine Glaubensschwester zu uns und beichtet: Ihr Schwiegersohn, christlich und Pastorensohn, chatte in Schwulenportalen. Tauscht Nacktfotos wie Panini-Bildchen. Die Tochter habe ihn dabei ertappt. Auf Empfehlung eines kirchlichen Beraters zog sie kurzzeitig aus, damit sich ihr Ehemann wieder „berappele“. „Wir sind alle Sünder“, zittert das Mütterchen. „Aber ich mache mir große Sorgen, dass mein Schwiegersohn nicht wieder auf den richtigen Weg kommt.“
Wir wollen unsere Leipziger Filterblase überwinden und sind dankbar für jede Story – je haarsträubender, desto besser. Aber manchmal fällt es brutal schwer, Haltung zu wahren, höflich zu bleiben. So leicht könnte die Kirchliche es haben, den Schmu einfach nicht glauben. Dann wäre der schwule Schwiegersohn kein Sünder, sondern ein normaler Mensch, und sei es in Gottes quirlig buntem Tiergarten. Ich wünsche ihr viel Kraft zum Abschied. Eine glatte Lüge, denn eigentlich wünsche ich ihr nur eines: Besinnung.