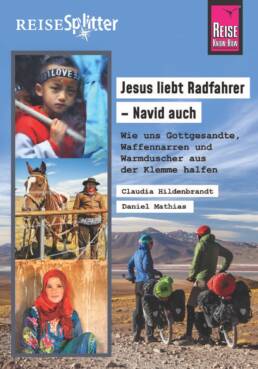Laos
03. – 30. Januar 2018 | 1.030 km, 13.180 hm
Feuerspeiende Vulkane, berstendblaue Gletscher, nach jeder Wendung neue Exotik – all das gibt es in Laos nicht. Dennoch prickelt das Blut in meinen Adern, als unsere Räder laotischen Boden berühren. Denn hier krachte 2014 ein Schweizer Radelpaar in unser Leben. So stark war der Drang, es ihnen gleichzutun. Mit dem Fahrrad die Welt bereisen, in ihre Privatsphäre eindringen. Losradeln und anhalten, wann immer es uns passt! Wenn eine einzige Begegnung gutbürgerliche Pläne in die Tonne katapultiert, dann war es diese.
Laos, eines der ärmsten Länder der Erde, wird seit über 40 Jahren von ein und derselben sozialistischen Partei geschunden. Vom Rest der Welt kaum wahrgenommen, zählt das Land jedoch zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften, es ist reich an Ressourcen wie Mineralien, Edelmetallen, Wasserkraft und Wäldern. Im krassen Widerspruch dazu müssen 75 Prozent der Einwohner ihr Leben nach wie vor mit weniger als 2 € am Tag „gestalten“. Schuld daran sind unter anderem Korruption, ein desolates Verkehrsnetz und ausländische Firmen, die ihre eigenen Arbeiter mitbringen. Vor allem China und Thailand investieren Unsummen in Infrastrukturprojekte wie Wasserkraftwerke und Schienennetze – hauptsächlich jedoch, um die „Batterie Asiens“ anzuzapfen und Absatzmärkte für Exportgüter zu gewinnen. Den Menschen vor Ort bringt diese Expansionspolitik kaum etwas, außer immenser Umweltzerstörung, Verkehrslärm und noch mehr Müll.
Die Armut zeigt sich zunächst von ihrer zuckersüßen Seite. Haben wir im schülerdrillenden China allerhöchstens Babys zu Gesicht bekommen, flitzen uns unweit der laotischen Grenze bereits hunderte Kinder entgegen und rufen mit fiepsigen Stimmchen „Sabaidee,, Sabaidee“, „Hallo, Hallo!“. Ein Drittel der Laoten sind Kinder unter 14 Jahren. Viele verlassen bereits nach fünf Jahren die Schule, ab 12 darf man per Gesetz Vollzeit arbeiten. Laut Unicef erreichen etwa 64 von 1.000 Kindern ihren fünften Geburtstag nicht, in Deutschland sind es vier. Rotznasen, schmutzige Kleidchen, keine Schuhe. Die offensichtliche Armut verleitet manch einen zu seltsamen Gesten der Hilfsbereitschaft: Wir erleben einen Touristen, der die Kinder wie im Sportunterricht einreihen lässt, um ihnen dann druckfrische Dollarscheine zu schenken (sofern sie sich auch brav melden). So erzieht man also Bettler.
Unweigerlich werden wir zu Voyeuren, denn in den fensterlosen Bambushütten schläft man höchstens, gelebt wird draußen! Intimsphäre und Öffentlichkeit verschmelzen am Straßenrand. Überall lodern kleine Feuer, Sammelpunkt für Familien und Klatschtanten. Schon auf den ersten Radkilometern hasten unsere Augen hin und her. Stürmen von Schlachtungen fetter Säue, denen das Blut aus der Gurgel sprudelt, weiter zu Hahnenkämpfen und Glücksspielen. Staunen über nackte Männer, Frauen, Kinder, die ihre Leiber an zentralen Wasserstellen schrubben. Tanzen mit ganzen Dörfern ins Wochenende und stoßen an mit viel Lao-Schnaps, der selbst den kargsten Ort immer freitags in kirmesähnliche Zustände berauscht.
Und wir entwickeln lebhafte Mordfantasien gegenüber laotischen Straßenbauern, denn die haben die Serpentinen vergessen. Stattdessen schneiden die Straßen Berge und Täler in gnadenloser Konsequenz: 15 oder gar 20 Prozent Steigung sind keine Seltenheit. Zu oft jedenfalls zu steil für uns, wir steigen ab und schieben. In der tropischen Mittagshitze rinnt der Schweiß vom Bauch durch den Schritt und regnet von den Füßen – aber es geht, ich hätte nicht gedacht, dass man über Kilometer hinweg ein voll beladenes Reiserad eine Art Skateboard-Rampe hinauf schieben kann. Hinten sausen wir wieder hinunter, bis die Bremsscheiben glühen. Ein kräftezehrendes und brutales Fahren, nach ein paar Tagen ist mein Tretlager locker.
Doch der eigentliche Nervenkitzel kommt am Abend, dann beginnt die Zeltplatzsuche. Manche Gebiete, vor allem im Osten des Landes, sind mit etwa 80 Millionen Minen und Blindgängern verseucht. Laos ist das am meisten bombardierte Land der Welt, gemessen an seiner Einwohnerzahl. Die Amerikaner ließen im „Vietnamkrieg“ 270 Millionen Streubomben regnen, um den Ho-Chi-Minh-Pfad zu zerstören, die Hauptversorgungsroute der Nordvietnamesen. Noch heute sind 30 Prozent davon tickende Zeitbomben. Wir vermeiden es daher tunlichst, ausgetretene Wege zu verlassen. Anderswo patrouillieren Rebellen mit Kalaschnikows. Nachts knallt es oft in den Wäldern und passieren bewaffnete Wilderer unser Zelt, die schlafende Vögel und nachtaktive Nager von den Bäumen ballern. Mehrmals brechen Wasserbüffel aus der Dunkelheit und bahnen sich, schnaubend wie eine Dampflok, ihren Weg am Zelt vorbei. Nicht auszumalen, würde sich eines der massigen Tiere in den Leinen verheddern. Längst haben wir uns an die pflaumengroßen Taranteln, halbmeterlangen Regenwürmer, Moskitoschwärme und Mäuse gewöhnt. Nur eine papierdünne Membran trennt uns von all diesen realen Unheimlichkeiten und meist trage ich Ohrenstöpsel, nach dem Motto: was ich nicht höre, gibt’s auch nicht.
Das größte Problem jedoch sind die allgegenwärtigen Ameisen. Mit einem durchlöcherten Zeltboden und dem Gesicht voller bissiger Krabbeltiere aufzuwachen, wie es anderen schon passiert ist (!), wäre unser persönlicher Albtraum. Peinlich genau untersuchen wir daher einen potentiellen Lagerplatz auf Ameisenstraßen, markieren No-Go-Areas und inspizieren jedes Erdloch auf seine Untermieter.
„Da klopft was!“ Claudia ist hellwach. Tatsächlich, es klingt, als würden unzählige Finger rhythmisch und koordiniert von unten gegen die Isomatten klopfen. Heute haben wir scheinbar einen Termitenbau übersehen, dessen Bewohner die feindliche Besatzung spät in der Nacht bemerkt haben und auf der Zeltplane nun buchstäblich Verstärkung zusammentrommeln. Wir liegen regungslos und hoffen auf Frieden, doch es hilft nichts: das erste von insgesamt drei Mal in dieser Nacht müssen wir einpacken und das Zelt ein paar Meter weiter erneut aufbauen.
Immer häufiger steuern wir abends buddhistische Klosteranlagen an, deren Mönche uns stets willkommen heißen und als Highlight des Tages ihre Eimerdusche überlassen. Sichere Refugien mit samtweichen Rasen, ohne Büffel, ohne Wilderer, ohne Schüsse. Fast jeder junge Mann verbringt zumindest ein paar Wochen seines Lebens im Kloster und gilt erst danach als „reif“, die Zeiten der Enthaltsamkeit sind also nur vorübergehend. So wundert es nicht, dass die jungen Novizen genauso den weltlichen Genüssen erliegen wie wir auch: Smartphones, Zigaretten, Beer Lao. Die hochangesehen Mönche werden von der Dorfgemeinschaft am frühen Morgen mit allerlei Gaben versorgt. Wir beobachten das Kommen und Gehen der Dorfbewohner aus dem Zelt heraus – und werden im Gegenzug genauso aufmerksam beäugt. Die Klöster sind häufig zentral im Dorf gelegenen, sodass Horden neugieriger Kinder jeden unserer Handgriffe beobachten. Auch die Eltern kommen gerne kucken. Manche verfolgen uns sogar bis ins „Badezimmer“, wann lässt sich denn sonst ein nacktes Bleichgesicht aus der Nähe inspizieren? „Falang, Falang“, tuschelt es um uns herum: „Weißgesichter“. Die Türe hinter sich zumachen können, Füße hoch auf die eigene Couch. Ein ferner Luxus.
Obwohl uns ein Mönch zum Abschied segnete… kurz vor Luang Prabang passiert es. Ich trinke zu wenig, da am Boden der Plastikflasche schon wieder Algen wachsen. „Heute Abend wird die ausgekocht!“, nehme ich mir vor. Etwas schwummrig vor den Augen rutsche ich in einer Schottergrube aus und bremse mit dem Knie. Sofort blitzt die Frage auf: Ist etwas gebrochen? Nein, ich kann aufstehen. Blut rinnt mein Bein hinunter. Ich bin eine Memme, heule, kann mein Blut nicht sehen. Ich wünschte, ich könnte in Ohnmacht fallen und das Bewusstsein erst wieder anknipsen, nachdem der Kies aus der Wunde gespült ist und der Verband sitzt. Doch das Radlerleben ist kein Ponyhof. Und uns ist beiden klar: Diese Reise kann eher früher als später vorbei sein.
Ein ganz besonderer Krankenbesuch erwartet uns in Luang Prabang: unser Leipziger Freund Marci fliegt ein und schon wieder kullern die Tränen, dieses Mal aber vor Freude. Nach neun Monaten „einsam zu zweit“ lechzen wir nach Kontakt zu unseren Freunden. Marci, selbst viel in der Welt und auf dem Rad unterwegs, ist die lang ersehnte Linderung unseres Heimwehs.
Gemeinsam futtern wir uns durch Baguette-Stände und Nachtmärkte und streifen durch die wohl charmanteste Stadt Südostasiens. Dutzende reich verzierte Tempelanlagen bestimmen das Bild des am Mekong gelegenen Weltkulturerbes. Noch vor 30 Jahren von der Außenwelt nahezu abgeschottet, prallen in Luang Prabang seit dem Unesco-Label buddhistische Hochkultur und Massentourismus in rasender Geschwindigkeit aufeinander.
Damit sich mein verbeultes Knie noch ein paar Tage schonen kann, schippern wir auf dem Mekong Richtung Thailand. Laos hinterlässt gemischte Gefühle. Es gibt Streckenabschnitte, da jubelt man uns zu wie den Langstreckenläufern beim Leipziger Stadtmarathon, ein einzigartiger Ansporn, der alle Strapazen wieder wett macht. Andernorts winken noch nicht einmal die Kinder und fühlen wir uns wie wandelnde Geldbeutel. Weshalb die Gastfreundschaft der Laoten so variiert, können wir uns nicht erklären. Und wir merken, dass uns etwas fehlt: weite Landschaften, mehr Privatsphäre und Nächte ohne Ohrenstöpsel. Dennoch sind wir dankbar, das Land noch einmal auf den Rädern erkundet zu haben – so viel mehr haben wir erlebt, soviel unabhängiger konnten wir reisen!